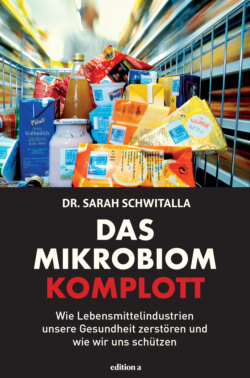Читать книгу Das Mikrobiom-Komplott - Sarah Schwitalla - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Krankes Mikrobiom – kranker Mensch?
ОглавлениеDie Zellstruktur unseres außergewöhnlichsten Organs ist abhängig von vielen Faktoren. Doch besonders davon, was wir essen. Denn jedes Mal essen unsere Mikroben mit. Wie wir uns täglich ernähren, bestimmt entscheidend, wie gesund wir selbst und die Mikroben-Community in unserem Darm sind.
Seit wenigen Jahren stellen immer mehr Wissenschaftler etwas Faszinierendes fest: Wenn ein Organ aus menschlichen Zellen chronisch krank ist, etwa unsere Niere, der Darm oder unser Herz, scheint gleichzeitig auch unser gesamtes mikrobielles Organ krank zu sein.
Einige Studien versuchen dies anhand einer scheinbar veränderten Bakterienzusammensetzung zu untersuchen. Doch wie wir erfahren haben, sagen die Bakterien alleine noch nicht viel aus.
Es ist viel wichtiger, zu beobachten, wie sich der Stoffwechsel des Mikrobioms verändert, sprich die Substanzen in unserem Darm und Blut. Es ist derzeit in manchen Fällen noch unklar, ob das Mikrobiom selbst die anderen Organe krank macht oder ob es ein unabhängiger Betroffener ist. Klar ist, dass nur für höchstens 15 bis zwanzig Prozent der chronischen Krankheiten ein bestimmtes Bakterium oder ein Virus der Übeltäter ist, der uns krank gemacht hat.56
Eine globale Studie aus dem Jahr 2008 kam beispielsweise zu dem Ergebnis, dass lediglich 16,1 Prozent der Krebsfälle durch mikrobielle Infektionen hervorgerufen werden. Eine Mikrobe kommt selten allein. Auch wenn es um chronische Krankheiten geht: Sie arbeiten immer im Kollektiv.
Zu den vermeintlichen Einzeltätern gehören beispielsweise das Bakterium Helicobacter pylori oder auch Viren wie Hepatitis-B, Hepatitis-C und humane Papillomviren (HPV). Eine von ihnen verursachte chronische Infektion kann das Risiko für Magen-, Leber- und Gebärmutterhalskrebs steigern.57 Aber diese Mikroben sind nicht die Wurzel allen Übels, sie sind eher opportunistische Gelegenheitstäter.
Obwohl Barry Marshall im Jahr 2005 der Nobelpreis für seine Entdeckung von Helicobacter pylori und der Rolle bei der Entstehung von Magengeschwüren verliehen wurde, erkannte er jedoch auch selbst, dass achtzig Prozent der »Infektionen« mit Helicobacter pylori überraschenderweise asymptomatisch bleiben.58 Tatsächlich führen nur ein bis vier Prozent der Infektionen überhaupt zu Magenkrebs.59 Demnach sind die meisten Menschen auf der Welt mit Helicobacter pylori »infiziert«, ganz ohne es zu merken. Ganz ohne jemals Magenkrebs zu bekommen.
Das ganze Mikrobiom-Organ scheint bei fast allen chronischen Krankheiten aus dem Gleichgewicht geraten zu sein. Wer eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, Alzheimer oder Typ-2-Diabetes hat, spürt jedoch nicht direkt, dass auch sein mikrobielles Organ ebenfalls krank sein könnte oder es vielleicht schon lange vorher war. Wenn das Mikrobiom jedoch sich anders zu verhalten beginnt, wenn es anstelle von körpereigenen therapeutischen Substanzen giftige Waffen produziert, ist es um die Gesundheit unserer Organe nicht gut bestellt.
Das Mikrobiom kann sich also gegen uns richten. So ähnlich, als wenn unser Immunsystem bei einer Autoimmunerkrankung unsere eigenen Zellen angreift.
Seit den ersten Erkenntnissen aus dem menschlichen Mikrobiom-Projekt im Jahr 2009 beobachten Wissenschaftler verstärkt einen Zusammenhang zwischen einem kranken Mikrobiom und einer ganzen Reihe chronischer Krankheiten: von Autismus und Alzheimer bis zu Typ-2-Diabetes, Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Asthma, chronisch entzündlichen Darmerkrankungen oder Darmkrebs.
Die genauen Zusammenhänge und Mechanismen sind noch umstritten, schwer zu durchblicken und sorgen für heiße Diskussionen unter Wissenschaftlern. Das ist nicht nur der einzigartigen Komplexität des lebhaften Mikrobioms, sondern auch dem Umstand geschuldet, dass sich bis dato noch immer viele Studien auf einzelne Bakterienspezies oder die taxonomische Zusammensetzung im Stuhlgang konzentrieren, anstatt auf die Stoffwechselsubstanzen der Bakterien in unserem Blut, die nach dem Essen entstehen. Bei vielen Krankheiten gehen die Erkenntnisse außerdem nicht ausreichend über die genetisch veränderten Tiermodelle in einer künstlichen Laborumgebung hinaus und sind kaum auf das bunte Leben eines Menschen oder seiner Mikroben in der realen Umwelt übertragbar. Korrelation und Kausalität sind in den meisten Fällen noch nicht gut untersucht. Wenn Forscher sich allerdings auf Stuhlanalysen oder die Mikrobiom-Zusammensetzung fokussieren, ist es nicht verwunderlich, dass angesichts der dadurch missachteten tatsächlichen Architektur des Organs und der relativ großen Unterschiede der Bakterien von Mensch zu Mensch viele widersprüchliche Ergebnisse entstehen.
Ebenso wenig überraschend existiert deshalb auch noch keine einheitliche Definition für eine gesunde Mikrobiom-Zusammensetzung. Vielmehr ist man sich einig dabei, welche der mikrobiellen Substanzen therapeutisch und welche krankheitsfördernd wirken. Wer mehr darüber erfahren möchte, wie das Mikrobiom uns chronisch krank machen kann, dem sei an dieser Stelle mein Buch Toxic Microbiome empfohlen (Taylor & Francis, 2022).
Die erstaunlichen bisherigen Erkenntnisse über das Mikrobiom und welch mächtige Rolle es bei chronischen Krankheiten spielt, verleiten viele Wissenschaftler zu vorschnellen Schlüssen, die von der Öffentlichkeit aufgegriffen werden. »Pressesprecher müssen aufhören, Ergebnisse zu übertreiben, und Journalisten müssen aufhören, sie ganz zu schlucken«, kritisieren daher einige Forscher. »Die Mikrobiom-Wissenschaft braucht eine gesunde Portion Skepsis.«60 Vorschnelle Schlüsse können Wissenschaftler in die falsche Richtung schicken. Wissenschaft braucht Zeit. Doch trotz der bestehenden Ungereimtheiten gibt es bereits konkrete Belege, dass einige Substanzen unseres Mikrobioms – unabhängig von anderen Risikofaktoren – die Gefahr signifikant erhöhen, zum Beispiel an einem Herzinfarkt, an Thrombosen oder an einem Schlaganfall zu sterben.
Wir werden krank, weil unser Mikrobiom entweder zu wenig von den gesunden Substanzen herstellt oder zu viel von den giftigen. Beides geht meist Hand in Hand. Die »Krankheit« des Mikrobioms wird oft als Dysbiose bezeichnet. Doch genauso wenig, wie man sich unter Wissenschaftlern bisher darauf geeinigt hat, was eine gesunde Darmflora ist, hat man sich ebenso wenig darauf verständigt, wie eine krankhafte Darmflora zusammengesetzt ist.
Es gibt auch nicht die kranke Darmflora, denn individuell sieht dies für jeden Patienten und je nach Krankheit anders aus. Es könnte kaum komplexer sein. Das sorgt zusätzlich für Verwirrung im wissenschaftlichen Diskurs, weil jeder diese sogenannte »Dysbiose« in seinen Studien anders auslegt und man sich nicht einig wird.
Ende 2019 tagte ein internationales Wissenschaftlerkonsortium zu diesem Thema und äußerte sich überaus kritisch gegenüber dieser »Wildwestmanier« in der Forschung, die nicht gerade für Klärung sorgt, geschweige denn zum Fortschritt beiträgt: »Wie können wir diese Anomalien aufklären, wenn selbst ein Konsens darüber, was ein ›normales‹ Mikrobiom ausmacht, schwer zu definieren ist? Wir schlagen vor, dass ein funktioneller Ansatz bei der Diskussion über Normalität und Dysbiose des Mikrobioms von größerem Nutzen ist. Im Hinblick auf die Entstehung von Krebs schlagen wir vor, dass Dysbiose als eine anhaltende Abweichung des Wirtsmikrobioms vom gesundheitsassoziierten homöostatischen Zustand hin zu einem krebsfördernden betrachtet werden sollte.«61
Es ist also nicht so wichtig, wer sich da namentlich alles tummelt. Hauptsache, die tägliche Arbeit wird erledigt.
Wir Menschen sind abhängig von den gesunden, therapeutischen Molekülen unserer Mikroben, um dauerhaft einen gesunden Körper zu erhalten.
Der Mikrobiom-Forscher Prof. Rob Knight beschreibt in seinem Buch Follow your gut treffend und bildlich, wie sehr es um das ganze Organ Mikrobiom und seine Substanzen geht und weniger um einzelne Spezies: »Besonders interessant ist, dass sich die Mikroben in den Patienten nicht normal zu verhalten scheinen: Ihr Stoffwechsel ist gestört, sie fressen und schütten andere Chemikalien aus. Wir wissen noch nicht, ob dieses veränderte Verhalten durch die Immunreaktion des Körpers verursacht wird oder ob die Mikroben daran schuld sind. Unser Immunsystem führt nicht so sehr Listen mit guten und schlechten Mikroben, als dass es sich mit dem Verhalten von guten und schlechten Mikroben beschäftigt. Unser Immunsystem ist nicht das FBI, das eine Fahndung nach John Dillinger durchführt. Stattdessen ist es der Wachmann in der Bank, der ausflippt und das Feuer eröffnet, wenn jemand über den Schalter springt und anfängt, Geld in einen Sack zu stopfen.«62
Doch wer oder was hat die Mikroben dazu gebracht, sich kriminell zu verhalten und das Geld in den Sack zu stopfen?
Ernährung hat den stärksten und nachhaltigsten Einfluss auf das Verhalten der Mikroben. Wir essen schließlich jeden Tag. Mehrmals. Wie stark dieser Einfluss ist, dokumentieren mittlerweile diverse Studien, in denen Forscher im Blut der Probanden mehr therapeutische Moleküle feststellen, wenn viele pflanzlich basierte Nahrungsmittel in der Ernährung Platz haben, als bei jenen Probanden mit einer westlichen Ernährung mit vielen tierischen Produkten, Fast Food und industriellen Lebensmitteln.63-65,66,67
Ganz im Gegensatz zu den therapeutischen Molekülen unserer Darmbakterien, stehen toxische Substanzen im Blut unter anderem mit einem hohen Darmkrebsrisiko in Verbindung.68,69 Die zirkulierenden Substanzen sind der Nährboden für viele Krankheiten. Ernährung beeinflusst das Verhalten der Mikroben bereits nach wenigen Tagen, doch erst die dauerhafte Form der Ernährung wirkt nachhaltig. Es ist nicht so relevant für das Mikrobiom, ob man einmal im Jahr ein Schnitzel und Pommes isst, sondern ob man es ständig tut. Denn der Stoffwechsel der Mikroben passt sich besonders an dauerhafte Einflüsse an, genau wie unser eigener.
Doch welche Lebensmittel sind es, die uns und unsere Mikroben krank machen? Und wenn doch offiziell eigentlich schon lange bekannt ist, dass uns diese Lebensmittel krank machen, warum werden sie uns dann immer noch als gesund oder unbedenklich verkauft?