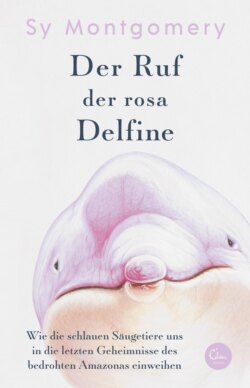Читать книгу Der Ruf der rosa Delfine - Сай Монтгомери - Страница 10
Ein rosa Rücken kann auch entzücken
ОглавлениеAm Morgen unserer Abreise zum Zusammenfluss von Solimões und Rio Negro mussten wir unbedingt noch ein gefrorenes Hähnchen besorgen. Das hatte mir Vera da Silva in unserem letzten Gespräch dringend ans Herz gelegt, einem Gespräch, das bei mir den Eindruck hinterließ, unsere Expedition sei gescheitert, bevor sie noch begonnen hatte.
Vera hätte uns auf der Reise begleiten sollen. Vera ist am Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) Direktorin der Abteilung für Wassersäugetiere und erforscht die rosa Delfine schon länger als irgendjemand sonst. Wir hatten uns auf der Meeressäuger-Konferenz in den Vereinigten Staaten kennengelernt.
Sie hatte sich bereit erklärt, uns zu den rosa Delfinen zu bringen. Dorthin, wo sie vor elf Jahren begonnen hatte, ihr Verhalten zu studieren: an einem See namens Marchantaria im Überschwemmungsgebiet des Rio Solimões, gleich nach dem Zusammenfluss.
Ich hatte Veras Arbeiten gründlich studiert und war voll Bewunderung für sie. Einer ihrer Aufsätze hatte mir die Idee gegeben, ich könnte vielleicht etwas Neues über diese Tiere herausfinden. »Delfine der Unterart Inia sollten nach Möglichkeit in die Liste der schützenswerten Wandertiere aufgenommen werden«, hatte es dort geheißen. »Eine an Jahreszeit und Wasserstand ausgerichtete Migration der Inia- Delfine scheint fast sicher.« In dem Aufsatz fanden sich noch Angaben über Stellen, an denen die wandernden Delfine Landesgrenzen überquerten. Daraufhin fasste ich den Plan, den Delfinen bei ihrer Wanderung zu folgen.
Aufgrund dieses Plans wurde mir die Finanzierung der Expedition bewilligt. Als wir in Manaus ankamen und Vera im INPA besuchten, wollte ich dementsprechend natürlich vor allem Vorschläge von ihr hören, wie ich die Migration der Delfine verfolgen könnte.
»Die Botos wandern nicht«, sagte sie.
»Was? Aber das steht doch in Ihrem Aufsatz.«
»Ja«, sagte sie. »Wir glaubten es eine Zeit lang. Aber das war vor der Telemetrie. Jetzt wissen wir, dass sie nicht wandern.«
O weh.
Trotz meines gescheiterten Plans waren wir sicher, von Vera eine Menge über die Delfine erfahren zu können. Außerdem mochten wir sie gern. Wir fühlten uns sofort wohl in ihrem kleinen Büro, das mit Bildern von Seekühen, Walen, Delfinen und Robben förmlich austapeziert war. An einer Schublade klebte ein Zitat von Rebecca West, das Vera, die in einem Macho-Land wie Brasilien und noch dazu in einer Männerdomäne arbeitete, wohl sehr treffend fand:
Ich kann nicht genau sagen, was Feminismus ist: Ich weiß nur, dass ich immer Feministin genannt werde, wenn ich Empfindungen ausdrücke, die über das Niveau eines Fußabstreifers hinausgehen.
Vera selbst ist im Lauf der zwanzig Jahre den Delfinen, die sie studierte, in gewisser Weise ähnlich geworden: Sie ist etwas rundlich, glatt und geschmeidig, und ihr Lachen perlt wie die Blasen, die ein Delfin unter einem Kanu aufsteigen lässt. »Wenn man mit dem Boot stundenlang an derselben Stelle bleibt, kommen sie und berühren das Boot von unten«, erzählt sie mit glänzenden Augen. »Man merkt es, wenn sie da sind, weil man den Atem aufsteigen sieht. Es ist ein hübsches Geräusch, wenn die Bläschen an der Wasseroberfläche platzen. Manchmal tauchen die Botos auch direkt am Boot auf und schauen einen an.«
Ich wollte ein paar technische Dinge von ihr wissen: Welche Tageszeit war in Marchantaria am günstigsten für die Beobachtung? Wie konnte sie die einzelnen Tiere auseinanderhalten? Wie folgte sie ihnen?
»In Marchantaria«, sagte sie, »war ich jeden Tag von sechs Uhr morgens bis sechs Uhr abends auf dem Posten und habe versucht, die Tiere zu identifizieren und wiederzuerkennen. Das ist außerordentlich wichtig. Sonst kann man ihr Verhalten nicht studieren.«
Und wie, wollte ich wissen, hatte sie es schließlich geschafft?
»Ich habe es lange versucht, aber nicht geschafft. Es war zu mühsam. Es klappt einfach nicht.«
O weh.
Die meisten Daten, die sie bisher gesammelt habe, erklärte sie in holprigem, mit portugiesischen Wörtern untermischtem Englisch, stammten aus einer 1.600 Kilometer entfernten Gegend, einem überfluteten Waldgebiet, das Mamirauá heißt. Dort hatte sie 56 Delfine markiert und später ein weiteres Dutzend mit Sendern ausgestattet, sodass man sie verfolgen konnte.
Obwohl sie in Marchantaria in dieser Hinsicht erfolglos gewesen war, würde Vera für uns dort als Begleiterin wertvoll sein. Während wir gemeinsam die Delfine beobachteten, würden wir von ihrem erstaunlichen Wissen profitieren; sie würde uns das Verhalten der Tiere erklären und uns sagen können, welche Versuche Erfolg versprachen und welche nicht. Das dachte ich zumindest. Doch als Dianne und ich uns gerade für die Oper umzogen, rief Vera im Hotel an und teilte uns mit, dass sie sich eine Bindehautentzündung zugezogen habe und nicht mitkommen könne.
Wie wir erfuhren, war das ganze INPA von jener Viruserkrankung an den Augen heimgesucht worden. Teils konnten die Leute nicht zur Arbeit kommen, weil sie nicht genug sahen, um Auto zu fahren, teils konnten sie ohnehin nicht arbeiten, weil sie vollauf mit Augenreiben beschäftigt
waren.
Schon allein beim Gedanken fingen meine Augen an zu jucken.
Vera würde uns ihren Assistenten, Nildon Athaide, als Guide mitgeben. »Er weiß alles«, versicherte sie uns. Leider fiel mir zu spät ein, dass Nildon kein Englisch sprach, und jetzt war es zu spät, einen Dolmetscher zu suchen.
»Kein Problem«, sagte Vera. »Nur eines ist ganz wichtig: Sie müssen ein tiefgefrorenes Hähnchen mitnehmen. Nildon ist verrückt danach. Vergessen Sie ja das Hühnchen nicht!«
So kam es also, dass ich in einem Laden eine längere, an Missverständnissen reiche Diskussion mit einer Verkäuferin hatte. Gefrorenes Hähnchen kam in meinem portugiesischen Sprachschatz nicht vor und im Rückblick scheint es mir ziemlich wahrscheinlich, dass frango gelado, was ich von ihr forderte, Hühnereis heißt. Schließlich kam Nildon, dem das Schwitzen im wartenden Wagen zu dumm geworden war, selbst herein und sorgte dafür, dass die Expedition nicht an einem fehlenden Hähnchen scheiterte. Ich persönlich kann mir zwar nicht vorstellen, was man daran findet – ich bin Vegetarierin –, aber Nildon war schließlich stets und ständig von Fischen umgeben und würde in nächster Zeit auch nur von dem leben, was er aus dem Fluss holte. Da konnte eine Abwechslung wirklich nicht schaden.
Als wir also das wichtige Hühnchen besorgt hatten, konnte es endlich losgehen. Wir fuhren zum nahen Porto da Ceasa, wo bereits das fünf Meter lange Leichtmetallboot auf uns wartete, das uns zum Zusammenfluss und zu den Delfinen bringen sollte.
Der Amazonas war geradezu eine Kloake. Als wir ablegten, wurden wir beim Anblick des schmutzigen Wassers ganz verzagt. An Spraydosen, Ölbüchsen, Colaflaschen war kein Mangel. Plastiktüten glitten dahin wie Quallen. Wir blickten zurück nach Manaus und sahen die großen Reklameschriften auf den hohen Gebäuden des Industriegebiets: Samsung, Sony, Honda, Shell. Aus Fabrikschornsteinen drang schwarzer Qualm. Schnellboote rasten an uns vorbei.
In fünf Minuten waren wir beim Zusammenfluss. Von der Höhe eines Ausflugsdampfers herab blickten Touristen auf das Nebeneinander von Kaffee und Milch. Genau in dem Moment, in dem wir ankamen, wurden zwei dreieckige Rückenfinnen sichtbar. Sie schnitten an der Grenze von Hell und Dunkel durch das Wasser.
»Tucuxis!«, schrie Nildon über den Lärm unseres 15-PS-Motors hinweg. Das sind kleine graue Delfine, deren brasilianische Bezeichnung aus der Tupi-Sprache stammt. Der wissenschaftliche Name ist Sotalia fluviatilis. Anders als die Botos, mit denen sie sich diese Gewässer teilen, entsprechen die Tucuxis in Aussehen und Verhalten dem, was man von Delfinen erwartet. Sie haben einen kompakten Körper, ausgeprägte Schnauzen und dreieckige Rückenfinnen; sie springen aus dem Wasser hoch, drehen sich Sprühregen verspritzend in der Luft und tauchen platschend wieder ein. Auch unsere Tucuxis amüsierten sich auf diese Weise. Erst sprang der eine und zeigte dabei seine glatte rötliche Unterseite, dann der andere, und schließlich sprangen beide gemeinsam, so nahe nebeneinander, dass sie sich fast berührten. Dianne ergriff meine Hand. »Gestern die Oper«, schrie sie, »und heute das Ballett.«
Die Tucuxis sind allgemein beliebt, hatte Vera uns erzählt. Den großen Botos trauen die Menschen am Fluss nicht, weil sie manchmal sehr plötzlich an die Boote herankommen.
So kühn sind die Tucuxis nicht. Sie führen ihre Freudensprünge immer in einiger Entfernung aus, und sie sind hübsch und klein, höchstens eineinhalb Meter lang. Sie sehen aus wie Miniaturausgaben von Meeresdelfinen, sind ebenso stromlinienförmig und wirken mit ihrem Lächeln genauso freundlich.
Sie gehören, wie die Meeresdelfine, zur Familie der Delphinidae und haben früher einmal mit großer Wahrscheinlichkeit ausschließlich im Meer gelebt. Noch heute findet man sie in Süß- und Salzwasser, von Brasilien bis Honduras. Man schätzt, dass sie vor etwa fünf Millionen Jahren aus dem Atlantik in den Amazonas vorgedrungen sind.
Die Botos dagegen, die eigentlichen Amazonasdelfine (Inia geoffrensis), bilden wahrscheinlich zusammen mit den La-Plata-Delfinen eine eigene Familie, die Iniidae. Sie werden bis zu zweieinhalb Meter lang und können zweihundert Kilo wiegen.
Sie unterscheiden sich äußerlich von anderen Delfinen: Sie haben keine ausgeprägte Rückenfinne, lediglich einen niedrigen Kamm. Die Flossen sind sehr groß, fast wie Flügel. Aber am deutlichsten ist der Unterschied im Gesicht zu sehen: Die stark gewölbte Stirn wirkt zu groß für das Gesicht; die Augen sind sehr klein. Das Gesicht läuft in einen röhrenförmigen Schnabel aus, der oft zur Seite gebogen ist. Zwei Forscher, die in Florida gefangene Botos studiert hatten, beschrieben sie einmal als »schweinsäugige, bucklige, langnasige, runzlige Überbleibsel aus vergangenen Zeiten«.
Sie stammen wahrscheinlich aus dem Pazifik und sind vor 15 Millionen Jahren in den Amazonas eingedrungen, als er noch nach Westen floss, bevor das Gebirge der Anden entstand. Damals bewegte sich die südamerikanische Platte nach Westen, der Nazca-Platte entgegen. Beim Zusammenprall der beiden tektonischen Platten türmten sich die Anden auf und schnitten dem Amazonas den Weg zum Pazifik ab. Bis er sich einen neuen Weg schuf, ostwärts in den Atlantik, war der Amazonas fünf Millionen Jahre lang kein Fluss, sondern ein riesiger See, der größte, den es je auf der Welt gegeben hat. Und in diesem See entwickelte sich eine erstaunliche Artenvielfalt. Im Mississippi gibt es beispielsweise nur 250 Fischarten, im Kongo knappe tausend, im Amazonas aber über 2.500, und viele dieser Arten existieren nirgends sonst auf der Welt. Die Regenzeit lässt diesen riesigen See jedes Jahr aufs Neue entstehen.
Nach einer halben Stunde Fahrt hatten wir alle Spuren von Manaus und seinem Dreck hinter uns gelassen und bogen ab zu einem Ort namens Catalão, wo wir ein paar Tage bleiben wollten. Von einer Ortschaft war allerdings nichts zu sehen; weit und breit gab es nur Wasser und Bäume, die bis zur halben Höhe darin standen.
Seit Anfang Dezember hatte es fast täglich geregnet, und alle Flüsse im Amazonasgebiet waren pro Monat um zwei bis drei Meter angestiegen. Erst im Mai würde es mit dem Regen ein Ende haben. Jetzt, im April, war das Wasser auf beiden Seiten des Stroms bis zu fünfzig Kilometer ins Land vorgedrungen und hatte Wald und Dörfer überflutet. Unter unserer schwimmenden Behausung würden sich heute Nacht Delfine tummeln.
Es gab weit und breit nur noch ein einziges anderes Haus, das einer Waldarbeiterfamilie gehörte, wie Nildon erklärte. Es lag, wie unseres, auf hölzernen Pontons und war an einen Baum gebunden. Es besaß sogar eine Fernsehantenne, aber natürlich keine Stromzuleitung. Den Strom lieferte wohl ein Generator. Rund ums Haus wuchsen Pflanzen in Töpfen, und Hühner pickten auf dem Holzdeck nach Insekten.
Als das Boot anlegte und der Fahrtwind aufhörte, traf uns die Mittagshitze wie ein Keulenschlag. An der Küchendecke baute eine fünf Zentimeter große Wespe an ihrem Nest. Winzige Ameisen liefen in Massen über den Küchentisch. Die Tischbeine standen zwar in abgeschnittenen, mit Wasser gefüllten Pepsi-Cola-Flaschen, aber das hatte die Ameisen nicht abhalten können. Große grüne Libellen standen über den purpurnen Blüten der Wasserhyazinthen. Aber außer den Insekten regte sich nichts in der lähmenden Hitze.
Nildon verstaute sein kostbares Hähnchen im gasbetriebenen Kühlschrank, und wir legten uns in unsere Hängematten. Das Wasser um uns herum lag ohne Bewegung, zeitlos, dunkel, warm und glitzernd, voller Geheimnisse und Verheißungen.
Gegen drei Uhr nachmittags war die Hitze erträglicher geworden; Wolken türmten sich auf und es sah wieder mal nach Regen aus. Nildon ließ den Bootsmotor an und wir machten uns auf die Suche nach Botos.
Schon bald tauchten in unserer Nähe Tucuxis auf. Ich hatte gelesen, dass Tucuxis, im Gegensatz zu den Botos, gesellig sind. Nildon stellte den Motor ab und wir beobachteten ihr Wasserballett. Vielleicht waren sie auf der Jagd und ihre Sprünge dienten taktischen Zwecken, aber für uns wirkte die Szene wie eine Äußerung purer Lebensfreude.
Doch wo waren die rosa Delfine?
»Inia gosta lago«, sagte Nildon. Die Botos halten sich lieber in Seen auf. Deswegen hatte Vera, die ihre Beobachtungen am Zusammenfluss begonnen hatte, sich später dem Überschwemmungsgebiet von Marchantaria zugewandt. Weil sie gern im flachen Wasser der überfluteten Wälder leben, haben die Botos auf dem Rücken nur diesen schwach ausgeprägten Kamm statt einer steilen Finne. »Sie würden sonst dauernd an Ästen hängen bleiben«, hatte Vera erklärt.
Wegen dieser Vorliebe für Wälder sind Botos viel schwerer zu finden; sie springen auch selten. Wenn sie sich hier genauso verhielten wie in Sundarbans, dann musste man auf plötzliche, eher unauffällige Bewegungen im Wasser achten.
Und tatsächlich tauchte bald ein rosa Rücken auf. Im ersten Moment traute ich meinen Augen nicht. Diese unwahrscheinliche Farbe! Ungefähr eine Sekunde lang dauerte die Erscheinung, aber ich brauchte viel länger, um mich wieder zu fassen.
Dianne war genauso hingerissen wie ich, Nildon lächelte breit.
Wir behielten die Stelle im Auge und hofften, der Boto möchte sich noch einmal zeigen. Statt seiner gesellten sich jedoch zwei Tucuxis zu uns und trieben ihr Spiel. Vielleicht hatten sie sich vom Boto zeigen lassen, wo es Beute gab, vielleicht hatten sie ihn auch nur verjagt. Ich hätte so gerne mehr von ihm gesehen: den Schwanz, die Flossen, den Kopf.
Wir zählten mit: An diesem Nachmittag bekamen wir 54-mal Tucuxis zu Gesicht. Es seien etwa zehn verschiedene Exemplare gewesen, sagte Nildon. Der Boto aber blieb verschwunden.
Um halb fünf schreckte uns fernes Donnergrollen auf. Die Wolken waren schwarz geworden. Schwalben flitzten durch die Luft. Am Himmel rührte sich nichts. Wir beobachteten die Spiegelung der Gewitterstimmung im Wasser, und plötzlich erschien wieder, vielleicht dreißig Meter entfernt, ein rosa Rücken mit flachem Kamm im Wasser. Wir glaubten, den Buckel auf der Stirn zu sehen, und hörten das Atmen, bevor er wieder abtauchte. Auch hinter uns atmete es langsam. Also drehten wir uns um und sahen direkt neben dem Boot einen feinen Sprühnebel. »Manchmal sieht man nur den Atem, aber nicht den Boto«, hatte Vera gesagt. Jetzt wussten wir, was sie damit gemeint hatte. Und da war es schon wieder, dieses keuchende Atemgeräusch – diesmal aus einer anderen Richtung. Es gab hier also mindestens zwei Botos. Und sie waren zu uns gekommen.
Doch nicht nur die Delfine, auch das Unwetter kam näher. Das Wasser sah aus wie flüssiges Silber, die Welt war eigenartig farblos geworden. Grell zuckten die Blitze am Himmel. Sie waren von einem intensiven, faszinierenden Rosa. Erst später wurde mir zu meiner eigenen Überraschung bewusst, dass wir mitten im Gewitter in einem Metallboot auf dem Wasser gesessen und überhaupt keine Angst gehabt hatten. Wir hätten uns wohl kein deutlicheres, kein günstigeres Omen vorstellen können: Der Himmel blitzte rosa und signalisierte, dass er unsere Pläne billigte und unterstützte, während unsichtbare Delfine uns mit ihrem Nebelatem umgaben.