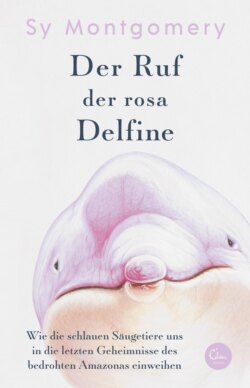Читать книгу Der Ruf der rosa Delfine - Сай Монтгомери - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Manaus: Das Paris der Tropen
ОглавлениеMitten im größten Regenwald der Erde, tausend Meilen von der Küste entfernt, steht am Amazonas ein Opernhaus.
Jedes einzelne Teil davon ist per Schiff über den Atlantik gebracht worden. Das gusseiserne Gerippe kam aus Glasgow, der Marmor aus Verona und Carrara, das Zedernholz aus dem Libanon, die Seide aus China. Hundert Seekisten voll Mobiliar, fein geschnitzt und mit Samt gepolstert, wurden aus London herangeschafft. Nur das Holz der Parkettböden – Eiche, Brasilholz und Jakaranda, insgesamt 12.000 Teile – stammte aus Brasilien. Aber sogar das wurde in Europa bearbeitet und schließlich von portugiesischen Fachleuten verlegt, die man eigens herübergebracht hatte.
Die Innenwände wurden von Domenico de Angelis, dem berühmtesten italienischen Kirchenmaler, nach dem Vorbild europäischer Kirchen gestaltet. Auf den Deckenfresken sind die vier beteiligten Künste dargestellt, umgeben von Engeln und Putten: rechts von der Bühne der Tanz, links die Musik, hinten die Tragödie und vorne die höchste Kunst, die Oper, in der sich die anderen drei vereinigen. Ein Mosaik aus 36.000 glasierten Kacheln in Blau, Grün und Gold krönt die Kuppel. Das Gewölbe erhebt sich über einer klassizistischen Konstruktion mit geschwungenen Aufgängen und säulengetragenen Vorhallen. Mit seinen überreichen weißen Verzierungen erinnert das ganze Gebäude ein bisschen an eine Hochzeitstorte. Die Fassade ist rosa wie die Delfine der Gewässer, die dieser Stadt ihren unermesslichen Reichtum brachten.
Der Bau des Teatro Amazonas dauerte über 15 Jahre und kostete zwei Millionen Dollar. Bei seiner Eröffnung im Jahr 1896 wurde es als schönstes Opernhaus der Welt gerühmt. Man sagt, es sei eigens errichtet worden, um Enrico Caruso anzulocken. Aber er ist nie gekommen. Während man auf den großen Tenor hoffte, starben 16 Mitglieder der italienischen Operntruppe, die gerade in Manaus auftrat, bei einer Gelbfieberepidemie. Im Durchschnitt fielen jährlich etwa dreihundert Einwohner der Malaria zum Opfer. Auch Todesfälle durch Schlangenbisse waren nicht selten. Auf den Straßen ging es zu wie im Wilden Westen: Es war zwar verboten, mit Pistolen oder mit Pfeil und Bogen zu schießen, aber kaum jemand hielt sich daran.
Trotzdem strömten die Menschen ins Theater, festlich gekleidet, mit Diamanten geschmückt, und füllten die 1.600 Plätze des harfenförmigen Zuschauerraums. Mit der steigenden Autoproduktion wuchs der Bedarf an Reifen. Der milchige Saft des Gummibaums, den man dafür brauchte, wurde aus Tausenden Nebenflüssen nach Manaus geschafft und bescherte der Stadt einen sagenhaften Reichtum. Diamanten wurden eine Art Zweitwährung, mit der die Menschen nur so um sich warfen. Sie blitzten in der schwarzen Spitze der Fächer, manche Damen ließen sich die Zähne damit besetzen. Eine Kellnerin, die einem Gast eine Kleinigkeit servierte, konnte durchaus einmal einen Diamanten als Trinkgeld bekommen und eine erstklassige Kurtisane durfte ein Brillantcollier als Bezahlung erwarten. Die Preise in Manaus waren viermal so hoch wie in New York, und trotzdem tränkten die Kautschukbarone ihre Pferde mit französischem Champagner und ließen sich Armaturen aus purem Gold in die Bäder einbauen. Es gab Damen, die ihre Wäsche in Portugal waschen ließen.
Die Kehrseite der Medaille war, dass diejenigen, die den Kautschuk sammelten und verarbeiteten, die Ureinwohner des Amazonas, versklavt und in Ketten gehalten wurden. Die viertausend Tonnen Gummi, die der Kautschukbaron Julio César Arana in zwölf Jahren verschiffte, brachten ihm in London siebeneinhalb Millionen Dollar ein und kosteten dreißigtausend Menschen der indigenen Bevölkerung das Leben. »Tatsache ist«, schreibt der Historiker Richard Collier in seinem Buch The River That God Forgot, »dass die Kautschukbarone ihre reiche, verruchte Stadt auf den Leichen der Ureinwohner errichteten – und die Exzesse ihrer Lebensweise lassen ahnen, dass ihnen das auch bewusst war.«
So strömten sie in ihr Opernhaus wie Büßer in die Kirche, um unter den Engeln zu sitzen, umgeben von den Namen der größten europäischen Künstler. Auf den 22 Marmorsäulen zwischen den Logen sind Masken der griechischen Tragödie angebracht, und die dazugehörigen Schriftbänder tragen die Namen von Goethe, Rossini, Molière, Shakespeare, Mozart, Wagner, Beethoven, Lessing, Verdi …
Die Masken blicken auf den Amazonas, wie er in den schwärmerischen Vorstellungen der Europäer aussah. Blickfang im Opernhaus ist das Gemälde auf dem Bühnenvorhang, das den Titel Der Zusammenfluss trägt. Es stammt von Crispim do Amaral, einem Brasilianer, der in Paris lebte und Bühnenbildner an der Comédie-Française war. Die hellhäutige, nackte Göttin Amazonas ruht lässig auf einem weichen Lager. Sie lehnt sich zurück, ein Knie gebeugt, als wolle sie die Schenkel öffnen für die zwei bärtigen Flussgötter zu ihren Seiten, den Solimões und den Negro. Die beiden umspielen sie wie Delfine und bringen ihr Blumengirlanden. Ihre Wasser sind so blau wie die Donau im Lied.
Der wirkliche Zusammenfluss ist etwa zehn Kilometer von Manaus entfernt, und die Fluten sind durchaus nicht einheitlich blau, sondern sehr unterschiedlich. Der Solimões (wie der Amazonas in seinem Mittellauf auch genannt wird) ist rahmfarben, der Rio Negro kaffeebraun. Die gegensätzlichen Flüsse vereinigen sich hier, um die restlichen 1.600 Kilometer bis zum Meer unter dem Namen Amazonas zurückzulegen. Das dunkle Wasser des Negro stammt aus dem seit Jahrmillionen ausgelaugten brasilianischen Hochland; es kann organische Chemikalien nicht auflösen und enthält daher Säuren. Für die Färbung sind Tannine verantwortlich. In diesem Wasser gibt es kaum Leben. Das schlammige Wasser des Amazonas dagegen verdankt seine helle Farbe dem nahrhaften Schlick, den seine Quellflüsse in großen Mengen aus den geologisch jungen Anden mitbringen. Es wimmelt darin von Piranhas und Zitteraalen und sonstigem Wassergetier. Die rosa Delfine jagen gern an diesem Zusammenfluss, weil die Fische, verwirrt durch die plötzliche Änderung der Bedingungen, hier leichte Beute sind.
Wegen ihrer verschiedenen physikalischen Dichte vermischen sich die Flüsse nicht sofort, sondern laufen etwa sechs Kilometer lang nebeneinander her wie Liebende, die nicht zusammenkommen können. So geben sie kein schlechtes Symbol ab für das Leben im Amazonasgebiet, für den Zusammenprall verschiedener Historien und gegensätzlicher Wesensarten, für das Nebeneinander von Schönheit und Grausamkeit, Leidenschaft und Verzweiflung, Leben und Tod.
Morgen werde ich an diesem Zusammenfluss übernachten, auf dem Boden einer Hütte, die auf Balken schwimmt und an einem Baum festgebunden ist. Heute aber blicke ich über eine rote Samtbrüstung, auf Augenhöhe mit einem französischen Kronleuchter aus Gold und Kristall, in Gesellschaft von Mozart und Molière, den Musen des Tanzes und der Tragödie, und leider auch von Moskitos, die sich an meinen Knöcheln laben.
Der Bühnenvorhang ist hochgezogen; man sieht nur mehr den unteren Teil des Gemäldes. Die Wasser des Amazonas scheinen sich über den Saum ins Publikum zu ergießen. Das Orchester stimmt sich ein. Die Pauke klingt wie ein Donner.
Donner war es auch, der mich in meiner ersten Nacht in Brasilien weckte. Der Lärm war so stark, dass ich ihn in allen Knochen schmerzhaft spürte. Blitze zuckten grell durchs Zimmer. Der Regen tobte gegen Dach und Mauern wie ein rasender Dämon aus dem Dschungel. Ich brachte es nicht fertig, aufzustehen und aus dem Fenster zu schauen; die Gewalt des Regens lähmte mich förmlich.
Meine Freundin und Fotografin Dianne Taylor-Snow lag im Bett neben mir. Ich sah die Glut ihrer Zigarette in der Dunkelheit und hörte, wie sie sagte: »Wir sind hier nicht in Kansas, Sy.«
Dianne war wie immer schon seit Stunden wach. Dass sie mit extrem wenig Schlaf auskommt, ist nur eins ihrer vielen Talente. Sie kann vom Heck eines Bootes aus ins Wasser pinkeln und auf Indonesisch fluchen.
Vor fünf Jahren hatten wir gemeinsam in Bangladesch unsere ersten rosa Delfine gesehen. Wir waren per Boot in den schlammigen Gewässern von Sundarbans unterwegs, um nach Tigern Ausschau zu halten. In diesem größten Mangrovensumpf der Welt gibt es eine Menge Tiger, doch wir bekamen keinen zu Gesicht.
Eines Tages öffnete sich das braune, undurchsichtige Wasser für einen Augenblick und drei graurosa Wesen tauchten auf, glitzerten in der Sonne und verschwanden wieder. Verwundert starrten wir ihnen nach; sie erschienen noch einmal, seidig glänzend, und glitten dann endgültig zurück in die Tiefe. Erst dann wurde mir klar, was wir da gesehen hatten: Delfine!
Immer, wenn ich Delfine sehe, spüre ich ein Gefühl der Zusammengehörigkeit – als sähe ich mein eigenes Spiegelbild im Wasser. Ich habe schon in vielen Meeren und in manchem Aquarium Delfine gesehen, aber ihr Anblick überrascht mich jedes Mal aufs Neue. Äußerlich sind sie Fischen ähnlicher als Säugetieren, sie leben in einer Welt, die uns Landbewohnern gänzlich fremd ist. Und dennoch scheint es eine geheimnisvolle Verwandtschaft zwischen ihnen und uns zu geben. Der Verhaltensforscher John Lilly, der sich auch mit der Kommunikation zwischen Menschen und Delfinen befasst hatte, nennt sie »Meeresmenschen«.
Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass Delfine in so trübem Wasser wie in Sundarbans leben könnten. Aber dann erinnerte ich mich, dass sie zwar sehen können, sich aber hauptsächlich mithilfe eines außerordentlich feinen Sonarsystems zurechtfinden.
Sekunden nur, und sie waren wieder verschwunden. Ihr Bild blieb mir jedoch lange in Erinnerung; für mich kam es einer Verheißung gleich.
Ich reiste noch drei weitere Male nach Sundarbans. Und obwohl ich dabei jedes Mal Delfine sah, überraschten sie mich stets so sehr, dass ich nur flüchtige Blicke auf einen Hinterkopf oder eine Rückenflosse erhaschen konnte. In der Fachliteratur fand ich kaum etwas über Süßwasserdelfine. Es gibt weltweit fünf Arten davon, über keine von ihnen weiß man wirklich viel.
Die Flussdelfine ließen mich nicht mehr los. Zu Hause in New Hampshire schwammen sie verführerisch durch meine Träume. Jahre später, bei einer Tagung über Meeressäuger, traf ich einen Mann, der mir den Grund dafür nannte. Er sagte, rosa Delfine würden die Seele gefangen nehmen.
Er erzählte mir außerdem, dass im Amazonasgebiet eine andere Art rosa Delfin vorkommt, die den Namen Inia geoffrensis trägt (Inia ist die Bezeichnung der Guarayos für »Delfin«). Benannt ist sie nach Étienne Geoffroy Saint- Hilaire, der den Portugiesen ein paar Exemplare stahl und sie Napoleon mitbrachte. Diese Delfine sind lebhafter und auch zahlreicher als die von Sundarbans, aber genauso rätselhaft.
Auf dieser Tagung waren ein paar Forscherinnen und Forscher anwesend, die sich mit den Delfinen befassten, doch ihre Ergebnisse waren mager. Meist wussten sie nicht einmal, wie viele Delfine sich in ihrem Untersuchungsgebiet aufhielten, welche sozialen Strukturen es in den Gruppen gab und ob sie sich immer in derselben Gegend aufhielten oder wanderten. Genauso wenig wussten sie, warum die Delfine rosa sind. Die meisten Fachleute gaben sogar zu, dass sie auch nach langjähriger Forschung die einzelnen Tiere nicht auseinanderhalten konnten.
Für die Leute, die am Fluss leben, ist dies keine Überraschung. Sie behaupten, dass die rosa Delfine ihre Gestalt verändern können. Sie würden sich einzelner Seelen bemächtigen und die Menschen in ihre verzauberte Welt am Grund des Flusses mitnehmen.
Die rosa Flussdelfine leben tatsächlich in einer Zauberwelt: dem Amazonasgebiet. Ich hatte mir schon immer gewünscht, eines Tages dort hinzureisen. Wie viele Mythen, wie viele magische Worte verbanden sich mit dieser Welt: El Dorado, das Goldland, ein weißer Fleck auf der Landkarte, ein legendäres Volk mutiger Kriegerinnen, ein unberührtes Paradies. Auch heute übt der Amazonas eine magische Anziehungskraft aus; er ist das Ziel vieler Sehnsüchte.
Ich erkannte auf jener Tagung, was mein nächstes Ziel sein würde: Ich würde den Delfinen folgen. Dianne war begeistert und schloss sich mir an.
Und so hat es uns beide in diese unwirkliche Stadt verschlagen, dieses Paris im Dschungel, wo das Wasser nicht nur im Fluss strömt, sondern auch Himmel und Erde überschwemmt. Am Zusammenfluss von Rio Negro und Solimões, so hatte man uns gesagt, würden wir Delfine finden. Und wir hatten keine Ahnung, wohin sie uns führen würden.
Nach diesem ersten Unwetter in Brasilien wussten wir jedoch eines mit Sicherheit: Wo auch immer uns die Reise hinführen würde, es würde dort nass sein.
Dianne hatte wie üblich ihre Ausrüstung im ganzen Zimmer verstreut. Es sah aus wie ein Warenlager: hier ein kleiner Föhn mit Adapter; dort eine Hängematte, die zusammengerollt nicht größer war als eine Grapefruit; ein aufblasbares Reisekissen (aus Diannes Zeit als Stewardess); vier Toilettentaschen mit Lippenstiften und Wimpernzange, Augenbrauenstift und ähnlichem Kram aus ihrer Zeit als Model; Babyflaschen und Milchpulver für den Fall, dass wir verwaiste Tierbabys fanden (das stammte aus der Zeit, als sie in einer Auswilderungsstation für Orang-Utans arbeitete); luftdicht verschweißte Päckchen mit Rosinen, Erdnüssen und Gatorade-Pulver; Pillen gegen Würmer in den inneren Organen; ein beheizbarer Lockenstab; eine chirurgische Ausrüstung mit Skalpellen und Einwegspritzen; ein Wasserfilter (für vierhundert Dollar!), der Viren aussortiert; Taschenmesser und Feuerzeuge als Geschenke für die Dorfbewohner; ein Gerät, mit dem man Schlangenbisse aussaugen konnte – und Opernkleidung.
Ich wickelte mich in meinen feuchten Poncho und schlief wieder ein. Der Regen folgte mir bis in meine Träume.
Am Morgen war das Unwetter in einen normalen Regen übergegangen, dessen Tröpfeln, Spritzen und Platschen sich mit den Autohupen und den Trillerpfeifen der Polizisten mischte. Auf den nassen Straßen von Manaus glitten die Autos dahin wie Kanus. Es hatte durchs Hoteldach geregnet und man versuchte, die Pfützen in der Halle mit alten Badematten aufzuwischen. Der Pool auf dem Dach war übergelaufen.
Wir saßen im Restaurant des Hotels Monaco im zwölften Stock und schauten hinunter auf die glänzende Kuppel des Teatro Amazonas, auf das viktorianische Zollgebäude und diese genialen Schwimmdocks – von britischen Ingenieuren gebaut –, die bis zu zehn Meter steigen können, wenn der Rio Negro anschwillt.
Der Plan, ein »Paris der Tropen« zu schaffen, stammte von Eduardo Gonçalves Ribeiro, einem Ingenieur, der schon mit dreißig Jahren Gouverneur des ungeheuren Staates Amazônia wurde. »Ich kam in ein Dorf«, so rühmte er sich später, »und habe eine moderne Stadt daraus gemacht.« So klein seine Statur auch gewesen sein mag, so groß war seine Begierde: nach Gold, Frauen und Ruhm. Noch vor der Amtsübernahme entwarf er schon Pläne für das Projekt, das ihm besonders am Herzen lag: das Opernhaus. Es trägt seinen Namen in mannshohen Lettern auf seiner rosa Fassade.
Er erhob eine zwanzigprozentige Steuer auf allen Kautschuk, der die Stadt verließ, legte dreißig Meter breite Straßen an, ließ sie mit Kopfsteinen aus Portugal pflastern und mit Bäumen aus Australien und China säumen. Er verpflichtete keinen Geringeren als Gustave Eiffel für den Entwurf einer Markthalle, die wie die Pariser Hallen aussehen sollte, und eines Justizpalasts, der dem Schloss von Versailles gleicht. Manaus bekam den elektrischen Strom früher als London und ein Telefonsystem früher als Rio de Janeiro. Während New York und Boston sich noch mit der Pferdebahn begnügten, genoss man in Manaus den Luxus einer elektrischen Straßenbahn, die rund um die Uhr verkehrte. Wie wir so von der Höhe des Dachrestaurants auf die Stadt hinunterschauten, bevölkerten wir sie in der Fantasie mit eleganten Damen in Seidenkleidern und extravaganten Hüten.
Als wir schließlich hinabstiegen, fanden wir stattdessen jedoch Frauen in engen Polyesterkleidern, mit grellbunten, billigen Plastikspangen im Haar. Was wir zunächst für die Aufmachung von Prostituierten hielten, stellte sich sehr bald als normale Alltagskleidung heraus. Ganz gleich ob in der Bank, in der wir Geld wechselten, im supermercado, im Bus zum Amazonas-Forschungsinstitut – die vorherrschenden Kleidungsstücke waren überall bikiniartige Oberteile und knallenge Stretch-Höschen. Auch rundliche alte Frauen und Hochschwangere tragen enge, kurze Kleider. Ihre Brüste schwanken in den bunten Büstenhaltern wie in Hängematten. Jeans sind so eng, dass sie an den Nähten platzen, und häufig steht auch der Hosenknopf offen, weil die Fülle nicht mehr zu bändigen ist.
Im Fischmarkt quellen die ungeheuren nackten Bäuche der Männer über den Hosenbund wie Schaum über den Rand des Bierkrugs. Manaus schwelgt in seiner Üppigkeit: Brüste, Bäuche, Hinterteile. Alle, ganz gleich wie dick oder alt, stellen mit Stolz aus, was sie haben, und stoßen damit auf allgemeinen Beifall. Ähnlich groß ist die Freude an der Musik. In allen Läden, Bussen und Restaurants dröhnen Rockmusik, Samba und Boi-Bumbá. Der Lärm quillt auf die Straßen hinaus und verteilt sich nach allen Seiten wie das Wasser eines Springbrunnens. Auch an Abfall herrscht Überfluss; was man nicht mehr braucht, wirft man mit großzügiger Geste weg.
Es ist, als habe die Regenzeit die Fruchtbarkeit des Landes entfesselt. Selbst die Bäume am Straßenrand hängen voller Früchte – Guajaven, Mangos, Avocados – und lassen sie freigebig auf die Gehsteige fallen. In den Straßen riecht es nach überreifen Früchten, nach Fett und nach dem Fleisch, das an jeder Ecke an Spießen über Holzkohlenfeuern gebraten wird. Ein kleines Mädchen brät Hühnerfüße. Sie ist anrührend schön mit ihrem dichten Haar, ihren hohen Wangenknochen und grünen Augen. Sie schenkt uns ein strahlendes Lächeln.
Wir befinden uns mitten in einem Land, das menschliches Elend im Übermaß hervorbringt. Alle sechs Sekunden stirbt ein brasilianisches Baby an Durchfall, jede halbe Stunde erkrankt ein Brasilianer an Lepra und ein zweiter an Tuberkulose. Jedes Jahr gibt es eine Million Fälle von Malaria und zehn Millionen von Bilharziose. Und doch fühlt man sich in Manaus angesteckt vom sinnlichen Lebensgenuss, von der genießerischen Hingabe ans Essen, an die Kunst und an Sex.
In Manaus gibt es zwei Tempel, in denen die Lebensfreude der Bevölkerung gefeiert wird: das Opernhaus und den Fischmarkt.
In der städtischen Markthalle mit ihren eisernen Streben und dem farbigen Glas heben Männer mit goldenen Halsketten stolz ihre Fische hoch, wenn wir fotografieren wollen. Junge Männer mit schweißnasser Brust und angespannten Muskeln schleppen riesige Säcke von den Docks herein. Wir befinden uns auf dem weltgrößten Markt für Süßwasserfische – über zweihundert verschiedene Arten werden in Manaus angelandet – und es gibt die eigentümlichsten Fische zu kaufen. Die silbrigen Scheiben vom Pirarucu sind so groß, dass sie über die Theke hängen. Die rotäugigen Tucunarés haben auch am Schwanz leuchtende Augen, wie die auf Pfauenfedern. Der fette schwarze Tambaqui liegt neben Pyramiden von Piranhas und großen Mengen räuberischer Welse, die mit ihren langen Schnurrbärten aussehen wie chinesische Kaiser und zum Teil giftige Dornen haben.
Aber auch hier sind die Gewässer überfischt, und manche Fische, die früher in den Gefängnisküchen Verwendung fanden, sind heutzutage zu teuer für die Normalverbraucher.
Auf dem Markt aber hat man nicht den Eindruck, dass die Bestände geringer werden oder gar Mangel droht. Die verschwenderische Fülle, die Fremdartigkeit und Schönheit der Fische wirken geradezu berauschend. Die Fischer drapieren ihren Fang mit viel Liebe auf den weiß gekachelten Tischen und begießen ihn immer wieder mit Wasser, das dann in glitzernden Wasserfällen auf den Boden platscht.
An den Ständen der Metzger hängen Schweine, Rinder und Lämmer an Haken, noch komplett mit Hufen und Köpfen. Die Hände der Männer sind glitschig vom Blut. Auf den Obst- und Gemüseständen türmen sich die Produkte des fruchtbaren Landes: riesige, weich duftende Avocados, gelbe Melonen, bunte Kürbisse, glänzende Limetten und unbekannte Früchte mit verlockenden Namen wie Jenipapo, Acerola oder Pitomba. Die lächelnden Verkäufer schwätzen über diese Berge hinweg miteinander.
Der ganze Markt ist eine einzige Kultstätte prallen, sinnlichen Lebens.
Die Lichter im Zuschauerraum gehen aus. Unter Beifallsstürmen öffnet sich der rote Samtvorhang. Zum ersten Mal seit fast hundert Jahren wird im Teatro Amazonas wieder eine Oper aufgeführt: Die Staatsoper Minsk und ihr Ballett gastieren mit Verdis La traviata zu einer verspäteten Jahrhundertfeier des Hauses. Es ist unser letzter Abend in Manaus.
Auf der Bühne ist das Fest im Haus der Kurtisane Violetta
Valéry in vollem Gang. Damen in Rüschen, Spitzen, Samt und Seide, mit kostbaren Fächern und funkelnden Juwelen, Herren im Frack, Champagner in Strömen – die Szene hat eine gespenstische Ähnlichkeit mit dem gesellschaftlichen Leben der letzten Zuschauer, die vor neunzig Jahren diesen Raum füllten. Dann brach der Kautschukboom in Manaus ganz plötzlich zusammen. Samen des Gummibaums waren aus dem Land geschmuggelt worden und Kautschuk aus asiatischen Plantagen kam billig auf den Markt.
In Manaus brach Panik aus. Alle wollten möglichst schnell weg. Für einen Platz auf den Dampfern nach Europa und den USA zahlte man bereitwillig eine Handvoll Diamanten. Im Jahr 1912 wurden 140 der elegantesten Herrenhäuser von Manaus versteigert. In der Eile konnten sich viele nicht mehr von ihren Freunden verabschieden und veröffentlichten ihre Grüße in den Familienanzeigen des Jornal do Commercio. Das Kaufhaus Paris in America halbierte die Preise für Parfüms, Tigerfelle und Konzertflügel. Beamte warteten ihr Gehalt nicht mehr ab. Studierende rebellierten, die Hochschulen schlossen. Im Opernhaus gingen die Lichter aus. Das goldene Zeitalter von Manaus war zu Ende.
Aber die Geister aus jener Zeit gehen noch um. Wer hier reich werden wollte, riskierte viel. Ein Moskitostich oder ein Schluck Wasser konnte den Tod bedeuten. Bei allem Luxus: Sicherheit war nicht zu kaufen. Man konnte die Wäsche zum Waschen nach Portugal schicken, aber man konnte nicht verhindern, dass die Kinder am Fieber starben.
Auf der Bühne hat nun auch Violetta erkannt, dass Reichtum nicht alles ist. Aus Liebe zu Alfredo Germont will sie ihr luxuriöses Leben aufgeben, das ihr nun leer erscheint. Als das hinreichend klar ist, schließt sich der rote Vorhang.
Ich frage Dianne, wie es ihr bisher gefallen habe. Es ist ihre allererste Oper. »Ich hätte nicht gedacht, dass Oper so laut ist«, sagt sie und geht hinaus, um eine Zigarette zu rauchen.
Es gibt auch noch andere Geister, die in der Oper hausen. In den finsteren Winkeln des Gebäudes hausen die Geister der indigenen Völker, deren Ausbeutung den ganzen Reichtum erst möglich machte. Die Aufseher der Kautschukbarone mussten für den kontinuierlichen Nachschub an Kautschuk sorgen; bei den Methoden hatten sie freie Hand. Ein Händler am Fluss Madre de Dios hielt sechshundert indigene Mädchen wie Zuchtvieh. Sie sollten für künftige Arbeitskräfte sorgen. Manchmal machte sich einer den Spaß, die Gefangenen zu fesseln und ihnen die Genitalien wegzuschießen. Ein Aufseher in Peru ließ, als die Quote einmal nicht erfüllt wurde, zur Strafe die Kinder der Ureinwohner schlachten und an die Wachhunde verfüttern. Ein anderer erschoss zur Feier des Osterfestes höchstpersönlich 150 Chontaduras, Ocainas und Utiguenes. Alle, die nicht sofort tot waren, wurden auf einen Haufen gelegt, mit Benzin übergossen und lebendig verbrannt.
Man spürt förmlich die vielen unerlösten Seelen in der Atmosphäre des Hauses, auch die der italienischen Musiker und Sängerinnen, die bei Malaria- und Gelbfieberepidemien ums Leben kamen. Und schließlich geistert auch der Gouverneur Ribeiro durchs Haus. Man sagt, er sei sexbesessen und masochistisch gewesen und habe sich in sexueller Raserei selbst erwürgt, drei Monate bevor sein geliebtes Opernhaus eröffnet wurde.
Neunzig Jahre lang haben sie alle keine Oper mehr gehört.
Die Geschichte der traviata nimmt inzwischen ihren Fortgang: Liebesglück in Alfreds Haus, Geldsorgen und die Bemühungen des Vaters Germont, das Verhältnis zu beenden, und schließlich Violettas Verzicht und Flucht nach Paris. Und so weiter bis zum bitteren Ende. Ganz am Schluss herrschen neben der Trauer immerhin auch Verzeihung und Erlösung.
Die Schönheit der Musik wirkt wie ein Sühneopfer. Die Gier der Europäer hat Leid, Krankheit und Tod über die Ureinwohner des Dschungels gebracht. Dieses absurde rosa Gebäude im Urwald sollte wohl auch eine Art Rechtfertigung Europas darstellen. Aber gegen so viel Schuld ist Schönheit machtlos. So leicht sind die Geister nicht zu vertreiben.
Der Applaus verhallt. Der Urwald ruft.