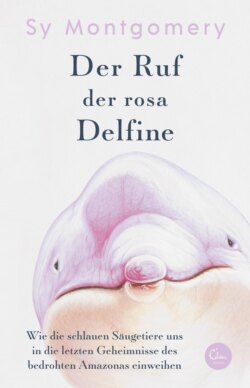Читать книгу Der Ruf der rosa Delfine - Сай Монтгомери - Страница 11
Die Verführungskünste der Botos
ОглавлениеWie Vera vorausgesagt hatte, waren die Morgen- und Abendstunden die Zeit, in der man die Botos am ehesten sehen konnte. Es kam uns vor, als reagierten sie auf die Färbung des Himmels. Es schien, als würden sie aus dem Wasser auftauchen, um den Widerschein der Morgenröte oder des Sonnenuntergangs auf den Wolken zu begrüßen.
Wir lagen immer auf der Lauer. Meist hörte man ein Schnaufen oder Spritzen, und wenn man sich schnell umdrehte, sah man ein Stück eines rosafarbigen Rückens das Wasser pflügen. Doch schon nach einer Sekunde konnte es wieder verschwunden sein. Dann starrten wir gebannt auf das Kielwasser und versäumten darüber beinahe die nächste Erscheinung, die vielleicht dreißig Meter entfernt stattfand, oder direkt neben dem Boot – aber immer in der entgegengesetzten Richtung, wie uns schien. Das Einzige, was wir sicher wussten, war der Unterschied zwischen Boto und Tucuxi: Wenn man erkennen konnte, was es war, dann war es kein Boto.
Einen Boto zu sehen, ist etwas ganz anderes, als im Aquarium Meeresdelfine zu beobachten. Die springen nicht nur willig durch die Luft, um den Zuschauern eine Freude zu machen, sondern stehen auch manchmal senkrecht im Becken wie ein Wasser tretender Mensch, sodass der Kopf und die obere Körperhälfte gut sichtbar sind. Die flüchtigen Blicke, die wir von den Botos erhaschen konnten, hatten auch nichts mit den Filmen und Fotografien zu tun, die wir vorher gesehen hatten, denn diese zeigten die Tiere als Ganzes oder zumindest einen großen Teil des Körpers. Oft waren sie zum Fotografieren mit Netzen aus dem Wasser geholt worden; auf einem Bild, das wir in Veras Büro gefunden hatten, lag der Boto sogar auf einer Matratze (die den Matratzen in unserem schwimmenden Haus auffallend ähnlich sah). Zum Filmen hatte man die Botos immer in klare, seichte Gewässer gebracht. Wir aber sahen von ihnen nur Fragmente.
Einmal winkte uns ein rosa Schwanz zu, ein anderes Mal hob ein Boto den Kopf aus dem Wasser, um sich umzusehen. Aber normalerweise bekamen wir nur den Oberkopf oder die Kurve des Rückenkamms zu Gesicht – nur eine Ahnung von Gestalt und Farbe, kein vollständiges Tier.
Wir schauten mit höchster Aufmerksamkeit nach Zeichen aus, anhand deren wir die einzelnen Exemplare hätten identifizieren können. Das ist ein wichtiger erster Schritt, wenn man Tiere studiert. Dian Fossey, die sich mit Berggorillas beschäftigte, fand heraus, dass alle Gorillas verschiedene Nasen hatten. Cynthia Moss entdeckte bei ihren südafrikanischen Elefanten unterschiedliche Einkerbungen in den Ohren. Tiger haben ganz individuelle Streifenmuster und, wie indische Forscher glauben, unverwechselbare Fußspuren. Vera hatte nach Narben oder Einkerbungen in den Rückenfinnen ihrer Delfine Ausschau gehalten. Zur Paarungszeit fechten die Männchen heftige Kämpfe aus; es wäre also kein Wunder, wenn sie Narben davontrügen, hatte Vera erklärt. Entsprechend begeistert waren wir am zweiten Abend, als wir bei einem Boto eine auffallend flache Rückenfinne entdeckten und bei einem anderen eine v-förmige Kerbe. Es kommt nicht jedes Mal vor, dass die Botos ihren Rücken zeigen, wenn sie Luft holen. Vor allem zeigten sie sich nie im selben Winkel. Wir sahen die beiden nie wieder – und falls doch, haben wir sie nicht erkannt.
Auch die Größe eines Botos war kaum festzustellen, weil sie nicht aus dem Wasser schnellen, sondern langsam nach oben kommen und gleich wieder verschwinden. Einmal stellten wir fest, dass wir ein Jungtier vor uns hatten, der Kopf war kleiner als üblich. Wir schätzten es auf ein Jahr, weil Botos normalerweise von Mai bis Juli geboren werden, wenn das Wasser am höchsten steht oder bereits zu fallen beginnt.
Das Einzige, was wir jedes Mal deutlich sahen, war die Farbe; die Skala reichte von Dunkelgrau bis Flamingorot, und die meisten Tiere schienen gefleckt. Aber da können wir uns auch getäuscht haben, weil wir oft direkt in die Sonne schauen mussten und die Beleuchtung zu oft wechselte. Tatsache ist, dass die Delfine die Farbe wechseln, aber niemand weiß, weshalb. Vielleicht spielt körperliche Anstrengung eine Rolle, vielleicht auch das Alter oder die Temperatur und Beschaffenheit des Wassers. »Unser Problem ist«, sagte Dianne, »dass wir es nicht mit Delfinen, sondern mit Chamäleons zu tun haben.«
Kein Wunder, dass man so wenig über sie weiß. Nach sieben Jahren, in denen Vera und ihr Mann Tausende Kilometer im Boot zurückgelegt und mit Kollegen in Kolumbien, Peru, Bolivien und Ecuador Daten ausgetauscht haben, veröffentlichten sie gemeinsam die Ergebnisse ihrer Arbeit. Es war die erste größere Studie über die Botos; sie zeigt, dass ihr Verbreitungsgebiet ungeheuer groß ist. Ihre Art findet sich in den meisten größeren Zuflüssen sowohl des Amazonas als auch des Orinoko. Und sobald die Regenzeit das Land überflutet hat, schwärmen sie aus und bevölkern auch die Wälder.
Das Forscherehepaar beschäftigte sich auch mit toten Botos. Sie maßen und sezierten die Kadaver, maßen die Organe und zählten die Parasiten. Vera war besonders an ihrem Mageninhalt interessiert. Botos können praktisch alles fressen; mit ihren großen, kegelförmigen Zähnen und den starken Kiefern knacken sie selbst die Panzer von Schildkröten. Vera hatte steinharte Panzerwelse mit Stacheln in Boto-Mägen gefunden.
So wichtig diese Entdeckungen auch waren, so blieb dennoch eine Menge Fragen offen. »Über die Physiologie von Inia ist praktisch nichts bekannt«, schreibt Vera, »die Größe des Gesamtbestandes ist unbekannt … wohin sie sich in der trockenen Jahreszeit wenden, weiß niemand … in den Ländern, in denen sie leben, hat man noch kaum über sie geforscht … es gibt zu wenig Datenmaterial, um Trends in den Populationen auszumachen …« Es bleibt ein Rätsel, wann die Paarungszeit ist, sofern es überhaupt eine gibt. Niemand weiß etwas über die sozialen Strukturen in den Gruppen, falls überhaupt vorhanden.
Eines Nachmittags, als Nildon unser Boot in der Krone eines Careru-Baums festgemacht hatte, kamen drei Botos heran. Zwei davon schwammen nahe nebeneinander, ein dritter war vermutlich aus einer anderen Richtung gekommen. Botos lassen sich meist nur einzeln blicken; bei Paaren handelt es sich häufig um eine Mutter und ihr Junges. Die Bindung zwischen ihnen ist sehr eng; Vera fand heraus, dass sie mindestens zweieinhalb Jahre beisammen bleiben. Wir hatten auf Fotos gesehen, wie sie zusammen schwimmen: oft übereinander, wobei sich die langen Schnauzen berühren und eine Flosse über den Körper des anderen streicht.
Viermal kamen die zwei Botos im Umkreis von 15 Metern um unser Boot an die Oberfläche und mir schien, dass sie dabei Körperkontakt hatten. Es handelt sich um sehr sinnliche Tiere. Ein Beobachter im Duisburger Zoo, in dem es seit 1975 zwei Botos gibt, berichtete, dass die Delfine manchmal einen ganzen Vorhang von Wasserblasen erzeugen, durch den sie dann schwimmen. Einmal zog der Delfinvater eine Scheuerbürste samt Stiel schnell im Maul nach unten, wobei vom Stiel ein breiter Vorhang von prickelnden und glitzernden Blasen aufstieg. Das Delfinbaby rollte und wälzte sich in den Blasen »offensichtlich mit dem größten Vergnügen«, wie der Zoologe Wolfgang Gewalt schreibt. »Die Luftblasen scheinen als eine Art sanfter Massage zu wirken, ähnlich wie ein Whirlpool.«
In Gefangenschaft sind die Botos beim Liebesspiel sehr erfinderisch. Beim Vorspiel knabbert das Männchen sacht an Schwanz und Flossen des Weibchens; beim Geschlechtsverkehr kennen sie mindestens drei Stellungen: Kopf an Kopf; Kopf an Schwanz; im rechten Winkel über Kreuz. Einmal wurde gezählt, dass ein Paar sich in dreieinhalb Stunden 47-mal so vergnügte. Beide Geschlechter masturbieren, das Männchen, indem es seinen Penis an Gegenständen reibt, das Weibchen, indem es Gegenstände in die Vagina einführt oder sich dagegen presst. Die Männchen benützen den empfindsamen Penis manchmal als Werkzeug zur Erkundung und führen ihn sogar ins Nasenloch anderer Delfine ein. Ihr Einfallsreichtum, wenn es um sexuelles Vergnügen geht, schreibt Gewalt, sei »größer als alles, was man bisher von anderen Walen kennt, sei es in Freiheit oder im Zoo«.
Und dann sahen wir, wie sich der junge Delfin langsam im Wasser rollte. Er drehte sich gemächlich auf den Rücken und zeigte seinen runden rosa Bauch und die ausgebreiteten, paddelartigen Flossen. Einen Augenblick lag er so da, wie um die Sonnenwärme auf der Haut zu genießen und dann die angenehme Kühle zu spüren, mit der das Wasser ihn wieder aufnahm.
Wie gerne wäre ich bei ihnen im Wasser gewesen! Auch Vera hatte von diesem Verlangen gesprochen. »Aber die Piranhas sind überall, das darf man nie vergessen, auch wenn das Wasser noch so verlockend ausschaut.« Freunde von ihr sind beim Schwimmen schwer verletzt worden. Sie hat auch Botos mit bogenförmigen Narben in der Haut gesehen. »Wenn wir Botos fangen, um sie zu markieren, dann kreisen wir sie mit einem Netz ein«, erzählte sie. »Einmal haben wir so ein Netz eingeholt – ein prächtiges, brandneues Netz – und es war bloß noch ein Lumpen! Die Piranhas hatten es mit ihren rasiermesserscharfen Zähnen zerfetzt.«
Im Wasser müsse man mit allem rechnen, hatte sie uns gewarnt. »Wenn man eine Berührung fühlt, weiß man nicht, ob es ein Stück Holz ist oder ein Blatt, ein Piranha, eine Schlange, ein Zitterrochen oder vielleicht sogar ein Hai. Wir haben im Solimões vier Haie gefangen, zweieinhalb Meter lang. Haie aus dem Meer! Sie schwimmen den Amazonas hinauf bis nach Iquitos in Peru. Also spiele ich lieber nicht mit den Delfinen.«
Das Wasser war uns so nah und blieb uns doch verschlossen. Seine Oberfläche gab dem Blick nichts preis von den Geheimnissen der Unterwasserwelt. Ich konnte gut verstehen, wie sich die Legende von der verzauberten Stadt Encante gebildet hatte, in der sich der Schauder vor den unsichtbaren Gefahren mit der Sehnsucht mischte, in dieses für die Augen undurchdringliche Element einzudringen. Die Delfine sind die Herrscher in diesem Zauberreich, in dem es keinen Schmerz und keine Not gibt, sondern nur Freude, Musik und Tanz.
Manchmal hörten wir seltsame Töne unter uns. Der Boden unseres Bootes wirkte wie ein Stethoskop, das Geräusche aus der Tiefe übermittelte. Früh am Morgen vernahmen wir einmal ein hohes Winseln. Was konnte das sein?
»Pescada«, sagte Nildon. Fisch.
Dann schoss ein Delfin neben uns aus dem Wasser. »Muito rápido!«, rief Nildon. »O boto fazer compras.« Der Boto kauft ein.
Eine Stunde lang konnten wir die Delfine an diesem Morgen beobachten, dann verschwanden sie ganz plötzlich. Eisvögel flogen pfeilschnell durch die Luft. In einem Baumwipfel schrie ein giftgrüner Papagei. Früchte platschten ins braune Wasser. Aber die Delfine kamen nicht wieder.
Die Hitze wurde drückend und wir beschlossen, zehn Kilometer den Solimões hinauf ins Überschwemmungsgebiet von Marchantaria zu fahren. In diesen riesigen See, so hatte Vera uns erklärt, kommen um diese Jahreszeit viele Fische, um die Früchte zu fressen, die von den Bäumen des überfluteten Waldes fallen.
Unsere Tage und Nächte auf dem Fluss waren interpunktiert vom Aufklatschen dieser Früchte auf dem Wasser. In der Regenzeit ist genug da für alle: für Affen und Papageien, Fledermäuse und Bambusratten, für die schönen Hirsche und den eigenartigen Ameisenbär, der wie eine Kreuzung aus Elefant, Rhinozeros und Schwein aussieht. Aber die Früchte sind hier nicht nur für Vögel und Säugetiere bestimmt, damit sie sie fressen und die Samen verteilen. Hier produzieren die Bäume auch Nahrung für die Fische und die wiederum sorgen dafür, dass die Samen fortgetragen werden.
Nirgendwo sonst auf der Erde spielen Früchte und Samen eine wesentliche Rolle bei der Ernährung der Fische. Im Amazonasgebiet wandern jedoch jedes Jahr mehr als zweihundert Arten von Fischen in den überfluteten Wald, um sich dort vollzufressen und zu laichen. Davon profitieren beide Seiten.
Die Bäume haben Methoden entwickelt, ihre Früchte für die Fische attraktiv zu machen. Viele, zum Beispiel der Lorbeer und der Zimtbaum, produzieren duftende Milchsäfte, Öle, Harze und Säuren. Vom Geruch angezogen, warten die Fische unter solchen Bäumen. Die Tambaquis haben Mahlzähne wie Pferde und ungeheuer starke Kiefer, um die Samen des Seringueira-Baums knacken zu können. Andere, wie die schwarzen Panzerwelse, verschlingen steinharte Samen im Ganzen und verdauen das essbare Äußere. Die Kerne werden irgendwo ausgeschieden, wo sie nach dem Rückgang der Flut keimen können, ohne die Konkurrenz des väterlichen Baumes fürchten oder gegen seinen Schatten ankämpfen zu müssen.
»Man ist versucht anzunehmen, dass Fische und Bäume sich in einer Wechselbeziehung entwickelt haben«, schreibt Michael Goulding, einer der führenden Kenner der Fischwelt im Amazonas. Die enge Beziehung zwischen Fischen und Bäumen ist den Menschen, die seit jeher an den Ufern der Flüsse leben, nicht verborgen geblieben. Ein verbreiteter Mythos der Amazonasbewohner erzählt von einem Weltenbaum, der voller Wasser ist und den Amazonas und seine Fische hervorgebracht hat.
Einer Shipibo-Sage zufolge entstand die Welt so: Als die Sonne das erste Mal aufging, traf sie die Äste des Weltenbaums. Seine üppigen Früchte fielen ins Wasser wie Regen. Fische tauchten auf, um sie zu fressen. Als sie die Früchte anbissen, kamen alle Vögel der Welt heraus und verbanden das Wasser mit dem Himmel.
Thales von Milet, den Aristoteles als den Begründer der Naturwissenschaften bezeichnete, war der Meinung, alle Materie bestünde letztlich aus Wasser. Das glaubt man hier gerne. Trotz Veras Warnung streckte ich die Hand ins Wasser: Es fühlte sich dick und lebendig an, als wäre es nicht nur ein Lebensraum, sondern das Leben selbst.
Reisende waren stets überwältigt von den Dimensionen des Amazonas, seiner Länge, seinen Wassermassen, der unendlichen Ausdehnung seines Urwalds. Was mich faszinierte, war die Ganzheit seines Universums, das sich ständig erneuerte, und die Unergründlichkeit seiner keinem Auge zugänglichen Tiefe, und vor allem waren es die Botos mit ihrer mythischen Fremdartigkeit, die Herren dieser unbekannten Unterwelt.
Nach einer Dreiviertelstunde erreichten wir eine überflutete Wiese, auf der eine weitere INPA-Forschungsstation verankert war. Wir unterhielten uns kurz mit ein paar deutschen Forschern, die dort gastweise arbeiteten. Sie hatten am selben Morgen zwei Botos gesehen und rechneten damit, dass bald noch mehr kommen würden, weil die Regenfälle anhielten und der Wasserstand innerhalb einer Woche noch einmal um einen Meter steigen würde.
Wir fuhren langsam weiter, die Hitze stieg, Schweiß lief uns in die angestrengt spähenden Augen. Wie jede Nacht hatten uns auch diesmal Ungewitter und Regengüsse mehrmals aus dem Schlaf gerissen. Mitten in der Nacht hatten wir die Fensterläden festmachen müssen und dabei festgestellt, dass Ameisen auf uns herumkrabbelten. Dianne verfluchte sie in mehreren Sprachen. Jetzt waren wir unausgeschlafen, verschwitzt, erschöpft und genervt. Und kein Boto weit und breit.
Nildon steuerte das Boot zu einer Insel, auf der fünf Fachleute für elektrische Fische vom INPA bei der Arbeit waren. Zwei von ihnen sprachen glücklicherweise Englisch – José Gomes, ein stämmiger junger Mann mit einem Panamahut, und der drahtige Paulo Petry. Sie beugten sich über ein großes Netz, aus dem sie, von blitzenden Libellen umschwirrt, große Mengen Wasserhyazinthen holten. Von Zeit zu Zeit stach José mit einem langen Bambusstab, an dem ein Spannungsmesser befestigt war, in die Pflanzen. Es knisterte, wenn er die Elektrizität von Fischen registrierte.
»Jede Art hat ihr eigenes Signal«, erklärte José. Elektrische Organe senden die Signale aus und elektrische Rezeptoren empfangen sie. Der einzelne Fisch kann die Form seines elektrischen Feldes ändern, ebenso Wellenform und Frequenz der Entladung sowie den zeitlichen Abstand zwischen den Signalen. Auf diese Weise kann er verschiedene Informationen übermitteln.
Versuche in Gefangenschaft zeigen, dass ein Fisch den anderen über seine Art, sein Geschlecht und sein Alter informieren kann. Sie versuchen mit solchen Signalen auch ihr Territorium zu verteidigen. Die Ausstrahlung reicht bis zu zehn Meter weit. »Es klingt unglaublich«, sagte José, »aber sie benützen diese Signale nicht nur im normalen Umgang mit anderen, sondern auch, um Dinge zu entdecken, im Kampf um die Vorherrschaft, um einen Partner zu finden – da gibt es für uns noch eine Menge zu lernen.«
Die Elektrizität dieser Fische kann Menschen nicht gefährlich werden. Anders als bei den Zitteraalen (die eigentlich gar keine Aale sind, sondern Fische) liegt ihre Stromspannung weit unter einem Volt. Aber plötzlich rief Paulo: »Cuidado – cuidado!« Vorsicht! In den nassen Pflanzenhaufen verbarg sich ein vielleicht 15 Zentimeter langer Wels mit drei giftbewehrten Stacheln. Wenn so ein Wels sich bedroht fühlt, richtet er die Stacheln auf und wird zu einem giftigen Dreizack.
Den elektrischen Fisch, hinter dem das INPA-Team her war, hatten sie zwar bisher nicht gefunden, und das Voltmeter zeigte an, dass auch diesmal keiner im Netz war. Aber dafür hatten sie zu ihrer größten Überraschung einen Aal entdeckt, den die Wissenschaft bisher nicht gekannt hatte – ein dreißig Zentimeter langes Tier, das offenbar zur Familie der Symbranchidae gehörte. Das stark ausgeprägte Gebiss macht seinen Kopf dreieckig wie den einer Natter.
Für derlei Überraschungen ist das Amazonasgebiet immer gut. Eine vergleichbare Vielfalt gibt es auf der Welt kein zweites Mal. Allein Michael Goulding, der mir Tipps für die Beobachtung der Botos gab, hat in den zwei Jahrzehnten, die er dort arbeitete, zweihundert bis dahin unbekannte Fischarten entdeckt. Ein Bekannter von Dianne, der niederländische Primatologe Marc van Roosmalen, war vor einem Jahr ausgezogen, um eine neue Art von Krallenaffen aufzuspüren, von der er gehört hatte. Bei dieser Unternehmung fand er nebenbei vier andere neue Primaten, eine neue Art Zwergstachelschwein, einen bis dahin unbeschriebenen Tapir und eine unbekannte Unterart des Jaguars. Und das alles nicht einmal dreihundert Kilometer von Manaus entfernt!
Ich beneidete die Botos um ihr Sonarsystem. Hätten wir über etwas Ähnliches verfügt, wäre es ein Leichtes gewesen, sie aufzuspüren. Die Augen der Botos sind genauso groß wie die der Meeresdelfine. Sie funktionieren an der Luft genauso gut wie in klarem Wasser. Im undurchsichtigen Wasser des Solimões steuern die Botos allerdings nach ihrem Sonar: Sie stoßen Töne aus und orientieren sich an dem Echo. Wenn sie durch den überfluteten Wald schwimmen, finden sie den Weg zwischen den Ästen mithilfe einer schnellen Folge klickender Geräusche mit Frequenzen bis zu 170.000 Hertz, die weit außerhalb des menschlichen Hörbereichs liegen. Nur bei so hohen Frequenzen ist das Echo genau genug.
Die Menschen lassen sich, will man den Legenden glauben, seit Jahrtausenden von Delfinen führen. Der Meeresgott Poseidon bat einen Delfin, seine verlorene Braut Amphitrite zu suchen. An dieses Geschehnis erinnert das Sternbild Delfin. In der griechischen und römischen Mythologie galt der Delfin als Sinnbild der Menschenfreundlichkeit in einer sonst feindlichen Tiefe und wurde so zum hilfreichen Führer ins Reich der Toten.
Auch ich wollte mich den Delfinen anvertrauen. Was war es, was mich an ihnen so unwiderstehlich anzog? Natürlich wollte ich ihre Wanderung erforschen. Aber im tiefsten Innern wollte ich mehr als das: Sie sollten mich nach Encante führen, zum Paradies unter dem Wasser. Ich wollte unter ihrer Führung tief eindringen in den wässrigen Schoß der Welt, ich wollte die Seele des Amazonas finden.
Die Wissenschaft nähert sich allen Geheimnissen mit ihren speziellen Werkzeugen und Methoden. Sie misst elektrische Ströme, sie untersucht Mageninhalte, sie zählt Botos.
Aber weder am Zusammenfluss von Solimões und Rio Negro noch in Marchantaria konnte man die Botos auch nur einigermaßen genau zählen, Vera nicht und wir erst recht nicht. Also maß ich am letzten Tag, bevor wir nach Manaus zurückkehrten, das einzig Mess- und Zählbare: ihre Atemzüge. Zwei Botos tauchten ganz nah am Boot auf und ich registrierte ihre Atemzüge: 6.06, 6.09, 6.11, 6.13, 6.14, 6.15, 6.17 … also ungefähr alle zwei Minuten. Dann verschwanden sie. Als wir abfahren wollten, glitten ihre Schatten unter unserem Boot durch, sodass wir sie, wenn auch undeutlich, einmal ganz sahen.