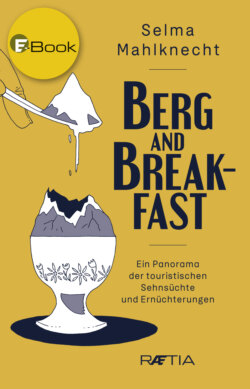Читать книгу Berg and Breakfast - Selma Mahlknecht - Страница 10
1 Magical Mystery Mountain
oder: Thronen wie Gott in Frankreich
ОглавлениеÜber Jahrtausende der Menschheitsgeschichte hinweg waren Berge vor allem eins: hinderlich. Sie versperrten den Weg, machten das Reisen umständlich und mühsam, zu einer beschwerlichen, gefährlichen Angelegenheit. Davon kann nicht nur die Gletschermumie Ötzi ein tiefgefrorenes Liedlein singen. Wie viele Elefanten starben bei Hannibals Überquerung der Alpen? Freilich, irgendwie musste man drüber, wenn man von Norden nach Süden, von Süden nach Norden wollte, Handel treiben, frohe Botschaften bringen, sich zum Kaiser krönen lassen oder auf irgendeine andere Weise sein Glück versuchen. Angesichts schlecht befestigter Saumpfade, rascher Wetterwechsel und unbefriedigender Gasthausdichte dürfte sich das Verkehrsaufkommen auf den Bergpässen allerdings in Grenzen gehalten haben.
Doch nicht nur für Reisende waren Berge herausfordernd. Auch für die Sesshaften war das Dasein an den steilen Hängen, auf denen ein paar Ziegen herumsprangen und nicht viel wuchs, ein ständiger Kampf. Freilich enthielt mancher Berg auch wertvolle Erze, Edelmetalle und Salz, die man auszubeuten trachtete – für die zahllosen Kinder und Erwachsenen, die man tief in die Eingeweide des Berges schickte, um dort Eisen, Silber, Salz und dergleichen abzubauen, blieben jedoch meist nur ein karges Auskommen und ein zerschundener Körper.
Waren des Berges Tiefen düster und gefährlich, so waren des Berges Höhen erst recht lebensfeindlich. Am angenehmsten lebte es sich auf halber Höhe über den Sümpfen des Tales und unter der zerklüfteten Ödnis der Felsen, wo Steilacker, Wald und Weide noch einiges hergaben und der Berg frische Wasserquellen, Schutz vor äußeren Bedrohungen und schöne Aussichten bot. Über der Waldgrenze, in der Nähe der Gipfel wohnten die Winde und der ewige Winter, dorthin verirrte sich kaum ein Mensch. Kein Wunder, dass man in den schroffen Felsen dämonische Wesen vermutete, Riesen, Zwerge, Geister, die mit den Menschen Schabernack trieben, sie in die Irre führten, in Abgründe stürzten, aber manchmal auch reich beschenkten.
Berge bergen – Geheimnisse, Schätze, das Göttliche. In ihrer Geborgenheit konnte man sich sicher fühlen, fern aller irdischen Verblendungen, dem Ewigen nahe. Vom holden Musenhort des Parnass zu den entfesselten Hexentänzen des Blocksbergs ist es freilich nur ein kleiner Schritt. Die Nymphen, Faune, Geister und Dämonen, die man in den Höhen vermutete, waren im gleichen Maße bezaubernd und beängstigend wie die belebte Natur, der man sie zuordnete. Über allen Wolken aber, dem Blick der Menschen entrückt, weilten die Unsterblichen. Der Berggipfel als Sitz der Götter ist eine Vorstellung, die nicht nur die alten Griechen kannten. Kann es einen majestätischeren Thron geben, von dem aus man auf die Welt hinabblickt? Wo aber die Götter thronen, da ist für den Mensch kein Aufenthalt. Heilige Berge galten (und gelten teilweise bis heute) als unbetretbar, verboten, zumindest den Uneingeweihten. Für Rituale und Zeremonien konnte man die mystischen Orte aufsuchen, aber auch dann nur nach sorgfältiger Vorbereitung und nur, wenn man wahrhaftig würdig war. Eremiten lebten ihr asketisches Leben in Berghöhlen, Klosterbrüder zogen sich in die steinerne Wüste zurück, um Gott zu schauen, doch unbedarfte Laien, oft vor allem Frauen, mussten dem heiligen Bezirk fernbleiben.
Bis heute gibt es weltweit Pilgerstätten auf Bergeshöhen, die unzählige Heil und Heilung Suchende anziehen. Längst ist aus der persönlichen spirituellen Reise selbst in entlegenen Winkeln der Erde eine durchorganisierte und kommerzialisierte Industrie geworden, Wanderhändler und Rastlokale verkaufen bis knapp vor der Erleuchtung Wegzehrung, Ausrüstung, rituelle Gegenstände. Doch auch jenseits dieser sakralen Bezirke umgibt die Berge eine Aura des Majestätischen, Weihevollen, Überirdischen. Instinktiv fühlen wir, dass wir uns in eine entrückte, magische Sphäre begeben, wo das Göttliche gegenwärtig ist, bereit, zu segnen oder zu zerschmettern. Der Mensch schrumpft angesichts der Naturgewalt zum Stäubchen zusammen, den Elementen ausgeliefert, dem Unberechenbaren. Er erlebt sich als unbedeutend und endlich, zugleich aber auch als in etwas viel Größeres eingebunden – eine geradezu transzendente Erfahrung. An seine Grenzen zu gehen, einen Teil der Kontrolle abgeben zu müssen, sich einer höheren, ungreifbaren Macht auszuliefern und sich zugleich auf eine Art zu spüren, wie es im sicheren Bereich der eigenen Komfortzone nie möglich wäre, darin liegt denn auch ein beträchtlicher Teil der Faszination, die uns in die Berge treibt.
Das Gefühl, dem Heiligen zu begegnen, ist auch heute noch tief in uns verwurzelt, und es schwingt jedes Mal unausgesprochen mit, wenn wir über die Berge sprechen. Dabei kann man die freizeittauglich gemachten Berge unserer Zeit nicht mit den schroffen, abweisenden Gebirgen vergangener Tage vergleichen. Wer heute in Turnschuh und T-Shirt losmarschiert, der kann sich auf bequeme Seilbahnen und wanderfreundliche, gesicherte Wege freuen, ausgeschildert und mit Zeitangaben versehen. Es winken Einkehrmöglichkeiten und Unterstände, und für den schlimmsten Fall steht der Helikopter der Bergrettung bereit. Aus dem gefährlichen, strapaziösen Geschäft der Bergüberquerung ist betreutes Wandern geworden. Sogar im Himalaja führt ein Schritt für Schritt vorbereiteter Weg mit Seilen, Leitern, Sauerstoffflaschen aufs Dach der Welt, und die Minuten des Gipfelsiegs sind gezählt und durchgetaktet, damit alle Wandergruppen rechtzeitig abgefertigt werden können.
Haben die Berge dadurch ihre Aura, ihre Magie verloren? Sind sie durch das Gewusel der Wanderwütigen entweiht, gar geschändet? Immer wieder hört man diesen Vorwurf von unterschiedlichen Seiten. Schon der Dichter Rainer Maria Rilke klagte, „kein Berg ist ihnen mehr wunderbar“.
Schulden wir den Bergen mehr Ehrfurcht? Sind wir überheblich geworden? Haben wir aus der Naturgewalt einen Lunapark gemacht? Der sprichwörtliche Wanderer in Flipflops ist zur Ikone des Leichtsinns geworden, mit dem wir uns dem Berg nähern. Kann ja nichts schiefgehen, irgendwer holt uns da schon raus.
Doch ein Restrisiko bleibt. Noch immer kann man sich im Gebirge Arme, Beine und den Hals brechen, noch immer kann man sich verirren, vom Steinschlag getroffen werden, abstürzen, erfrieren. In der Todeszone des Everest steigt man an Leichen vorbei, und auch der stolze Preis von mehreren Zehntausend Dollar für die Teilnahme an der Expedition gibt keine Garantie auf eine sichere Rückkehr. Nein, es ist weder schiere Vergnügungssucht noch eine Laune, die den Menschen in die Berge treibt. Es gibt bequemere Wege von Norden nach Süden, es gibt angenehmere Arten des Zeitvertreibs, es gibt risikoärmere Sportarten.
Warum also faszinieren uns die Berge, warum streben nach wie vor und immer mehr Menschen den Gipfeln zu? Wegen des Naturerlebnisses? Der schönen Aussicht? Oder weil es zur Sucht wird, nach und nach? Alle diese Gründe mögen eine Rolle spielen. Trotzdem glaube ich, dass der Hauptantrieb nach wie vor derselbe ist: Wir gehen in die Berge, um dem Göttlichen zu begegnen – und uns selbst.
Zum Beweis rufe ich in den Zeugenstand: Francesco Petrarca und Dante Alighieri.