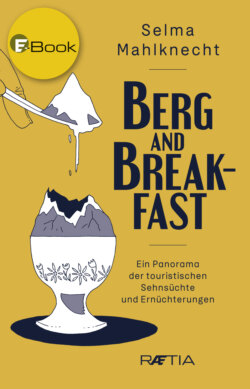Читать книгу Berg and Breakfast - Selma Mahlknecht - Страница 15
ОглавлениеDer eingerichtete Berg mit breiten, gut gesicherten Wegen, mit Beschilderungen, Kletterhaken, Drahtgeländern, Aussichtspunkten und Gipfelkreuzen, mit Ruhebänklein, Unterständen und Gaststätten, mit Kinderspielplätzen, Seilbahnen, Skiliften, Abfahrtspisten und Rodelbahnen, Bike-Trails, abgesprengten Kuppen, umgepflügten Gletschern, künstlichen Seen und Beschneiungsanlagen, mit Konzertbühnen, Erlebnispfaden und anderen Attraktionen, garniert mit Plastik- oder Holzskulpturen jener alpinen Tierwelt, die vor dem Trubel längst Reißaus genommen hat, hat mit seinem Urzustand in etwa so viel gemein wie ein überzüchteter Mops mit einem Wolf. Der Vergleich mag zunächst irritieren. Wenn wir uns aber vor Augen halten, dass den meisten von uns ein Mops um ein Vielfaches lieber ist als ein Wolf, auch wenn der Mops mit seiner plattgedrückten Schnauze kaum noch Luft bekommt, dann passt das Bild wieder. Die wildromantische Vorstellung des Ungezähmten und Ursprünglichen ist genauso lange attraktiv, bis die unberechenbare und bedrohliche Seite der Wildnis zum Vorschein kommt. Kein Wunder, dass wir unsere sehr eigene Vorstellung davon haben, was Natur ist (oder vielmehr: zu sein hat). Knopfäugig, sanft und schön, harmonisch und friedvoll soll sie – darf sie! – sein. Was in dieses Bild nicht passt, wird passend gemacht. Gämsen, Steinböcke, Murmeltiere ja, Wölfe und Bären nein – hier wiederholt sich im Großen, was im Kleinen genauso zu beobachten ist. Bienen und Schmetterlinge sind uns willkommen, Wespen und Stechmücken müssen weichen. Wir sehen: Die vielfach beklagte „Disneylandisierung“ der Alpen hat nicht erst mit dem Aufstellen riesiger Sport- und Spaßanlagen begonnen.
Hier ergibt sich eine kognitive Dissonanz, mit der wir interessanterweise sehr gut zurechtkommen. Einerseits wünschen wir uns unberührte Landschaften und authentische Naturerlebnisse. Andererseits identifizieren wir erst die eingerichtete Landschaft überhaupt als authentisch. Verbuschte und verwaldete Almen gelten uns als ungepflegt und verwahrlost – und die Möglichkeit, beim Wandern einem Bären zu begegnen, begrüßen wir nicht als einmaliges Naturerlebnis, vielmehr denunzieren wir die „politisch korrekte“ Fahrlässigkeit einer abgehobenen Tierschützerlobby.
Wer hier konsequent weiterdenkt, erblickt im zugerichteten Berg eben jene dressierte Natur, die wir gemeinhin überhaupt erst als akzeptabel anerkennen. Zwar kommen die Murmeltiere noch nicht auf Befehl aus den Löchern, aber wir arbeiten daran. So wird der Berg erst im Moment seiner Verkrüppelung und Unkenntlichmachung zum Wander- und Sportparadies, und vielleicht liegt darin das Wesen der Paradiese überhaupt. Die Inszenierung tritt an die Stelle des Echten – und erst in der Inszenierung erfüllt sich das Glücksversprechen. So entzückend der Anblick echter Schneeflocken auch sein mag, wer zum Skifahren in die Berge fährt, erfreut sich an der perfekt präparierten Piste auch dann, wenn das Material dafür aus der Kanone kommt. An den Anblick weißer Bänder auf gelbbraunen Berghängen haben wir uns zunehmend gewöhnt. Und Hand aufs Herz: Echter Schnee ist gar nicht so toll. Er fällt unkontrolliert auch dahin, wo man ihn nicht haben will, er muss aufwendig geräumt werden, und am Ende gibt es eine Lawine. Dann doch lieber menschengemachter Schnee, der punktgenau dort eingesetzt wird, wo er Spaß macht. Blöd nur, dass es durch den Klimawandel immer wärmer wird. Doch mit ein paar technischen Innovationen bekommen wir auch dieses Problem noch in den Griff. Vielleicht gelingt uns sogar der Durchbruch zum schmelzsicheren Kunstschnee für das Skivergnügen im Hochsommer. Es wäre naiv zu glauben, dass derlei Angebote aufgrund ihrer Absurdität bei den Kunden nicht ankämen. Sobald etwas machbar ist, wird es gemacht. Und je länger es gemacht wird, desto mehr verliert es seine Ungeheuerlichkeit. Am Ende siegen Gewohnheit, Bequemlichkeit und Trägheit.
So entsteht eine unaufgelöste und unauflösbare Diskrepanz zwischen unserer Mystifizierung des Berges einerseits und unserem Wunsch nach Zugänglichkeit, Kontrolle und Sicherheit andererseits. Wir möchten unsere Kinder an das Naturerlebnis heranführen – am liebsten auf buggytauglichen Wegen, die sich direkt von der Seilbahnstation sanft geschwungen zum Gipfel schlängeln. Und warum sollten Menschen mit Gehbehinderungen oder verminderter körperlicher Leistungsfähigkeit vom Genuss der Bergwelt ausgeschlossen werden? Hier meldet sich auch unser Sinn für soziale Gerechtigkeit – die Berge sind für alle da! Zugleich spüren wir, dass hier geschummelt wird. Ich schrieb es bereits: Gondeln gilt nicht. Dumpf drückt uns hier das Gewissen. Die Authentizitätssurrogate, die uns als Ersatz für das unwiederbringlich Zerstörte geboten werden, geben uns vielleicht ganz kurz einen Stich. Eigentlich, ahnen wir, müsste das doch anders laufen. Man müsste sich den Berg verdienen. Aber dann zerstreut unser Hedonismus sämtliche Bedenken. Wozu sind denn die Seilbahnen da, wenn nicht, um genutzt zu werden? Und wir schinden uns im Alltag doch schon genug. Da darf es in der Freizeit auch einmal gemütlicher zugehen. Und außerdem sind wir auf Urlaub. Da gelten sowieso andere Regeln.
Doch dazu mehr im nächsten Kapitel.