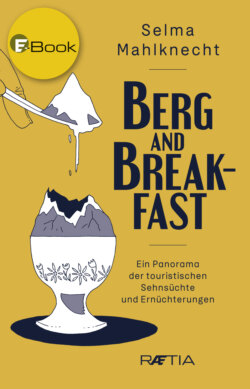Читать книгу Berg and Breakfast - Selma Mahlknecht - Страница 20
1 Bei den Ägyptern hätte es das nicht gegeben
oder: Reisen als moralischer Imperativ
ОглавлениеFür die Ägypter des Altertums gab es nur eine wichtige Reise, eine Reise, auf die das ganze Leben zulief: die Reise ins Jenseits. Auf diese galt es sich vorzubereiten, denn um auf dieser Reise zu bestehen, musste man ein sehr detailliertes Zeremoniell einhalten. Der Bestattungsritus auf heimatlichem Boden spielte hierbei eine zentrale Rolle. So gab es für die Ägypter dieser Zeit keine schlimmere Vorstellung als jene, fern der Heimat zu Tode zu kommen und nicht standesgemäß bestattet zu werden. Trotz des regen Handels, den sie mit Nubiern, Sumerern, Phöniziern und anderen Völkern trieben, waren die Ägypter also stets darauf bedacht, sich nicht zu weit von ihrer Heimat zu entfernen, um die wichtigste, größte Reise ihres Lebens nicht zu gefährden. War also ein Ägypter unterwegs, so geschah es sozusagen dienstlich. Neue Handelsrouten zu erschließen und neue Märkte zu erobern, wie man das heute ausdrücken würde, war wichtig und das damit verbundene Unterwegssein eine notwendige Begleiterscheinung. Das wahre Glück jedoch, das glaubten diese Menschen fest, lag in der Heimat, dem Schwarzen Land.
Mit dieser Einstellung waren die Ägypter nicht allein. Vielen Kulturen galt das unstete Umherschweifen, das Vagabundieren und In-der-Welt-Herumkommen als Zeichen eines zweifelhaften Charakters. Gewiss, Herrscher hatten ihre Herrschaftssitze, zwischen denen sie sich bewegten wie auf einem Schachbrett, Scholaren ihre Klöster und später Universitäten, und Missionare nahmen weite Wege auf sich, um ihre Botschaft an die entlegensten Zipfel der Erde zu bringen. Immer aber war das Reisen Mittel zum Zweck und nicht selbst schon das Ziel. Irgendwohin zu fahren, um zu erleben, wie es ist, dort zu sein, das wäre den meisten Menschen vergangener Tage reichlich absurd erschienen.
Die erste „Hybridform“, die schon Ansätze des modernen Tourismus zeigte, war wahrscheinlich die Pilgerreise. Auch hier reiste man noch nicht um des Reisens willen, aber doch schon aus spirituellen, nicht ökonomischen Gründen. Der Besuch eines entlegenen Heiligtums, das einen ganz besonderen, regional verwurzelten Segen verspricht, geht noch auf die Zeiten zurück, in denen man an lokale Gottheiten, etwa besondere Quellgeister, Orakel und dergleichen, glaubte. Meist waren (und sind) die Heiligtümer mit einer einzigartigen Naturerscheinung verbunden, etwa mit Bäumen, Gewässern oder – wie schon erwähnt – Bergen. Die Aura des Heiligtums und die darin gewärtigte Präsenz der lokalen Gottheit gelten als heilsam, reinigend, beglückend oder zumindest tröstend. Auch in der modernen Tourismusbranche ist die Pilgerfahrt von großer Bedeutung (manche Quellen sprechen sogar davon, dass über die Hälfte aller Reisen weltweit diesen Zweck verfolgen). Den Katholiken fällt vielleicht die Wallfahrt nach Rom oder Lourdes ein, im Islam gibt es das Gebot der Pilgerreise nach Mekka (der Hadsch), den Hindus gilt der Ganges als heilig, mehrere daran gelegene Städte und vor allem die Stadt Varanasi sind alljährlich das Ziel von Millionen Pilgern. Ich vermute außerdem, dass selbst in der hedonistischsten Vergnügungsreise noch ein Körnchen Wallfahrt steckt. Unsere Sehnsucht nach Heilung, Reinigung, Beglückung oder Trost besteht nach wie vor. Und geschäftstüchtige Unternehmer haben diese Sehnsucht schon immer zu ihrem Vorteil auszubeuten gewusst. Tatsächlich ist der Weg zum Seelenheil zuweilen ein recht teurer Spaß – den exklusiven Zugang zur schamanischen Schwitzhütte im Wald muss man sich erst einmal leisten können.
Wer heute an das Reisen denkt, assoziiert es aber meist nicht zuerst mit dem Heiligen, sondern mit Bildung. Das ist insofern bemerkenswert, als Bildung ein kontroverser Begriff ist, der immer wieder andere Interpretationen erfährt und oft nur als Mittel zum Zweck gilt. In diesem Fall müsste man an fahrende Gesellen denken, wie es sie heute nur noch selten gibt, doch der wandernde Müllersbursche oder das tapfere Schneiderlein aus dem Märchen waren keine Reisenden im heutigen Sinne, sondern eher migrantische Fachkräfte. Das ist also nicht gemeint, wenn man landläufig feststellt, dass Reisen bildet. Geht es also darum, dass man sich besser merken kann, dass Berlin an der Spree liegt, wenn man in Berlin eine Spreefahrt unternommen hat? Auch nicht zwingend. Viele wollen mit diesem reichlich diffusen Satz einfach nur ausdrücken, dass es uns guttut, die oft allzu ausgetretenen Pfade eines vorgeformten Denkens und Lebens zu verlassen und zu sehen, dass es anderswo anders zugeht – und daher auch für uns ein anderes Leben möglich wäre. Das mit eigenen Augen zu sehen, ist gewiss erhellend. Trotzdem irrt, wer glaubt, nur durch Reisen allein zu einem besseren, dem Daheimgebliebenen gar in irgendeiner Form überlegenen Menschen werden zu können. Durch die oberflächliche Begegnung mit anderen Kulturen, Lebens- und Denkmodellen, geographischen und politischen Realitäten allein ist noch nicht viel getan. Erst durch eine echte Auseinandersetzung, ein vertiefendes Durchdringen und Verarbeiten des Erlebten können neue Einsichten entstehen. Ansonsten war man einfach nur in Thailand (und wie viele waren einfach nur in Thailand!). Ich bin mir daher nicht sicher, ob es für die Entwicklung von Geist und Persönlichkeit wirklich nötig ist, durch die Welt zu reisen. Ich schrieb es bereits: Zur Erleuchtung gelangt man im Zweifelsfall auch einen Steinwurf von zu Hause entfernt unter einem Baum am Fluss.
Trotzdem ist unbestritten, dass der moderne Tourismus eine kulturelle Errungenschaft ist, die auch einem aufklärerischen Gedanken von Freiheit und Gleichheit entspringt. Von den Kavalierstouren adeliger Sprösslinge im 17. Jahrhundert bis zum Strandurlaub an der Adria war es allerdings ein weiter Weg. Es bedurfte vieler kleiner Schritte, bis das Reisen „an und für sich“ nicht mehr das Vorrecht einer wohlhabenden Elite war, sondern nach und nach zumindest in weiten Teilen Europas so gut wie alle Schichten der Gesellschaft erreichte und zum Massenphänomen wurde. Der Urlaub sollte gerade den Arbeitern zur Entspannung und Wiederherstellung ihrer „Nervenkraft“ dienen, damit sie danach wieder umso tüchtiger malochen konnten, so jedenfalls ein Leitgedanke der nationalsozialistischen Gemeinschaft „Kraft durch Freude“, die in den Dreißigerjahren als Pendant der faschistischen Opera Nazionale Dopolavoro entstanden war und unter anderem Ausflüge und Wanderungen organisierte. Adolf Hitler wird in diesem Zusammenhang mit einer noch hintersinnigeren Formulierung zitiert. Der Arbeiter solle sich in Freizeit und Urlaub ausreichend erholen können, denn: „Nur allein mit einem Volk, das seine Nerven behält, kann man wahrhaft große Politik machen.“
Dass die Bevölkerung nicht nur Deutschlands, sondern der ganzen Welt nach der „wahrhaft großen Politik“ erst recht Erholung nötig hatte, steht auf einem anderen Blatt.
Heute haben wir das Prinzip des „Urlaubs für alle“ verinnerlicht. Die kleine Auszeit am Wochenende, die Erholungsreise in die Berge oder ans Meer sind keine Privilegien mehr, sondern gehören wie Fernseher, Waschmaschine oder Kühlschrank zur Grundausstattung – nur die Ausführung variiert. Mit eben diesem scheinbar „gerechten“ und „gleichmachenden“ gesellschaftlichen Anspruch nicht nur auf Urlaub, sondern auf Urlaubsreisen werden denn auch Schnäppchenangebote wie die viel kritisierten Billigflüge oder Pauschalreisen verteidigt. Nur durch sie, wird argumentiert, hätten auch die kleinen Leute eine Chance auf den ihnen zustehenden Ferienspaß auf Mallorca oder das Shoppingerlebnis in London. Der günstige Preis stoße die Tür zur Welt auch jenen auf, die ansonsten nur ein bescheidenes Leben führen könnten. Das mache ihn zum großen Ermöglicher von Partizipation – und damit zum unabdingbaren Kernelement einer „Demokratisierung“ des Reisens. Die Erzählung, dass wir nur durch Discountangebote, die ein unablässiges Kaufen und Konsumieren bis in die bedrängtesten Lebensverhältnisse hinein sicherstellen, unser System und den sozialen Frieden aufrechterhalten, gehört zu den – zunehmend bröckelnden – Mythen des Kapitalismus. Mehr und mehr wächst unser Bewusstsein dafür, dass sagenhaft günstige Preise nicht die realen Kosten eines Produktes oder Angebots abbilden. Diese werden von anderen getragen – häufig von ausgebeuteten Erntehelfern und Arbeiterinnen am anderen Ende der Welt. Oder von der Umwelt. Die Rechnung dafür bekommen wir derzeit häppchenweise serviert.
Zudem darf man nicht aus den Augen verlieren, dass auch der Massentourismus unserer Zeit noch weit davon entfernt ist, ein wahrhaft universelles Phänomen zu sein, ganz im Gegenteil, hier zeigt sich die wachsende globale und soziale Ungleichheit besonders deutlich. Tourismus ist nicht demokratisch. Und es gibt kein Menschenrecht auf Reisen.
Die Lust darauf ist allerdings weiterhin groß und wird weltweit immer größer. Die Tourismusindustrie wächst nach wie vor rasant, und eine Rückkehr zur Reiseskepsis vergangener Tage ist nicht absehbar – ganz im Gegenteil. Der durch die Corona-Pandemie forcierte Stillstand nährt erst recht den Wunsch nach Kompensation und weiter Welt.
Dabei gibt es vieles, das gegen das Reisen spräche. Zu den persönlichen gesundheitlichen und sonstigen Risiken (verdorbene Lebensmittel, exotische Krankheiten, wilde Tiere, Raub, Entführungen), den physischen und psychischen Strapazen und finanziellen Belastungen kommt in der heutigen Zeit mehr und mehr auch der Preis für die Umwelt ins Spiel. Der Tourist ist, ob er es will oder nicht, ein Turbo-Konsument. Bereits seine Anreise ist ressourcenintensiv, dazu kommen sein Aufenthalt im Hotelzimmer oder Apartment, seine Restaurantbesuche, seine Nutzung öffentlicher und privater Anlagen und Einrichtungen – die Liste ist endlos und lässt sich nicht kleinreden. Im Urlaub die Umwelt zu schonen, geht im Grunde nur, wenn man zu Fuß losgeht. Dass man dabei nicht weit kommt, könnte durchaus als Vorteil betrachtet werden – statt an fernen Orten den Einheimischen die schönsten Plätzchen streitig zu machen, begnügt man sich mit dem Guten, das so nah liegt. Vernünftiger und nachhaltiger wäre es jedenfalls. Den alten Ägyptern hätte das sofort eingeleuchtet. Für uns aber ist es komplizierter.
Erstens weil, wie wir als von den sozialen Medien Gestählte wissen, Vernunft kein Argument ist. Nie.
Zweitens weil Reisen heute nicht nur ein Wert an sich ist, sondern der Wert an sich. Und das durchaus in einem moralischen Sinne: Wer reist, ist gut. Wer nicht reist, ist irgendwie verdächtig. Unsere Weltanschauung hat also seit den alten Ägyptern eine Hundertachtzig-Grad-Wende erfahren (wenn auch nicht ganz – aber dazu komme ich noch).
Wenn uns ein junger Mensch nach seiner Ausbildung, der Matura oder einer Enttäuschung erzählt, er wolle jetzt einfach mal eine Auszeit nehmen, um zu reisen, finden wir das prinzipiell toll. Raus in die Welt, mal was anderes sehen, seinen Horizont erweitern, Fremdsprachen lernen – super. Und auch für Erwachsene gilt der Traum von der Weltreise, dem großen Auf- und Ausbruch, etwa nicht als pubertär, unreif oder gefährlich, sondern als erstrebenswert, romantisch, mutig. Wenn wir uns vor Augen halten, dass die Dinge ja nie so sind, wie sie sind, sondern so, wie wir uns davon erzählen, dann ist dieser Wandel in der allgemeinen Wahrnehmung doch erstaunlich. In unserer Zeit ist das Reisen kein halsbrecherisches Wagnis mehr, das man raubeinigen Abenteurern überlässt. Es ist zum moralischen Imperativ geworden, dem sich kaum jemand entziehen kann. Wer das Privileg hat, reisen zu dürfen, hat zugleich auch die Pflicht, reisen zu wollen. Nur wer die Welt gesehen hat, darf mitreden. Reisen wird zuweilen sogar zum Ersatz für die großen verbindenden Erzählungen, die uns gesellschaftlich einen. Heute kann man nicht mehr davon ausgehen, dass die griechischen Mythen oder die Geschichten der Bibel Allgemeingut sind. Aber jeder weiß, was ein Urlaub am Meer ist, und wenn er noch nicht selbst in Venedig war, so kennt er zumindest dessen Mythos. Die Nähe zur religiösen Reise ist hier unübersehbar.
Reisen dient also zu einem guten Teil auch dem Abhaken mystifizierter Orte des kollektiven Bewusstseins. London, Paris, New York werden zu unseren gemeinsamen Referenzrahmen, sie gesehen zu haben, erhebt uns in den Kreis jener, die Bescheid wissen. Ob es uns dann da gefallen hat oder nicht, ist völlig sekundär. Auch das snobistische Achselzucken „Ach, London war nichts Besonderes“ gehört zum Spiel. Es geht daher letztlich gar nicht so sehr darum, eine möglichst schöne, möglichst horizonterweiternde Erfahrung zu machen, sondern darum, Teil einer Gemeinschaft zu sein, die beispielsweise kollektiv von Venedig enttäuscht ist. „Been there, done that“, eine englische Redewendung für das Allzuvertraute, bis zum Überdruss Durchgekaute, ist daher auch eine Art Medaille, die man sich umhängen kann. „Paris? Habe ich hinter mir. Teuer. Dreckig. Und überall Franzosen. Furchtbar.“
Heilung finden, Neues lernen, mitreden können – ist der Reisende also doch der bessere Mensch?
Dazu sollten wir uns zwei Dinge vor Augen halten: Der große Philosoph Immanuel Kant bewegte sich als junger Mann im vergleichsweise engen Umkreis seines Geburtsortes Königsberg, den er im fortgeschrittenen Alter trotz mehrerer Rufe an diverse Universitäten überhaupt nicht mehr verließ. Das hat ihn nicht davon abgehalten, einer der einflussreichsten Denker seiner Zeit zu werden.
Und zweitens: Bei aller Verklärung des Reisens zum ultimativen Bildungsgut und Merkmal des weltoffenen Menschen sollten wir nicht vergessen, wer und was die Reisenden sind, wenn sie unterwegs sind: nämlich Touristen.