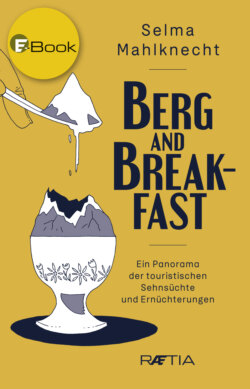Читать книгу Berg and Breakfast - Selma Mahlknecht - Страница 17
Im Porträt Der Mensch ist ein Fußgänger Dominik Siegrist, Professor für naturnahen Tourismus an der „OST Ostschweizer Fachhochschule“
ОглавлениеEs gibt viele Routen von Wien nach Nizza. Eine davon, vielleicht die beschwerlichste, führt über die Alpen. Mehr als 1.800 Kilometer ist sie lang. Dominik Siegrist hat sie gleich zweimal bewältigt: zu Fuß. Mehr als 80.000 Höhenmeter aufwärts hat er dabei jeweils hinter sich gebracht. Die „Fortbewegung aus eigenen Körperkräften“, wie er es nennt, fasziniert ihn. „Ich benötige kein Fahrzeug dafür, nicht einmal ein Fahrrad, geschweige denn einen Motor. Ich kann einfach gehen. Das finde ich etwas Faszinierendes, dass man mit Gehen eigentlich überall hinkommt. Es braucht einfach mehr Zeit.“
Vier Monate hat seine letzte Alpendurchquerung im Jahr 2017 gedauert, ein Kompagnon und zweihundert Menschen haben ihn dabei dauernd oder etappenweise begleitet. In seinem Buch „Alpenwanderer“ dokumentiert Siegrist dieses Projekt, das auf whatsalp. org auch im Internet zu finden ist. Es handelte sich dabei keineswegs um eine sportliche Herausforderung, bei der irgendwelche Rekorde angepeilt wurden, wie ein Blick auf die Routenplanung zeigt. Vielmehr boten zahlreiche Ruhetage und kürzere Etappenabschnitte die Gelegenheit, sich mit einem Gebiet und seinen Besonderheiten vertieft auseinanderzusetzen oder Menschen zu treffen und mit ihnen zu sprechen. Das ist der gemeinsame Tenor von Siegrists zahllosen Wanderungen, die sich wie ein Spinnennetz über die gesamten Alpen ziehen: Sie sind Spurensuchen und Bestandsaufnahmen, Schulung und Sensibilisierung in einem. Schritt für Schritt den Wandel der Landschaft, die kontrastierenden Realitäten, die Konflikte und Probleme zu erfassen und daraus nicht nur persönliche, sondern gesellschaftliche Konsequenzen zu ziehen, ist dem Schweizer ein zunehmend dringlicheres Anliegen.
Bereits als Student der Geographie hatte er sich mit den großen Fragen wie etwa der Verteilungsgerechtigkeit zwischen dem globalen Norden und Süden beschäftigt: „Mich interessierten damals die großen Dimensionen und ich dachte, wir müssen die riesigen Probleme auf übergeordneter Ebene lösen und die politischen Systeme verändern.“ Später wollte Siegrist zumindest im Kleinen zur Veränderung beitragen. Über Jahre hinweg arbeitete er mit seiner Firma AlpenbüroNetz und später als Präsident der Internationalen Alpenschutzkommission CIPRA mit zahlreichen Partnern im Alpenraum an neuen Lösungen für Tourismus, Landwirtschaft und Sozialleben. „Ich habe nicht Skigebiete oder Resorts beraten, mich hat der natur- und kulturnahe Tourismus interessiert. Auf die Industrialisierung der Alpen habe ich mich beruflich weniger eingelassen, außer dass ich gewisse Großprojekte immer wieder kritisiert habe.“ Die Industrialisierung der Alpen – damit meint Siegrist den intensiven Tourismus, die Stauseen und die Urbanisierung. Zwar erkennt er deren wirtschaftliche Bedeutung für die Alpenregionen an, doch dem Immermehr-und-immergrößer erteilt er eine Absage.
Wer auf Massentourismus setze, solle nicht vorzutäuschen versuchen, das kleine idyllische Bergdorf zu sein – beides zugleich vertrage sich schlecht: „Diese alten Orte mit ihren intakten Dorfkernen, wie es sie beispielsweise im Unterengadin gibt, präsentieren sich heute beinahe wie Museen, aber sie sind auch sprechende Zeugen einer vergangenen Epoche. Das Ziel sollte es sein, diesen Gemeinden ihre Alltagskultur zu erhalten, indem dort weiterhin eine altersmäßig gut durchmischte Bevölkerung ansässig sein kann.“ Wenn aber die Zweitwohnungen überhandnähmen, seien diese Orte tot. Läden, die Post und die Schule würden dann in die nächstgrößeren Zentren verlagert und die Menschen müssten sich jeden Tag in ihr Auto setzen.
„In der Schweiz ist die ganze Landfläche durch die Zweitwohnungen aufgefressen worden, sodass die Hotellerie gar keine Möglichkeiten mehr hat, sich zu entwickeln. Die Leute gehen in der Schweiz in ihre Zweitwohnung in die Ferien und nicht in die Hotels. Da hat man es auch verpasst, einen Riegel vorzuschieben und zu sagen, man möchte für die Hotellerie die Zukunftschancen erhalten. Dabei ist ein Hotel, wenn es gut geführt ist, ein Betrieb, der wirklich auch Wertschöpfung bringt für eine Region. Und eine Zweitwohnung, die dann auch noch elf Monate leer steht, bringt keine Wertschöpfung, hat die Landressourcen aufgebraucht, kostet die Gemeinde viel wegen der Erschließung – da gibt es auch Studien dazu. Wenn man wenigstens Hotels hätte und einen gescheiten Tourismus, der auf den Hotels basiert – aber in vielen Tourismusgemeinden in der Schweiz hat man ja kaum mehr Hotellerie.“
Siegrist geht es nicht darum, den Massentourismus zu verteufeln. Vielmehr sieht er darin eine Industrie, wie es diese in anderen Gebieten auch gebe. „Orte mit Intensivtourismus haben einen anderen Charakter, der durchaus auch seinen speziellen Charme haben kann. Ich denke an die Pseudo-Alpenarchitektur mit ihren siebenstöckigen Jumbo-Chalets und holzverkleideten Après-Ski-Einrichtungen. Das finde ich fast schon wieder schön, weil es so absurd ist.“ Ehrlicher sei es allerdings, wenn sich diese Tourismushochburgen auch tatsächlich als Städte präsentieren würden, mit einer zeitgemäßen Architektur: „Wieso nicht auch mit Hochhäusern? Mir schweben urban gestaltete Quartiere mit guten Hotelbetten und qualitativ hochwertigen Ferienwohnungen vor. Natürlich bewirtschaftete Ferienwohnungen und nicht kalte Betten, die die längste Zeit im Jahr leer stehen.“
Siegrist fügt hinzu, dass solche Tourismusstädte durchaus klimaneutral gebaut und betrieben werden können. Er verweist auf Destinationen wie Serfaus in Tirol oder Flims-Laax in Graubünden, die gerade versuchten, Schritte in diese Richtung zu machen. Er erinnert an das Ziel des Pariser Klimaabkommens von 2015, die globale Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen. „Dies bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als dass wir vollständig aus den fossilen Energieträgern Öl, Gas und Kohle aussteigen müssen. Es wird also kein Motorfahrzeugverkehr mit Benzin- und Dieselfahrzeugen mehr geben, Öl- und Gasheizungen werden verschwunden sein, wir müssen auf Flüge mit fossilem Kerosin verzichten sowie auf eine klimaverträglichere Ernährung mit deutlich weniger Fleisch umsteigen, und auch ein Ende des Verschleißes von Konsumgütern ist unverzichtbar.“
Doch was heißt das für den Tourismus in den Alpen? Gerade die Bergregionen sind von den Folgen des Klimawandels bereits heute besonders stark betroffen: „Ich vermisse die Reflexion seitens der Tourismusverantwortlichen über dieses Problem. Ich habe den Eindruck, dass sie einfach darauf warten, was von der Politik kommt, und gleichzeitig darauf hinwirken, dass der Wandel möglichst lange hinausgezögert wird.“ Stattdessen solle der Tourismus jedoch proaktiv auf die Herausforderungen zugehen und mit seinen eigenen Beiträgen aufzeigen, dass Netto-Null auch in dieser Branche möglich sei.
Es sei nicht zu bestreiten, dass der Schweizer Bergtourismus in einer wirtschaftlich schwierigen Phase stecke. Der starke Schweizer Franken mache den Betrieben seit Jahren zu schaffen und gerade der wichtige deutsche Markt sei schon lange vor Corona eingebrochen. Dennoch findet es Siegrist problematisch, dass Teile des Schweizer Tourismus nun auf den asiatischen Markt setzten. Allein 2018 hätte die eine Million Gäste aus China mit ihren Fernflügen deutlich mehr Treibhausgase verursacht als der gesamte Autoverkehr in der Schweiz. „Ist das in der heutigen Zeit überhaupt noch vertretbar?“
So werde der Schweizer Tourismus seinen notwendigen Beitrag zum Klimaschutz jedenfalls nicht leisten können. Siegrist erinnert an eine alte Faustregel, nach der man sich so viele Wochen an einem Ort aufhalten solle, wie man Tausende Kilometer dorthin zurückgelegt habe. „Also wenn jemand aus Japan 10.000 Kilometer in die Alpen fliegt, sollte er sich mindestens zehn Wochen hier aufhalten. Wenn sich alle an diese Faustregel halten würden, könnte man die weltweiten Flugreisen bereits auf ein Fünftel von heute reduzieren.“
Siegrist skizziert einen Netto-Null-Alpentourismus. Das werde ein Tourismus sein, der mit deutlich weniger Mobilität auskomme, nicht nur in der Luft, sondern auch auf der Straße. Der öffentliche Verkehr werde eine viel größere Bedeutung erhalten als heute, wo der Individualverkehr noch dominiere. „Eisenbahn- und Autoverkehr werden in erster Linie elektrisch abgewickelt werden, der Bus- und LKW-Betrieb werden möglicherweise auf Basis von klimaneutral produziertem Wasserstoff erfolgen. Hotels, Freizeitanlagen und Gebäude werden vollständig mit erneuerbaren Energiequellen beheizt sein. Und auch sonst werden wir darauf achten müssen, dass wir mit unseren Ressourcen viel schonender umgehen als heute. Die Bilder von Müllhalden am Saisonende mit nicht mehr gebrauchten Skiern werden dannzumal der Vergangenheit angehören.“ Um die zusätzlich benötigte elektrische Energie zur Verfügung zu haben, müssten wir in erster Linie die Solarenergie in Kombination mit neuen Techniken der Energiespeicherung nutzen.
Der Tourismus in den Alpen werde sich aber auch insgesamt stark wandeln. Die heutige Ski-Monokultur werde in differenzierte Tourismusformen übergehen. Die Ursachen dafür seien vielfältig und lägen auch in der allgemeinen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung. Die steigenden Temperaturen seien nur ein Grund dafür. „Besonders in der warmen Jahreszeit dürften touristische Aktivitäten, die nicht auf große Infrastrukturen in der freien Landschaft angewiesen sind, mittelfristig zum Mainstream werden. Dies wird generell zu einer Ökologisierung des Alpentourismus führen.“
Ein neues touristisches Bewusstsein breche sich mehr und mehr die Bahn, auch befeuert durch die Corona-Pandemie: „Für die meisten Menschen ist es zum ersten Mal diese existenzielle Grunderfahrung, dass nicht alles so bleibt, wie es war. Es sind nicht unbedingt die Einschränkungen durch den Staat, sondern es ist die Pandemie an und für sich, die Tatsache, dass dieses Virus existiert und uns alle bedroht. Diese Erfahrung verändert die Menschheit.“ Wohin das gehe? „Ich glaube nicht, dass dadurch nun auf einmal die große Weltverbesserung eintritt, mit der Klima und Umwelt gerettet werden. Aber die mit Covid-19 zusammenhängenden seelischen Erfahrungen bringen für uns alle schon weitreichende Folgen mit sich. Wir erkennen nun, dass wir trotz Spitzenmedizin und Hochtechnologie ziemlich verletzlich bleiben. Und dass sich unsere Gesellschaft und Wirtschaft verändern müssen, wenn sie solchen und ähnlichen Krisen künftig resilienter begegnen wollen. Da denke ich nicht nur an weitere Pandemien, sondern auch an die sich verschärfende Klimakrise.“
Von schwammigen Marketingbegriffen und Alibi-Aktionen für einen falsch verstandenen „sanften Tourismus“ hält Siegrist freilich nichts. Eine wirklich nachhaltige Entwicklung müsse einlösen, was sie verspreche. Er verweist auf die von der UNO definierten siebzehn Ziele, den Sustainable Development Goals oder SDGs, die auch für den Tourismus gelten. Statt vom „sanften“ oder „nachhaltigen“ Tourismus spricht er daher lieber vom natur- und kulturnahen Tourismus, für den klare Definitionen vorlägen. Dabei gehe es um für den Tourismus so wichtige Bereiche wie Strategie und Positionierung, Angebotsentwicklung, Mobilität, Schutz von Natur und Landschaft, Kommunikation und Marketing sowie regionale Wertschöpfung.
Der im Corona-Sommer 2020 boomende Outdoor-Tourismus habe bei vielen Gemeinde- und Tourismusverantwortlichen die Einsicht reifen lassen, dass ein funktionierendes Besuchermanagement unabdingbar sei. Das könne ein taugliches Werkzeug zur Entlastung von Naturgebieten und zur gleichzeitigen Verbesserung der Angebotsqualität sein: „Konkret geht es um gute Angebote, um Information und Lenkung der Besucher durch Wegweiser und bauliche Vorkehrungen, falls nötig bis hin zu Verboten.“ Als wirksames Mittel der Besucherlenkung erweise sich auch immer wieder die Schließung von Bergstraßen für den touristischen Durchgangsverkehr.
Also doch lieber zu Fuß gehen? Für Dominik Siegrist, den Alpenwanderer, keine Frage. „Mir und ganz vielen Menschen macht zu Fuß gehen Spaß. Wandern ist eine ganz ursprüngliche Form der Bewegung. Die Menschen sind die längste Zeit in ihrer Geschichte zu Fuß gegangen. Und auch heute noch ist der Mensch ein Fußgänger.“
Ganz so schnell werden wir allerdings noch nicht kollektiv zu Fuß in den Urlaub gehen. Der Wandel hin zur Nachhaltigkeit brauche Zeit, das ist Siegrist klar, auch wenn er gleichzeitig darauf hinweist, dass wir dafür eigentlich nicht mehr viel Zeit hätten. Und noch etwas sei entscheidend: „Wir Menschen kommen sowieso nur in eine wünschbare Zukunft, wenn jede und jeder von uns einsieht, dass es keinen Weg gibt, der an der nachhaltigen Entwicklung vorbeiführt. Wenn uns der Staat einfach vorschreibt, ihr müsst jetzt dies und das tun, wird das nicht funktionieren. Die Politik hat die Aufgabe, geeignete Rahmenbedingungen zu setzen, aber unser Bewusstsein müssen wir selber verändern.“
Der partizipative Ansatz, den Siegrist verfolgt, ist mit mühsamen, oft langwierigen Prozessen verbunden. Und obwohl er am Konzept der kleinen Schritte festhält, räumt er auch ein, dass er mittlerweile wieder zur Überzeugung seiner Studentenjahre zurückgekehrt sei: „Nach drei Jahrzehnten solch minutiöser Arbeit bin ich wieder an dem Punkt – nicht zuletzt auch durch die Klimadiskussion angeregt – dass ich sagen muss, wir schaffen es nicht mit diesen kleinen Veränderungen. Wir müssen in absehbarer Zeit den Turnaround im Großen schaffen, sonst wird unsere Zukunft ganz, ganz schwierig.“
Am Ende unseres Gesprächs frage ich ihn, was er verändern würde, wenn er einen Zauberstab hätte. „Dass unsere Welt, in diesem Fall vor allem der Tourismus, nicht mehr so stark vom Geld getrieben ist. Wenn uns dieser Systemwechsel gelingt, können ganz viele Dinge ganz von allein anders laufen. Dann darf der Boden nicht mehr spekulativ verwertet werden, es werden vielleicht Projekte realisiert, bei denen andere Werte als die Gewinnmaximierung im Vordergrund stehen. Dann gibt es nicht mehr den Druck nach immer mehr Wachstum im Tourismus und weniger Bedarf von Investoren nach Erschließung unberührter Berglandschaften. Der Mensch mit seinen ureigensten Bedürfnissen steht dann wieder mehr im Zentrum. Denn das Reisen ist für uns alle etwas Grundlegendes, einst, heute und in Zukunft. Aber nicht Marketing und finanzieller Gewinn dürfen der Maßstab sein, sondern die Reisenden selbst. Ich würde den Zauberstab in diese Richtung lenken.“