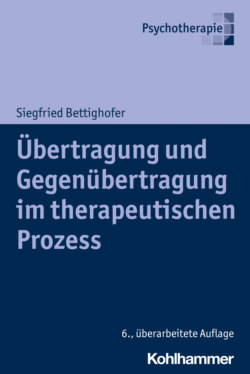Читать книгу Übertragung und Gegenübertragung im therapeutischen Prozess - Siegfried Bettighofer - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.4 Übertragung als Projektion
ОглавлениеFreud beschrieb die Projektion als Abwehrmechanismus, bei dem innere Anteile auf andere Personen projiziert und im Außen wahrgenommen werden. Melanie Klein (1972) erweiterte ihn zum Begriff der projektiven Identifikation, der dann in einer Weiterentwicklung von Money-Kyrle (1956) und Bion (1990, 1984) als archaischer Kommunikationsvorgang begriffen wurde (s. a. Gilch-Geberzahn 1994, Jimenez 1992, Kernberg 1989, Mertens 1991, Ogden 1988, Porder 1991, Schore 2003). Dabei werden unbewusste und wegen ihres starken Affektgehaltes unerträgliche Anteile des eigenen Selbst auf das andere Objekt verlagert und im Falle der reinen Projektion bei einem relativ gut strukturierten Patienten als ein Gedanke über den anderen wahrgenommen. Bei Patienten mit ichstrukturellen Störungen nimmt dieser Vorgang mehr die Form einer projektiven Identifikation an. Hier besteht die Gefahr eines destruktiven Gegenübertragungsagierens aufseiten des Therapeuten, da er die projizierten und (durch subtile nonverbale Signale des Patienten) induzierten Anteile des Patienten als intensive eigene Gefühle und Handlungsimpulse verspürt (Götzmann und Holzapfel 2003, Kernberg 1988a, Streeck 2009). Mit derartigen »Stimmungsübertragungen« und »interagierten Affekten« befasst sich auch die Arbeit von Herdieckerhoff (1988), in der dieser kommunikative Vorgang bei der Stimmungsinduktion näher untersucht wird. Aus neurobiologischer Sicht spielen bei diesem Vorgang der Gefühlsansteckung und dem Erzeugen von Gefühlen im Analytiker sicherlich auch die Spiegelneuronen im Frontalhirn eine große Rolle (Bauer 2015). Diese kommunikativen Mikroprozesse wurden von Streeck (2004) und Krause (2006) auf der Basis von videounterstützten Interaktionsanalysen und von Buchholz (2019) mithilfe von Diskursanalysen therapeutischer Dialoge eingehender untersucht.