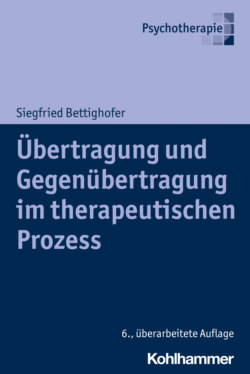Читать книгу Übertragung und Gegenübertragung im therapeutischen Prozess - Siegfried Bettighofer - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorwort
ОглавлениеPsychoanalytiker1 haben hohe Ansprüche an sich und an die Qualität ihrer therapeutischen Arbeit. Dagegen ist sicherlich nichts einzuwenden, jedoch kann ich mich des Verdachts nicht erwehren, dass mancherorts nach wie vor Anzeichen einer selbstidealisierenden Überschätzung in den Reihen der Psychoanalyse zu erkennen sind. Demgegenüber gesteht der prominente nordamerikanische Psychoanalytiker Gill (1997) in seinem Spätwerk mit leisem Bedauern ein, dass andere psychotherapeutische Methoden mit weniger zeitlichem und finanziellem Aufwand dieselben Effekte erzielen könnten, also effizienter sind als die Psychoanalyse, wobei er allerdings nicht primär die Verhaltenstherapie meint, sondern sich auf alle psychodynamischen Verfahren bezieht. In der Öffentlichkeit verdichtet sich während der letzten Jahre ein zunehmend kritisches Bewusstsein unserer Arbeit gegenüber. Die analytische Behandlung steht also auf dem Prüfstand, sie wird kritisch hinterfragt. Es reicht in dieser Situation nicht mehr, sich in den analytischen Elfenbeinturm zurückzuziehen und sich mit der Wiederholung einiger Dogmen und Lehrsätze zu verteidigen bzw. ihre vermeintliche Überlegenheit herbeizureden.
In dieser brisanten Situation ist etwas anderes nötig: Die Psychoanalyse muss sich der fachübergreifenden Diskussion öffnen und ihre behandlungstechnischen Konzepte und Modelle einer kritischen Reflexion unter aktuellen Gesichtspunkten unterziehen. Sie muss auch ihren Anspruch, eine fundierte und wirksame Form der Psychotherapie zu sein, durch eine realistische Einschätzung und den empirischen Nachweis ihrer Wirksamkeit erst wieder unter Beweis stellen.
Die vorliegende Arbeit entstand unter dem Eindruck, dass es auch in analytischen Behandlungen immer wieder zu erheblichen Stillständen, zu negativen Verläufen oder zum Abbruch von Therapien durch Patienten kommt. Dies wurde über viele Jahre hinweg tabuisiert oder einseitig den Patienten angelastet. Obwohl davon ausgegangen werden kann, dass Psychoanalytiker bei ihrer Arbeit verantwortlich handeln und über die nach wie vor längste und intensivste psychotherapeutische Ausbildung verfügen, kommt es auch in analytischen Behandlungen – häufiger als gemeinhin angenommen – zu negativen Prozessen und destruktiven Entwicklungen in der Therapeut-Patient-Beziehung. Diese können im ungünstigsten Fall zu einer massiven Schädigung des Patienten führen. Die meisten Formen der gestörten Beziehung zwischen Therapeut und Patient verlaufen wenig spektakulär und fallen wegen ihrer Subtilität gar nicht sofort auf, wodurch allerdings ihre Destruktivität nicht geringer wird.
In der Psychoanalyse besteht inzwischen ein zunehmender Konsens darüber, dass die verbale Deutung und Einsicht nicht die wesentlichen therapeutischen Wirkfaktoren sind. Auch das Entstehen einer als hilfreich empfundenen Beziehung zwischen Analytiker und Patientin entscheidet wesentlich über den Erfolg oder Misserfolg einer Analyse. Dabei kommt insbesondere der Arbeit mit Übertragung und Gegenübertragung eine zentrale Bedeutung zu, denn in schwierigen Fällen hängt der Behandlungserfolg entscheidend davon ab, inwieweit die Therapeutin mit ihrer Gegenübertragung konstruktiv umgehen kann.
In Übereinstimmung mit Gill (1982) ist es auch mein Eindruck, dass trotz der zentralen Stellung, die die Übertragungsanalyse in der Behandlungstheorie einnimmt, die praktische Arbeit mit Übertragungsprozessen noch weit hinter der Theorie herhinkt und sich Schwierigkeiten in der konkreten Umsetzung zeigen. Hier versuche ich, in meiner Arbeit anzusetzen, indem ich nach der Darstellung des klassischen Übertragungsbegriffes einzelne Aspekte, die während der letzten Jahre allmählich größere Aktualität erlangt haben, im Einzelnen beschreibe.
Zunächst wird das klassische objektivistische Behandlungsparadigma einer Kritik unterzogen und auf die Subjektivität aller Beobachtungen und Einschätzungen, die der Analytiker vornimmt, verwiesen. Das Schema-Konzept wird verwendet, um die sich entfaltende Übertragung des Patienten als die Aktivierung bestimmter innerer Schemata zu beschreiben, die einerseits als Niederschläge von frühkindlichen Interaktionserfahrungen im Patienten abrufbar sind, jedoch auch durch die Person des Analytikers und sein Interaktionsangebot aktualisiert werden. Deshalb kommt der Interaktion zwischen Therapeut und Patient auch eine sehr zentrale Bedeutung zu, weil, wie im nächsten Kapitel beschrieben wird, die Entfaltung der Übertragung immer ein interaktioneller Vorgang ist: eine Ko-Kreation, bei dem beide Interaktionspartner sich sehr subtil aufeinander einstellen und sich gegenseitig anpassen und so in einem zirkulären Prozess die jeweils spezifische Form der Übertragung herstellen. Dabei wird stets der Einfluss des Therapeuten und das Vorliegen möglicher Eigenübertragungen seinerseits besonders berücksichtigt, da die Person des Analytikers mit ihrem eigenen Einfluss auf den analytischen Prozess in der fachlichen Diskussion durch den Einfluss der intersubjektiven Wende zunehmend in den Fokus gekommen ist.
Große Bedeutung hat das Konzept der latenten Übertragung, das beschreibt, wie sich in jeder Therapeut-Patient-Beziehung unvermeidlich unbewusste Interaktionsmuster einschleichen, die in einen Handlungsdialog zwischen beiden münden, durch den im Sinne des Wiederholungszwanges eine traumatische frühe Modellszene oder Beziehungskonstellation sich unbemerkt, jedoch in der realen Interaktion als Inszenierung bzw. Enactment wiederholt. In groben Fällen führen solche Konstellationen zu drastischen Missverständnissen, zum destruktiven Mitagieren des Therapeuten und zu negativen Verläufen. Oft bleiben solche Inszenierungen neurotischer Muster unbemerkt und fallen dann nur im Rahmen von Supervisionen auf, die gerade deshalb für unsere Arbeit besonders wichtig sind.
In einem letzten Teil der vorliegenden Arbeit wird die moderne psychoanalytische Therapie als eine entwicklungsorientierte Beziehungskonflikttherapie konzeptualisiert und es werden einige Möglichkeiten aufgezeigt, wie im Hier und Jetzt der aktuellen therapeutischen Beziehung konkret mit Übertragungsprozessen gearbeitet werden kann. Es ist vielleicht kein Zufall, dass gerade in diesem Punkt neuere Strömungen der Psychoanalyse Vorgehensweisen entwickelt haben, wie sie in sehr ähnlicher Form bereits von der Selbstpsychologie verwendet werden.
Meine Hoffnung beim Schreiben dieser Arbeit war es, die äußerst komplexen Prozesse in der therapeutischen Beziehung angemessen zu beschreiben, auf wenig beachtete Aspekte hinzuweisen und so die Aufmerksamkeit für solche Vorgänge zu schärfen. Darüber hinaus wünsche ich mir, dass immer mehr Psychoanalytiker und Therapeuten anderer Schulrichtungen die nötige kritische Ehrlichkeit sich selbst, den Patienten und ihren Kollegen gegenüber aufbringen. Ihre Patienten würden es ihnen danken und sie selbst könnten bei Ihrer therapeutischen Arbeit authentisch, natürlich und lebendig bleiben. Dreiundzwanzig Jahre nach dem Erscheinen der ersten Auflage habe ich zahlreiche Stellen, die nicht mehr zeitgemäß waren, stark verändert bzw. gestrichen. Da die Gegenübertragung in der fachlichen Öffentlichkeit inzwischen einen enormen Stellenwert einnimmt, habe ich mich entschlossen, ein kurzes Kapitel über den Umgang mit der Gegenübertragung hinzuzufügen.
| Augsburg, im Herbst 2021 | Siegfried Bettighofer |
1 Mir ist bewusst, dass Psychotherapie inzwischen immer mehr von Therapeutinnen ausgeübt wird und dass die überwiegende Anzahl der Patienten nach wie vor Frauen sind. Dennoch möchte ich auf eine gendergerechte Schreibweise verzichten und lasse die früher übliche maskuline Form stehen, um die Lesbarkeit des Textes nicht zu erschweren. Es sind trotz der Verwendung der männlichen Form selbstverständlich alle gemeint.