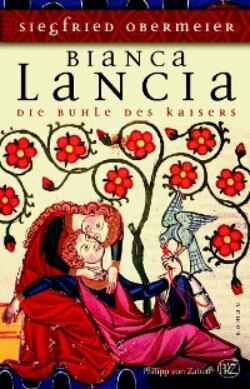Читать книгу Bianca Lancia - Siegfried Obermeier - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеIn seiner äußeren Erscheinung wie auch im inneren Wesen hatte Kaiser Friedrich von Vater und Großvater ein deutliches Erbe übernommen – im Guten wie im Schlechten. Vom Großvater Barbarossa hatte er das rötliche Haar, die Wohlgestalt und das helle, freundliche Wesen geerbt, auch Scharfsinn, Entschlossenheit und eine offene Hand wurden ihm und später seinem Enkel nachgerühmt. Grausamkeit und Strenge wandte Barbarossa nur an, wenn die Umstände ihn dazu zwangen.
Sein Sohn, Heinrich VI., geriet ganz und gar nicht nach ihm. In einem schmächtigen Körper wohnte ein scharfer Geist, der auf Macht und nur auf Macht ausgerichtet war. Sie war seine einzige Leidenschaft und um sie zu erhalten und auszuweiten, wandte er – vorsichtig ausgedrückt – bedenkliche Mittel an, die bis zu einer kaum zu beschreibenden Grausamkeit reichten. Großmut kannte er nicht und wenn er sie dennoch zeigte, so war eine politische Absicht damit verbunden. Seinen Sohn Friedrich hatte er nur zweimal kurz gesehen und als er – erst 31 Jahre alt – in Messina am Fieber starb, war Friedrich gerade drei Jahre alt geworden.
Auf einen kurzen Nenner gebracht: Kaiser Friedrich II. war seinem Großvater in seiner heiteren, gewinnenden Art sehr ähnlich, hatte aber vom Vater die unerbittliche, oft grausame Strenge übernommen, wenn es galt, politische Absichten durchzusetzen.
Für Grausamkeit, besonders in ihrer extremen Form, gibt es keine Entschuldigung. Noch zu verstehen ist es, wenn sie spontan auftritt, also etwa wenn der Sohn eines tückisch hingemordeten Vaters den Mörder in die Hand bekommt. Einige Tage später – ruhiger geworden – hätte er ihn vielleicht von einem Gericht aburteilen lassen, aber jetzt, in der ersten zornigen Anwandlung, das Leid des Vaters vor Augen, lässt er den Mörder grausam verstümmeln.
Zurück zu Kaiser Friedrich, der nach seiner Krönung in Eilmärschen nach Süden zog, um die dort während seiner langen Abwesenheit entstandenen Rechtsbeugungen zu beseitigen. Die süditalischen und sizilischen Feudalherren hatten sich durch Gewalt, zweifelhafte Schenkungen und nicht selten durch dreiste Urkundenfälschung Besitztümer und Rechte angeeignet, die ihnen nicht zukamen. Kaiser Friedrich wusste das längst, die Klagen der Betroffenen waren schon während seines Aufenthalts in deutschen Landen zu ihm gedrungen. Schnell entschlossen und von erfahrenen Beratern unterstützt, hatte der Kaiser schon hier begonnen, Gesetze zur Neuordnung Siziliens auszuarbeiten. Wenn vom Königreich Sizilien die Rede ist, dann war damit freilich auch das um einiges größere Süditalien gemeint, das im Nordwesten an den Kirchenstaat und das Herzogtum Spoleto grenzte, wo Friedrich übrigens seine ersten Lebensjahre bei der Gattin Konrads von Urslingen verbracht hatte. Seine spätere Geliebte Adelheid entstammte dieser Familie.
In Capua nun, der ersten großen Stadt des Königreichs Sizilien, wurden die inzwischen fertiggestellten Gesetze verkündet – und nicht nur das: Sie wurden auf eine derart rigorose Weise durchgesetzt, dass dem Feudaladel der Atem stockte. Die wichtigste Bestimmung der sogenannten Assisen von Capua „De resignandis privilegiis“ erklärte alle vor 1189 erfolgten Vorgaben, Schenkungen und Verfügungen für ungültig. Freilich hatte es schon Herrscher gegeben, die neue und strenge Rechte verkündet, aber ihre Durchführung kaum noch überwacht hatten. Wer bei Friedrich mit einem solchen Verhalten rechnete, spielte ein gefährliches Spiel. Da wurde nicht auf die Einsicht der Betroffenen gesetzt, sondern Beamte – geschützt durch Bewaffnete – erschienen an Ort und Stelle, prüften sorgfältig die Dokumente, wobei alles Zweifelhafte eingezogen wurde. Die Klugen spürten es sofort, die meisten aber erkannten erst später, dass damit das Feudalsystem auf rigorose Weise eingeschränkt oder fast schon beseitigt war.
Nach dieser kurzen, aber doch notwendigen Darstellung des Königs und Kaisers als Gesetzgeber und Umwandler wenden wir uns wieder dem Menschen Friedrich zu. Die ihm vom Papst erwählte, ungeliebte, aber hochgeachtete Kaiserin Konstanze war inzwischen in Capua gestorben – kaum vierzig Jahre alt. Die eheliche Gemeinschaft mit ihr hatte Friedrich auf gelegentliche Besuche und Mahlzeiten beschränkt. Ihr Ehebett blieb kalt, ihre Pflicht hatte sie mit der Geburt des Thronfolgers erfüllt. Das hieß freilich nicht, dass Friedrich andere Frauen mied. Sie machten es ihm leicht, er brauchte nur auszuwählen. Dazu kam, dass er den Frauen – wer immer sie sein mochten – anders gegenübertrat als den Männern, denen er von vornherein misstraute. Da wurde geprüft und erwogen, da zog er Petrus de Vinea oder Hermann von Salza zu Rate, bis er sicher sein konnte: Dieser Mann ist nach bestem Wissen gewogen und wurde nicht zu leicht befunden, jetzt kann ich ihm vertrauen und eine Aufgabe übertragen. Umso schlimmer war es dann, wenn einer dieser Vielgeprüften später Verrat beging. Da wandelte Friedrich sich zur rächenden Furie, ohne sich dabei zur schnellen Vernichtung des Verräters hinreißen zu lassen – nein, der Unselige wurde von Kennern ihres Faches wochen-, ja monatelang auf eine Weise geschunden, die schaudern machte. Das sollte anderen zur Warnung dienen, doch wer zum Verrat entschlossen ist, hofft es besser und erfolgreicher zu machen als die anderen.
Bei Frauen aber gelang es Friedrich, den Kaiser und König abzustreifen, um Mann zu sein und dabei eine Unbefangenheit an den Tag zu legen, die vergessen ließ, wie viel Vorgängerinnen es gab. Jede der Erwählten fühlte sich und nur sich gemeint, auch wenn die Beziehung nur eine Nacht dauerte. Später stand es ihnen frei, reich beschenkt zu gehen oder rundum versorgt zu bleiben, doch das kostete sie die Freiheit. Was anfangs nur leise gemunkelt oder scherzhaft umschrieben wurde, hatte sich in späteren Jahren zur Gewissheit verdichtet: Kaiser Friedrich unterhielt einen Harem. Das waren etwa ein Dutzend Frauen, die jedoch wechselten. Kam ein Kind, sorgte Friedrich für seine Ausbildung und suchte – wenn die Frau es wünschte – einen Ehemann. All dies tat er auf eine Art, die niemand kränkte oder veranlasste, sich ausgenützt zu fühlen.
Unter all diesen Frauen gab es freilich keine Adelheid. Als Trost blieb nur Enzio, der seinem neunten Geburtstag entgegensah, als sein Vater sich aufmachte, die dreizehnjährige Jolanda von Brienne zu freien. Ihr Vater Jean trug den an sich wertlosen, aber doch bedeutsamen Titel „König von Jerusalem“ und hatte zugesagt, ihn nach der Heirat auf die Tochter und so auf deren Ehemann zu übertragen. Der Vorschlag zu dieser Ehe war wieder vom Papst gekommen, denn der uralte Honorius III. erwartete von einem Träger des Titels „König von Jerusalem“ eine Wiedergewinnung des Heiligen Landes mit den hochbedeutsamen christlichen Erinnerungsstätten, als wichtigste das Grab Jesu. War die erste von einem Papst arrangierte Heirat mit einer um zehn Jahre älteren Braut geschlossen worden, so ging mit Jolanda von Brienne ein dreizehnjähriges Kind auf die Brautreise.
Zuvor aber hatte der Kaiser, beraten von Hermann von Salza, lange nachgedacht, welche Vor- oder Nachteile diese Ehe mit sich brachte. Die Nachteile lagen auf der Hand: Die Braut war arm und eine Mitgift von Geldeswert kaum zu erwarten. Auch politisch war diese Verbindung ohne Belang, aber die zu erwartende Würde eines Königs von Jerusalem überstrahlte alles. Einmal zu diesem Schritt entschlossen, trieb Friedrich, wie es seine Art war, die Vorbereitungen ungeduldig voran. Zwar hielt er es mit seiner kaiserlichen Würde für unvereinbar, der Braut entgegenzureisen, doch er begab sich nach Brindisi, um dort die Ankunft ihrer Schiffe zu erwarten. Zuerst aber erfolgte in der Heiligkreuzkirche von Akkon eine Art Ferntrauung und ein Bischof steckte der Braut stellvertretend den Ring des Kaisers an den Finger. Dann ging es nach Tyros, der zweiten Stadt, die mit Akkon vom Königreich Jerusalem geblieben war.
Dort wurde die inzwischen Vierzehnjährige zur Königin von Jerusalem gekrönt und was vom chistlichen Adel noch übrig war, huldigte ihr. Jolanda ließ dies alles mit mühsam beherrschtem Gesicht über sich ergehen, aber als sie ihr Schiff bestieg, brach sie in Tränen aus und rief:
„Ich empfehle dich Gott, mein geliebtes Syrien, das ich niemals wiedersehen werde.“
Sie sollte recht behalten, aber wenn sie gewusst hätte, wie wenig Gutes sie in Italien erwartete, wäre sie wohl lieber in ein Kloster gegangen. Um am kaiserlichen Hof nicht als Fremde unter Fremden dazustehen, hatte sie einige vertraute Hofdamen mitgenommen, darunter die um einige Jahre ältere Anais, eine entfernte Verwandte. Das schwarzlockige und glutäugige Mädchen hoffte am Hof des Kaisers einen Ehemann zu finden, der mehr auf ihre Schönheit und weniger auf die kaum vorhandene Mitgift achtete.
In Brindisi erwartete der Kaiser mit dem Brautvater das Anlegen des Schiffes. Ein steifer, kalter Herbstwind blähte ihre Kleider zu grotesken Formen und die anwesende Geistlichkeit hatte alle Hände voll zu tun, um ihre bodenlangen Prunkgewänder schicklich am Körper zu halten. Während Friedrich seine Braut auf beide Wangen küsste, erblickte er hinter ihr eine junge Frau, deren schwarze Augen sich nicht züchtig senkten, sondern den seinen keck standhielten und dabei begehrlich glitzerten – so glaubte er es deuten zu müssen. Das war Anais, Hofdame und Verwandte der Braut und um einiges älter als sie.
Jean de Brienne, der Brautvater, hatte sich alles ein wenig anders vorgestellt. Noch während der Festvorbereitungen erfuhr er von Friedrichs Absicht, gleich nach der Hochzeit den Titel des Königs von Jerusalem zu übernehmen. Zudem forderte er die Herausgabe der 50.000 Silbermark, die der inzwischen verstorbene französische König Philipp August dem bisherigen Titularkönig überlassen hatte – zur Wiedergewinnung des Heiligen Landes. Schließlich sei er es, beharrte Friedrich, der demnächst das Kreuzzugsgelübde erfüllen werde, und da habe er das Geld bitter nötig. Es kam zu einem bösen Streit mit Jean de Brienne, der sich von Friedrich ernsthaft bedroht fühlte. Bei Nacht und Nebel floh er nach Rom, wo der Papst ihn zur Neutralität bewegte, um Friedrichs weiteres Vorgehen abzuwarten.
Für Jolanda war dies alles sehr bedrückend; auch die Wohnverhältnisse in Brindisi waren so beschränkt, dass der Kaiser ihr syrisches Gefolge – bis auf zwei Zofen – im Zeltlager vor der Stadt unterbrachte. Ob ihn dabei schon ein gewisser Hintergedanke leitete, muss offen bleiben.
So fand die Hochzeit im Dom von Brindisi ohne Jean de Brienne statt und ein syrischer Graf musste statt seiner die Braut zum Altar führen. Am Abend beim Hochzeitsbankett saß Jolanda wie ein verheultes Kind neben dem Kaiser, der immer wieder zu Anais schaute, die schräg gegenübersaß. Wenn ihre Blicke sich fanden, flog ein leises Lächeln über das schöne Gesicht der Syrerin. Einige bemerkten es und dachten sich ihren Teil, Jolanda aber war so in ihren Kummer versunken, dass sie nichts davon spürte. Zudem glaubte sie, dass ihr das Schlimmste noch bevorstand – die Nacht mit ihrem Gemahl. Wenig später sollte sie erfahren, dass sie sich umsonst geängstigt hatte. Zwar begleitete sie Friedrich ins Brautgemach, doch dann küsste er sie nur auf beide Wangen und verneigte sich.
„Jolanda, meine Liebe, nach dem Wunsch des Heiligen Vaters und um der Krone Jerusalems willen habe ich nicht gezögert, mit Euch den Ehebund zu schließen. Mit Rücksicht auf Euer zartes, noch der Kindheit nahes Alter halte ich es für besser, die Hochzeitsnacht etwas aufzuschieben – Euer Einverständnis vorausgesetzt.“
Die Erleichterung war ihr anzusehen, als sie mit leiser Stimme sagte:
„Wie Ihr wünscht, mein Gemahl, vielleicht ist es tatsächlich besser, noch etwas zu warten.“
Er verneigte sich nochmals und lächelte verständnisvoll.
„Dann wünsche ich Euch eine gesegnete Nacht.“
In einem Nebenraum wartete schon sein Diener mit einfacher, unauffälliger Kleidung. Mit ein paar Vertrauten ritt der Kaiser zum Lager vor der Stadt. Die Leibwache vor seinem Zelt salutierte und dann trat der Capitano hinzu und verneigte sich tief.
„Ein Gast erwartet Euch, Majestät.“
Friedrich nickte, betrat sein Zelt, legte seinen Mantel ab und schlug den Vorhang zur Schlafecke zurück.
„Anais, du bist gekommen!“
„Das wolltet Ihr doch …“
„Nicht alles, was der Kaiser, was ein Mann will, geschieht dann auch.“
„Wie war die Hochzeitsnacht?“
Friedrich setzte sich aufs Bett und küsste Anais auf beide Wangen.
„So war sie.“
„Nur zwei Küsse?“
„Jolanda ist ein Kind und ich werde jetzt die Rolle des Bischofs von Akkon übernehmen.“
Anais richtete sich auf und fragte misstrauisch:
„Wie soll ich das verstehen, Majestät?“
Friedrich lächelte.
„Die Majestät lassen wir jetzt beiseite. Ganz einfach: Der Bischof von Akkon hat mich bei der Ehezeremonie vertreten und Jolanda statt meiner den Ring angesteckt. Du aber wirst sie in der Hochzeitsnacht vertreten – wenn du willst …“
Und ob sie wollte! Anais war nicht unerfahren, hatte am leichtlebigen syrischen Hof so manchen Liebhaber beglückt und als der Kaiser sie bei der Ankunft in Brindisi ansah, da dachte sie: Ich gehöre dir. Jetzt durfte sie es laut sagen:
„Ich gehöre dir, Federico.“
Friedrich erhob sich und sah, wie sein Leibdiener den Kopf hereinsteckte und ihn fragend ansah.
„Scher dich fort!“ Da er dabei schmunzelte, wusste der Diener Bescheid – aus langer Erfahrung.
Friedrich blies die Öllampen aus bis auf eine, deren Flackern über das Gesicht der schönen Anais geheimnisvolle Schatten huschen ließ. Friedrich kleidete sich schnell aus, schlug die Decke aus rötlichem Fuchsfell zurück und betrachtete den nackten Frauenkörper.
„Weißt du, wie schön du bist? Als hätte Gott dich zum Muster erschaffen, nach dem er alle anderen Frauen bilden wollte.“
„Was er aber nicht getan hat.“
„Vielleicht abgelenkt durch andere Pflichten …“
Er beugte sich über sie und küsste zuerst zart, dann immer heftiger den nackten Körper, als wolle er ihn sich einverleiben, ihn sich zu eigen machen. Gesicht, Schultern, Brüste, Bauch, Schenkel, Knie, Waden herab zu den Zehen, nur das schwarze Dreieck ließ er aus.
„Jetzt habe ich jeder Stelle deines Körpers mein Siegel aufgedrückt und so gehörst du mir – nur mir allein!“
Anais hatte ihre Augen geschlossen und schlug sie nun plötzlich auf. Diese dunklen Spiegel versetzten Friedrich in solches Entzücken, dass er versucht war, auch sie, die offenen Augen, zu küssen. Da hörte er ihre leise Stimme.
„Du hast nicht alles versiegelt …“
„Ich weiß, aber dazu verwende ich das große, geheime und nur den Frauen vorbehaltene Siegel.“
Sie öffnete die Schenkel, krallte sich in seine Hüften und ihr Atem ging schnell und schneller. Als er in sie eindrang, seufzte sie tief, fast schmerzlich auf.
„Ja“, stöhnte sie, „ja, ja, ja …“
Es wurde eine bewegte Nacht und erst bei Morgengrauen schlief Friedrich ein. Als der Leibdiener hereinschlich, stand draußen eine müde Herbstsonne schon schräg am Himmel, doch sie wärmte nicht, da von der See ein steifer, eisiger Wind kam.
Der Platz neben ihm war leer, die Stelle fühlte sich kalt an. Der Diener ahnte, was sein Herr dachte, aber er schwieg. Er war es gewohnt, nur auf Fragen zu antworten, doch der Kaiser ließ sich schweigend ankleiden, nachdem der Diener ihn mit einem nassen, duftenden Schwamm von Kopf bis Fuß abgerieben hatte.
Einige Tage später brach die Hofgesellschaft nach Melfi auf, wo der kaiserliche Palazzo vor kurzem fertiggestellt worden war, als einer von vielen Palast- und Kastellbauten, die geplant, schon im Bau oder fast vollendet waren. Die wichtigsten und auch am weitesten fortgeschrittenen Bauprojekte lagen im Tavoliere di Puglia mit der Stadt Foggia als Mittelpunkt. Diese Bezeichnung wäre als „Apulisches Tafelland“ zu übersetzen und es stellt sich die Frage, warum Kaiser Friedrich dieses nicht sehr anziehende Flachland so bevorzugte.
Das hatte mehrere Gründe. Der politisch wichtigste war die Mittellage. Von hier aus war die Lombardei ebenso schnell zu erreichen wie Sizilien, das Friedrich wegen der abgelegenen Insellage nicht so günstig erschien. Was aber waren die anderen Gründe, warum fühlte der Kaiser sich hier so wohl, dass man den Tavoliere mit gutem Grund als seine „Lebenslandschaft“ bezeichnen kann?
Dieses Gebiet entsprach seinem Wesen, seinen geistigen Bedürfnissen. Die wirre, schroffe Unübersichtlichkeit von Bergländern stieß ihn ab. Es war die überschaubare Klarheit, die ihn anzog. Freilich begann gegen Süden ein flaches, dicht bewaldetes Hügelland mit sanften, offenen Tälern und das war sein Jagdgebiet, hier ließ er seine Falken aufsteigen. Eine bunte Gruppe von amici Caesaris begleitete ihn dabei und auf Friedrichs Wunsch galt während der Jagd keine andere Rangfolge als die von guten oder schlechten Waidmännern. Letztere waren schnell ausgesondert und was dann blieb, war eine verschworene Gemeinschaft von Jägern aus Leidenschaft.
Kam Friedrich zurück nach Melfi, so empfing ihn Anais mit offenen Armen und einem vor Freude flackernden Blick. Wo aber war Königin Jolanda geblieben? Da sie das lockere und heitere Treiben zwischen Melfi und Foggia nur gestört hätte und ihre Hofdame Anais zur festen Konkubine geworden war, hatte Friedrich sie nach Terracina verbannt, wo sie in einem streng bewachten Schloss lebte, umgeben von allem erdenklichen Luxus. Dort wartete sie auf den Besuch ihres Gemahls und auf den endlichen Vollzug ihrer Ehe.
Anais, mit dem Egoismus einer verliebten Frau, fand das ganz richtig so, ohne zu vergessen, dass sie concubina auf Zeit war und sie eines – hoffentlich noch sehr fernen Tages – der Königin oder einer neuen Geliebten würde weichen müssen. Natürlich wusste sie längst, dass es vor ihr schon eine Reihe anderer Frauen gegeben hatte, aber es erging ihr wie fast allen ihren Vorgängerinnen: Wenn Friedrich bei ihr war, verhielt er sich so, als sei sie die Einzige, die er jemals wirklich geliebt hatte. Er selber musste sich eingestehen, dass Anais nach Adelheid die erste Frau war, die sein Herz gewann und nicht nur seiner Lust diente. Der Kaiser dachte nicht daran, die Geliebte zu verstecken oder ihre Verbindung zu verheimlichen. Gab es ein Bankett, an dem – was allerdings selten geschah – auch Frauen teilnahmen, so saß Anais zwar nicht an seiner Seite, doch in nächster Nähe. Das brachte es dann mit sich, dass gewisse Leute sie als Machtfaktor sahen, weil sie glaubten, wer mit dem Kaiser das Bett teilt, der kann ihm gegenüber auch Wünsche äußern. Anais aber war im Orient aufgewachsen, wo sich auch die meisten christlichen Familien dem Landesbrauch fügten und den Frauen ausschließlich die Macht über den Haushalt und die weiblichen Dienstleute zugestanden. So wies Anais die Bittsteller niemals schroff ab, sondern erklärte sich einfach nicht für zuständig und schlug vor, sich an die Sekretäre des Kaisers zu wenden.
Die schönen Jahre im befriedeten Königreich Sizilien neigten sich dem Ende zu, als aus Rom immer schärfere Aufforderungen kamen, den Kreuzzug endlich zu beginnen. Papst Honorius hatte das achtzigste Lebensjahr schon überschritten und wollte seinen Herzenswunsch endlich verwirklicht sehen. So tat der Kaiser das Nächstliegende und begann im deutschen Reich für den Kreuzzug zu werben. Hermann von Salza reiste mit einem Sack voll Gold dorthin, aber es war schwer, die deutschen Fürsten für dieses doch so gottgefällige Werk zu gewinnen. Wer zusagte, ließ sich kaufen und das sizilianische Gold schmolz dahin wie Schnee in der Frühjahrssonne.
Auch Friedrich war nach Norden gereist, wo er für Ostern 1226 in Cremona einen Reichstag einberief. Sein Sohn König Heinrich sollte mit den deutschen Fürsten dort erscheinen, dazu die Abgeordneten der lombardischen Städte. Als Grund für den Reichstag nannte der Kaiser die Wiederherstellung der Reichsrechte in Italien, vor allem aber die Klärung der lombardischen Verhältnisse. Um den Papst milde zu stimmen und die Unterstützung der Kurie zu gewinnen, wurden zwei weitere Themen genannt: Bekämpfung der Ketzerei und Vorbereitung zum Kreuzzug.
Als Friedrich von Süden und sein Sohn Heinrich von Norden heranzogen, führten sie Truppen mit sich, was das Misstrauen der guelfischen Kommunen verstärkte. So bildeten zwölf lombardische und venetische Städte unter mailändischer Führung eine Liga, denn sie fürchteten, die vom Kaiser in Sizilien angewandten Gewaltmaßnahmen. Ihre erste Handlung war, die Gebirgspässe zu sperren, sodass König Heinrich mit seinen Truppen nicht weiterziehen konnte. In Friedrichs Augen war das Hochverrat, doch er war machtlos und das geplante Strafgericht musste verschoben werden. Die kaisertreuen Städte hatten ihre Vertreter nach Cremona geschickt und für sie veranstaltete Friedrich ein Abschiedsbankett.
Galvano, seit zwei Jahren Oberhaupt der Familie Lancia, kam als Führer einer Abordnung aus Pisa und hatte seine zwölfjährige Schwester Bianca mitgebracht. Für die Familie war sie die „Zwölfjährige“, sie selber nannte sich „fast dreizehn“, doch bis dahin war es noch ein halbes Jahr.
Bei der Familie Lancia hatte sich während der letzten Jahre einiges verändert. Don Bartolomeo, der Großvater, war plötzlich gestorben. Er hatte sich eines Morgens an sein Schreibpult gesetzt, um etwas zu notieren, als ihn ein Schlagfluss überraschte und seinen Kopf auf das Pult sinken ließ. In der rechten Hand hielt er noch die Schreibfeder, die er gerade zugespitzt hatte und in das offene Tintenfass tauchen wollte. Er starb wohl in Frieden, denn er hatte noch erleben dürfen, dass Giulia – Galvanos Gemahlin – den Sohn Federico zur Welt brachte. Giordano, jetzt siebzehn, war der hitzige Raufbold geblieben, der er schon als Kind gewesen war, doch es gab kaum noch Schwierigkeiten, da er sich bei den Zusammenkünften der Bürgerwehr, bei Wett- und Schaukämpfen austoben konnte. Er war schnell beleidigt, aber ebenso schnell zur Versöhnung bereit, was ihm viele Freunde einbrachte.
Bianca hatte sich mit den Jahren zu einer Schönheit entwickelt, die nicht ins Auge sprang, sondern erst beim zweiten Blick erkennbar wurde. Nach wie vor steckte sie mit Berta unter einer Decke und noch immer sprachen sie Deutsch miteinander. Der heimliche Kummer ihrer früheren Amme aber war, dass Biancas Regel ausblieb. Nach außen wirkte sie mit ihrem schönen, ernsten Gesicht, den kleinen, runden Brüsten und den lieblich geschwungenen Hüften wie eine junge Frau, aber dazu passte nicht – wie Berta meinte –, dass Bianca zwischen den Schenkeln trocken blieb wie eine verdorrte Frucht. Um sie nicht zu verstören, sprach Berta nur auf Umwegen über dieses Thema, etwa wenn sie von dem Volksglauben erzählte, dass das Regelblut der Frauen vor Fieber und Fallsucht schütze, ja sogar imstande sei, Blitz, Hagel und Sturm abzuwehren. Sie tat das in der Hoffnung, Bianca möge nachfragen, was Regelblut sei und so war es dann auch.
„Wenn ein Mädchen zur Frau wird, dann geschieht allmonatlich etwas, vor dem du keine Angst zu haben brauchst. Aus deinem Gröttchen sickert ein wenig Blut, das hört dann nach drei oder vier Tagen auf …“
Bianca hörte mit gerunzelter Stirne zu und fragte:
„Zu was soll das gut sein?“
„Ja, das weiß ich auch nicht. Jedenfalls können Frauen von da an Kinder kriegen. Wie es dazu kommt, habe ich dir ja schon erklärt.“
Das hatte sie tatsächlich, doch Bianca war nicht sehr interessiert gewesen. Was Männer mit Frauen trieben, gehörte für sie in eine andere, noch sehr ferne Zeit. Aus eigener Erfahrung hatte Berta ihr den Vorgang als nicht sehr erfreulich – was die Frauen betraf – geschildert, aber doch als notwendig zur Erhaltung der Menschheit.
Von Berta hatte Bianca im Laufe der Jahre so manches über das Zauberwesen erfahren und wusste einiges über die heilenden oder auch Schaden bringenden Kräfte von Tieren, Pflanzen, Steinen und Metallen. Sie trug ein von Berta gefertigtes Amulett am Hals, wusste aber nicht, was die Kapsel enthielt, und wurde belehrt, dass die Wirksamkeit umso höher sei, je weniger man darüber wisse. Nur so viel könne man sagen: Das Amulett sei aus Bernstein gefertigt, der allein schon als mächtige Schadenabwehr gelte und zudem gegen jede Art von Halserkrankungen schütze. Für sehr wichtig hielt Berta, dass man die Eigenschaften der Wochentage kenne und sich danach verhalte.
„Der Montag“, so verkündete sie, „ist ein Unglückstag! Da soll man nichts Wichtiges beginnen, kein Geld einfordern, keine Reise antreten, nicht an Begräbnissen teilnehmen. Wer sich daran hält, dem geht es nicht nur am Montag gut, sondern während der ganzen übrigen Woche. Der Dienstag bringt auch nichts Gutes, ist dem Kriegsgott geweiht – ein Männertag. Das gilt auch für den Mittwoch, denn an diesem Tag hat Judas seinen Verrat begangen. Da soll man ebenfalls nichts Wichtiges unternehmen, vor allem kein Vieh austreiben oder verkaufen, auch nicht Hochzeit halten. Dazu ist der Donnerstag weit besser geeignet. Der Freitag ist zur Erinnerung an Christi Tod ein Tag der Besinnung, soll aber auch frei von Krankheiten machen. Der Samstag muss als Glückstag gelten, ist gut für Hochzeiten und große Unternehmungen, ist freilich auch der große Hexentag, an dem sie ihren Sabbat feiern. Ein Glückstag ist natürlich auch der Sonntag als Tag des Herrn. Glückskinder werden am Sonntag geboren und die armen Seelen sind frei vom Fegefeuer.“
Berta schwieg eine Weile und Bianca fragte:
„Daran glaubst du fest?“
Berta blickte unwillig auf.
„Was heißt schon fest? Alles liegt in Gottes Hand und wenn er es will, kann er auch die Unglückstage günstig gestalten.“
Das war ihre unerschütterliche Lebenseinstellung: alles, was die Weiße Magie – die keinem schadete – gebot und anriet, genau zu beachten, dabei aber beide Augen zum Himmel zu richten und auf Gott zu vertrauen.
Als Bianca gegangen war, seufzte Berta schwer. Was half das ganze Gottvertrauen, was nützte die Kenntnis der Weißen Magie, wenn ihr Augenstern nicht endlich zur Frau wurde? Ihres Wissens gab es kein Mittel – ob menschlicher, tierischer, pflanzlicher oder mineralischer Natur –, um diesen Vorgang zu beschleunigen. Freilich, einen wirksamen Liebeszauber hätte sie schon schaffen können, und da fiel ihr wieder das eigene Erlebnis ein, wo er jämmerlich versagt hatte. Sie lebte noch bei den Eltern am Rand von Innsbruck und hatte sich in einen Vetter verliebt, den sie bei Familienfesten öfter sah. Da der Vater als Innfischer sein Brot verdiente, fiel es ihr leicht, einen bestimmten Liebeszauber anzuzwenden. Sie stibitzte einen kleinen Fisch, der noch zuckte, ging auf den Abtritt und steckte das Tier in ihre Scheide, bis es sich nicht mehr regte. Sie tat das am Tag vor einer Tauffeier, da die ganze Sippe bei einem Festmahl versammelt war, und es gelang ihr, eben diesen Fisch mitzubraten und dem Vetter auf den Teller zu legen. Er verputzte ihn samt den Gräten, doch die Wirkung blieb aus. Freilich hatte die alte Kräuterhexe betont, dass nicht jeder Liebeszauber bei jedem wirke. Da müsse sie dann einen anderen versuchen. Berta schmunzelte in sich hinein. Wenn es bei Bianca so weit war – vom Fischzauber würde sie ihr abraten.
Bianca, in manchen Dingen ihre gelehrige Schülerin, kam schon früh zu einer anderen Anschauung. Obwohl sie es für gut hielt, die Regeln der Weißen Magie zu kennen, gründete sich ihre Lebenseinstellung – vom Großvater beeinflusst – auf das nach und nach erworbene Wissen über alles, was den Menschen betraf. Don Bartolomeo hatte ihr gesagt:
„Wer das Wesen der Menschen und sich selber kennt, ist für die Wege des Schicksals bestens gerüstet. Freilich gibt Seneca zu bedenken: Eunt via sua fata, und das sollst du niemals vergessen: Das Schicksal geht eigene Wege.“
So gesehen, war Bianca sicher die gelehrigste Schülerin ihres Großvaters gewesen, während ihre Brüder sich anders entwickelten. Galvano war der Art seines Vaters nachgeraten und handelte niemals überstürzt. Alles musste gründlich überlegt und erwogen werden, aber wenn ein Entschluss gefasst war, dann verfolgte er beharrlich seine Umsetzung.
Giordano, sein jüngerer Bruder, war anders geartet. Er handelte schnell und spontan, konnte Entschlüsse im letzten Augenblick ändern, war aber in ihrer Durchführung nicht weniger beharrlich als sein Bruder. Leider huldigte er nicht der Anschauung, vieles sei leichter mit Verstand und im Einvernehmen zu lösen, sondern baute auf die brachiale Gewalt. Führte sie zu Misserfolgen, so lag das seiner Anschauung nach an einer halbherzigen Durchführung. Er hätte eben härter zuschlagen müssen … Zu seiner Verteidigung sei gesagt, dass sich diese Einstellung mit den Jahren milderte und verfeinerte, was dazu führte, dass der erwachsene Giordano sich später bemühte, Probleme zuerst mit dem Kopf und nicht gleich mit der Faust zu lösen.
Wie aber fand Giulia Lancia, Galvanos Frau und Federicos Mutter, sich zwischen so unterschiedlichen Charakteren zurecht? Sie war nicht besonders gebildet, war dafür aber mit einem ausgeprägten weiblichen Instinkt gesegnet, der sie vieles ahnen und meist richtig vorhersehen ließ. Sie und Bianca begegneten sich mit kühlem Respekt, aber Giulias eigener Hausstand in einem angebauten Teil des Palastes machten diese Begegnungen selten. Dazu kam, dass Giulia jedes Jahr ein Kind zur Welt brachte, von denen am Ende nur Federico und zwei Töchter die ersten Jahre überlebten.
Was sie aber wirklich störte, war Biancas inniges Einvernehmen mit Berta, die sie gelegentlich eine strega nannte – freilich stets hinter vorgehaltener Hand und niemals in Biancas Gegenwart. Sie mochte ihren Galvano, ertrug geduldig die häufigen Schwangerschaften und ließ die Familie niemals spüren, dass das Erbe nach dem Tod ihrer Eltern die nicht übermäßig begüterten Lancia zu einer sehr wohlhabenden Familie machen würde. Wenn sie darauf auch niemals nur mit einem Wort anspielte, so wusste sie doch, dass die anderen es auch wussten. Als Mutter des Stammhalters Federico und als einzige Erbin ihrer steinreichen Eltern war ihre Stellung in der Familie so unerschütterlich fest, dass sie über Biancas Eigenheiten großzügig hinwegsah.