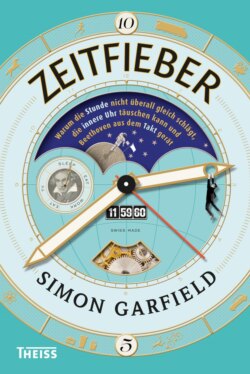Читать книгу Zeitfieber - Simon Garfield - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 2 Wie die Franzosen den Kalender verkorksten Tag der Birne
ОглавлениеBovist, Walnuss, Forelle, Flusskrebs, Färberdistel, Otter, Felsensteinkraut, Trüffel, Zuckerahorn, Weinkelter, Pflug, Orange, Kardendistel, Kornblume, Schleie. Ende Januar 2015 stellte Ruth Ewan die letzten ihrer 360 Objekte in einem großen hellen Raum auf, dessen Fenster auf die Finchley Road in London blickten, und versuchte so, die Zeit zurückzudrehen. Die 1980 in Aberdeen geborene Künstlerin beschäftigt sich sehr mit der Zeit und deren radikalen Zumutungen, und dieses neue Projekt namens Back to the Fields stellte eine dermaßen gewagte und verunsichernde Umkehr der Geschichte dar, dass ein unvorbereiteter Besucher vielleicht auf schwarze Magie vereint mit Wahnsinn getippt hätte.
Wie Hexerei sieht die Installation wirklich aus. Zu den Gegenständen, die hauptsächlich auf dem Parkettboden lagen, gehörten auch Winterkürbisse, Zuckerwurzeln, Eibisch, Gartenschwarzwurzeln, ein Brotkorb und eine Gießkanne. Einige frische Waren verdarben im Klima eines Innenraums schnell, also gab es gelegentlich Lücken im Ensemble. Trauben faulen beispielsweise rasch; dann war es Sache der Künstlerin oder eines der Mitarbeiter am Camden Arts Centre, in einen nahen Supermarkt zu gehen und sie zu ersetzen. Die Gegenstände erinnerten an ein riesiges Erntedankfest in der Kirche, hatten aber eine ausgesprochen unreligiöse Absicht. Und sie waren auch nicht zufällig gewählt oder angeordnet. So war die Wintergerste etwa absichtlich durch Lachs und Tuberose von der sechszeiligen Gerste getrennt, und der Zuchtchampignon stand sechzig Gegenstände von der Schalotte entfernt.
Unterteilt waren die Stücke in Gruppen zu jeweils dreißig, was für die Tage im Monat stand. Jeder Monat war in drei Wochen zu zehn Tagen untergliedert, wobei es für die Zahl der Tage in einem Jahr bei den üblichen 365 oder 366 blieb. Die fehlenden fünf bzw. sechs Tage in der neuen Berechnung wurden mit Festtagen aufgefüllt: gewidmet Tugend, Talent, Arbeit, Meinung, Lohn sowie in Schaltjahren noch Revolution. Aber eine Revolution war das ganze Konzept, und auf alle Fälle mehr als nur ein ausgefeiltes, provokantes Stück Kunst – es handelte sich um die anschauliche Darstellung des Gedankens, dass die Zeit ganz von vorn beginnen könnte, des Moments, in dem der Moderne im Feld der Natur die Pferde durchgingen.
Ruth Ewan vollzog den Kalender der Französischen Republik nach. Dabei handelte es sich um eine politische und zugleich akademische Absage ans Ancien Régime und um die praktische Schlussfolgerung aus der einleuchtenden Theorie, gleichzeitig mit der Einnahme der Bastille und der Tuilerien müsse man zum Sturm auf den hergebrachten christlichen Gregorianischen Kalender ansetzen.
Erstaunlicherweise setzte sich dieser neue Kalender eine Zeit lang durch (oder vielleicht ist das auch nicht so erstaunlich – noch immer glänzte ja die Guillotine feucht in der Herbstsonne). Offiziell in Kraft trat er am 24. Oktober (am Poire, dem Tag der Birne, im Brumaire) 1793, wurde allerdings rückdatiert auf den 22. September (den Raisin, Tag der Traube, des Vendémiaire) 1792, der zum Ausgangspunkt des Jahres I der Republik wurde. Diese radikale Praxis hielt sich über zwölf Jahre, bis zum 1. Januar 1806, als sich Napoleon Bonaparte vermutlich dachte, ça suffit.
Außerhalb dieses von Landwirtschaft und saisonalen Pflanzen geprägten Raums im Nordwesten Londons befand sich eine zweite Wiederbelebung aus den Händen Ruth Ewans, die hoch an der Wand hing: eine Uhr mit nur zehn Stunden. Sie beruhte auf einem weiteren revolutionären und zum Scheitern verurteilten französischen Experiment, die Zeit umzuformatieren – auf der Dezimalisierung des Zifferblatts, einer vollständigen Umgestaltung des Tagesablaufs.
Vier Jahre zuvor hatte Ewan eine ganze Stadt mit ihren falschen Uhren zu verwirren versucht. Auf der Triennale von Folkestone im Jahr 2011, einer Veranstaltung, die sich ganz und gar darauf verlässt, dass die Zeit gleichmäßig und berechenbar vergeht, standen strategisch über die Stadt verteilt gleich zehn ihrer Zehn-Stunden-Uhren, darunter eine auf dem Kaufhaus Debenhams, eine oben am Rathaus, eine in einem Antiquariat und eine weitere in einem Taxi.
Einige Minuten lang schien die Zehn-Stunden-Uhr einen Sinn zu haben oder immerhin so viel Sinn wie die Zwölf-Stunden-Version. Der Tag war auf zehn Stunden reduziert, wobei jede Stunde in 100 Minuten unterteilt war und jede Minute in 100 Sekunden. (Eine Revolutionsstunde war damit zwei übliche Stunden und 24 Standardminuten lang, während eine Revolutionsminute eine Standardminute und 26,4 Standardsekunden dauerte.) Die Mitternachtsstunde 10 stand oben, die Mittagsstunde 5 unten auf dem Zifferblatt, und wer an die normale Zwölf-Stunden-Anzeige gewöhnt war, konnte im Grunde nur raten, was acht Minuten vor vier auf der Revolutionsskala waren. Die Franzosen – oder zumindest jene französischen Bürger, für die die genaue Zeit in den 1790er-Jahren wichtig war und die sich eine neue Uhr leisten konnten – rangen 17 Monate lang damit, mit der neuen staatlich verordneten Uhr zurechtzukommen, dann schüttelten sie sie ab wie einen schlimmen Traum. Geblieben ist ein historischer Anachronismus, immerhin einer, auf den Zwangsneurotiker gelegentlich zurückkommen, so wie die, die Australien auf die Oberseite des Globus verschieben wollen.1
Wie mir Ewan erzählte, ließ sie die Uhren anfertigen, weil sie sehen wollte, wie sie aussahen; sie wusste von nur einem funktionsfähigen Exemplar in einem Schweizer Museum und von einer Handvoll in Frankreich. Als sie mit ihrer Idee jedoch an Uhrmacher herantrat, „wurde ich bloß ausgelacht“. Nachdem sie sechs oder sieben Uhrmacher abtelefoniert hatte, stieß sie auf eine engagierte Firma namens Cumbria Clock Company (deren Website als Spezialität „Turmuhrhorologie“ auswies und behauptete, das Personal schmiere ebenso gern Zahnräder in der kleinsten Kirche, wie es größere Probleme behebe, etwa an der Kathedrale von Salisbury und an Big Ben). Außerdem bot das Unternehmen Dienste wie „Nachtabschaltung“ an. Ein Zehn-Stunden-Uhrwerk hatte es noch nie gefertigt, geschweige denn zehn davon.
Ewans Unruhe stiftende Inszenierung in Folkestone trug einen grandiosen Namen: We Could Have Been Anything That We Wanted To Be. Der Titel stammte von einem Song aus dem Film Bugsy Malone, und außer der Botschaft „Wir hätten alles sein können, was wir wollten“ gefiel Ewan besonders die zweite Zeile: „And it’s not too late to change.“ Es war eindeutig nicht zu spät dafür, sich zu ändern. Die Uhren waren „ein altes Objekt, aber sie schienen auch von einer möglichen Zukunft zu sprechen“, sagt Ewan und legt damit den Finger auf das Wesen der Zeit an sich. „Ich wollte auf die Tatsache verweisen, dass wir diese Uhr einmal abgelehnt haben, dass sie aber erneut zum Thema werden kann.“
Sobald die Uhren montiert und öffentlich zugänglich sind, sind sie lachhaft schwer abzulesen. „Eine Menge Leute schauen drauf und sagen ‚alles klar, hab’s verstanden‘, aber sie merken, dass sie sie nicht komplett verstanden haben – sie lesen sie, als wäre sie eine 20-Stunden-Uhr und keine echte 10-Stunden-Uhr. Im Lauf eines Tages kreist der Stundenzeiger nur einmal, nicht zweimal.“
Zum Zeitpunkt unseres Gesprächs machte Ruth Ewans energische Zeitbesessenheit keine Anstalten nachzulassen. Gerade hatte sie einen Aufenthalt als Artist in Residence in Cambridge angetreten, wo sie zusammen mit Botanikern Carl von Linnés große Blumenuhr von 1751 analysierte. Linné (lateinisch Linnaeus), ein schwedischer Pflanzenkundler, hatte eine verzwickte Anordnung in Form eines kreisrunden Zifferblatts aus Pflanzen vorgeschlagen, die sich zu von der Natur vorgegebenen Tageszeiten öffneten und schlossen, so dass sie eine genaue (oder zumindest annähernd genaue) Zeitmessung erlaubten. Unter dem Einfluss von Licht, Temperatur, Regen und Luftfeuchtigkeit blühten jedoch die Pflanzen auf Linnés Liste in Uppsala (60 Grad nördlicher Breite) nicht alle während derselben Jahreszeit, also blieb die Uhr – wie viele Versuche während des 19. Jahrhunderts, sie in die Praxis umzusetzen, zeigten – weitgehend Theorie. Aber sie war wiedergeborene und neu gedachte Zeit, und die Namen ihrer Einzelteile haben einen ähnlich honigsüßen Klang wie jene, die vierzig Jahre später in Frankreich auftraten: Wiesen-Bocksbart (öffnet sich um 3.00 Uhr), Schwarze Flockenblume (öffnet sich bis 4.00 Uhr), Gemeine Wegwarte (4.00 bis 5.00 Uhr), Geflecktes Ferkelkraut (6.00 Uhr), Sumpf-Gänsedistel (bis 7.00 Uhr) und Ringelblume (15.00 Uhr).
Eine Künstlerin, die sich mit dem Neuerfinden der Zeit beschäftigt, steht vor manchem Dilemma, das den Druckgraphiker oder die Keramikerin von heute nicht ereilt. Das Kniffligste an Ewans Back to the Fields-Kalendervorführung war es, jene obskuren Pflanzen und Gegenstände zu bekommen, die in den letzten 200 Jahren an Beliebtheit verloren hatten. „Anfangs dachte ich, du kannst alles online bekommen, was du willst“, gesteht Ewan, „aber jetzt weiß ich, das kannst du nicht.“ Der letzte Gegenstand, der in die Ausstellung wanderte, war eine Worfel, eine Art Korb. „Vor nicht allzu langer Zeit gab es die wahrscheinlich überall, aber der einzige Ort, wo wir eine auftreiben konnten, war die Privatsammlung eines Oxforder Professors für Korbflechten. Man kann so etwas auf einem Bild von Millet sehen. Sie wurde wortwörtlich dafür verwendet, die Spreu vom Weizen zu trennen.“
Einer der Besucher von Ewans Ausstellung im Camden Arts Centre hat mehr Ahnung von den Verrenkungen der Zeit als die meisten anderen. Matthew Shaw, Kurator an der British Library, hat seine Doktorarbeit über das nachrevolutionäre Frankreich geschrieben und ein Buch daraus gemacht. Zusätzlich hat er sie in einen Vortrag von 45 Minuten gegossen, der mit Wordsworths berühmtem Stückchen Optimismus begann: „In diesem Morgenrot lebendig sein/War Wonne – jung zu sein der Himmel selbst!“2 Der Kalender, erklärte Shaw, sei ein Versuch gewesen, eine ganze Nation aus dem bestehenden Zeitablauf der Erde herauszulösen, die Geschichte neu zu starten und jedem Bürger ein gemeinsames und begrenztes kollektives Gedächtnis mitzugeben; er sei eine gute Methode gewesen, Ordnung in ein Land im Aufruhr zu bringen.
Shaw ging die säkularen Aspekte des Kalenders durch (der die religiösen Festzeiten und die Heiligenfeste abschaffte) und betonte dessen eingebaute Arbeitsethik – die Art, in der die Zeit umarrangiert wurde, um das vorindustrielle Frankreich auf den Feldern ebenso wie auf dem Schlachtfeld produktiver zu machen. Den Monat spaltete man in drei zehntägige décades auf und gewährte nur einen freien Tag alle zehn Tage statt einen je sieben Tage. Nach dem Ende des Sabbats stellte die Bevölkerung fest, dass der neue Ruhetag allerlei aktive Verpflichtungen mit sich brachte. „Die Aufmerksamen unter Ihnen werden feststellen, dass es hier ein Muster gibt“, sagte Shaw, während er seine Besuchergruppe herumführte. „An jedem fünften und zehnten Tag gibt es eine leichte Durchbrechung der Serie, entweder durch ein Tier oder durch ein Werkzeug. Am zehnten Tag sollen Sie sich alle in Ihrem Dorf versammeln, patriotische Lieder singen, die Gesetze laut vorlesen, zusammen ein großes Festmahl feiern – und etwas über die Spitzhacke lernen.“
Das war vielleicht einer der Gründe für das letztendliche Scheitern des Kalenders. Es gab allerdings auch andere, die eher auf astronomischem Gebiet lagen, etwa einen falschen Ansatz für die Tagundnachtgleiche, die Äquinoktien. Außerdem war es ein Kalender, der mehr als nur ein Kalender war: Er war politisch, radikal landwirtschaftlich ausgerichtet und zwang den Menschen sein ganz eigenes, fundamentales Geschichtsverständnis auf. Außerdem, so Shaw, „war es ziemlich schwer, damit ein Weltreich zu regieren“. Um die Sache weiter zu verkomplizieren, hatten auch die zwölf Monate neue Namen, die der extravagante Dichter und Stückeschreiber Fabre d’Églantine ausgesucht hatte (nicht lange danach wurde er wegen Finanzdelikten und seiner Nähe zu Robespierre guillotiniert; er starb am Tag des Salats). Der Brumaire, der „Nebelmonat“, dauerte vom 22. Oktober (dem Tag des Apfels) bis zum 20. November (dem Tag der Rasenwalze), während der Nivôse (der „Schneemonat“) vom 21. Dezember (dem Tag des Torfs) bis zum 19. Januar (dem Tag des Siebes) ging. Alles ganz einfach, wenn man es mal kapiert hat, was nur wenige französische Bürger taten – oder so taten, als wollten sie es tun.
Langsam kam Shaw ans Ende seines Rundgangs, und seine Zuhörer zerstreuten sich allmählich kopfschüttelnd. Er blieb beim 15. Februar stehen, den die Hasel vertritt. „Das passt sehr schön, weil wir gerade heute die Nachricht erhalten haben, dass Michele Ferrero im Alter von 89 Jahren gestorben ist, der sein Vermögen mit Nutella gemacht hat.“ Shaws vorletzter Stopp in diesem Raum war der 10. Thermidor. Das war der republikanische Hochsommer und jener Tag (der 28. Juli 1794), an dem Robespierre hingerichtet wurde. Die Schreckensherrschaft verschlang ihre eigenen Kinder. Für den fraglichen Tag stand eine Gießkanne.3