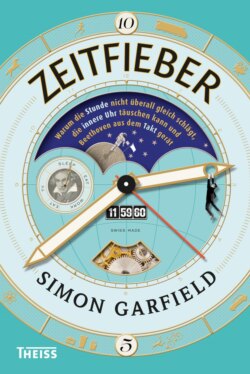Читать книгу Zeitfieber - Simon Garfield - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Kürze des Lebens und wie man es leben soll
ОглавлениеWer heute auf einer Krankenhausstation liegt und sich bemitleidet, täte gut daran, an Seneca vor 2000 Jahren zu denken.Über die Kürze des Lebens riet seinen Lesern, ihr Leben weise zu leben, will heißen, nicht leichtsinnig. Seneca sah sich um, und ihm gefiel es nicht, wie die Leute mit ihrer Zeit umgingen: „… den einen hält unersättliche Habsucht gefangen, den anderen in überflüssigen Anstrengungen mühevolle Betriebsamkeit, der eine ist vom Weine trunken, der andere verdämmert im Stumpfsinn.“ Der Großteil der Existenz, so folgerte er, verging nicht als Leben, sondern war „einfach Zeit“. Als er Mitte sechzig war, nahm sich Seneca (nicht ganz freiwillig) das Leben, indem er sich im Bad die Pulsadern aufschnitt.1
Die berühmteste Zeile in Senecas Abhandlung steht gleich am Anfang, ein Verweis auf den berühmten Ausspruch des griechischen Arztes Hippokrates: „Das Leben ist kurz, die Kunst ist lang.“ Was genau das bedeutet, ist immer noch umstritten (wahrscheinlich spielte Hippokrates nicht auf die Schlangen vor der tollen Gerhard-Richter-Ausstellung an, sondern darauf, wie viel Zeit es braucht, bis man ein Experte für irgendwas geworden ist), und Senecas Gebrauch des Satzes bestätigt, dass das Wesen der Zeit ein Thema war, das die Denker im antiken Griechenland und in Rom überaus fesselnd fanden. Etwa um 350 v. Chr. betrachtete Aristoteles die Zeit eher als eine Art der Anordnung denn als ein Maß, nämlich als eine Kombination, in der alle Dinge aufeinander bezogen sind. Die Gegenwart betrachtete er nicht als etwas Feststehendes, sondern als etwas Bewegliches, ein Phänomen in ständigem Wandel, das von der Vergangenheit und der Zukunft abhing (und eigenwilligerweise auch von der Seele). Um das Jahr 160 n. Chr. glaubte Marc Aurel an das Fließende: „Die Zeit ist ein Fluß aus allem, was geschieht, ja ein wilder Strom“, schrieb er. „Denn in demselben Augenblick, wo jedes Ding, das er mit sich führt, zum Vorschein kommt, ist es auch schon vorbeigetrieben, und schon treibt ein anderes vorüber, und schon kommt das nächste.“2 Augustinus von Hippo, der Heilige, der ein langes Leben von 354 bis 430 führte, fing in Worten jene Flüchtigkeit der Zeit ein, die bis heute die Quantenphysiker verwirrt: „Was also ist die Zeit? Wenn niemand mich danach fragt, weiß ich’s, will ich’s aber einem Fragenden erklären, weiß ich’s nicht.“3
Mein Ellbogen war im Sommer 1959 entstanden und an seinem 55. Geburtstag zertrümmert worden. Die Röntgenaufnahmen zeigten, dass er jetzt wie ein Puzzle aussah; die Knochen an meinem Gelenk waren zersplittert und in alle Himmelsrichtungen zerstreut wie fliehende Gefangene. Während der anstehenden Operation, die im Grunde eine Routineangelegenheit sein würde, wie man mir versicherte, sollten die Einzelteile zusammengetrieben und mit Drahtstücken festgehalten werden.
Die Armbanduhr, die ich im Augenblick des Unfalls trug, war ebenfalls in den 1950er-Jahren gemacht worden und ging pro Tag zwischen vier und zehn Minuten nach, abhängig davon, wie oft ich sie aufzog, und noch von anderen Sachen. Ich mochte an ihr, dass sie alt war (einer alten Uhr kann man vertrauen, weil sie seit Jahren dasselbe macht). Damit ich pünktlich zu Terminen kam, musste ich berechnen, wie viel genau meine Uhr wohl nachging. Ich hatte sie eigentlich zum Uhrmacher bringen wollen, aber irgendwie hatte ich anscheinend nie die Zeit dazu gehabt. Besonders gefiel mir die analoge Seite, die Federn und Zahn- und Schwungräder, die ohne Batterie auskamen. Aber was ich richtig mochte, war der Eindruck, dass die Zeit nicht bestimmen sollte, wie ich mein Leben führte. Die Zeit war vielleicht die zerstörerischste Kraft von allen, und wenn man sich vor ihren Auswirkungen schützen könnte, dann könnte man irgendwie ein Gefühl haben, Kontrolle auszuüben und das eigene Schicksal zu bestimmen, wenigstens die nächste Stunde lang. Das Allerbeste, die ultimative temporale Freiheit wäre natürlich, wenn ich meine Uhr verschenken oder aus dem Fenster eines Schnellzugs werfen würde.
Vier Minuten Zeit, ob zu schnell oder zu langsam – das war ein guter Stoff zum Nachdenken, wenn man im Dämmerzustand flach auf dem Rücken in einem dunklen Raum lag, in einem Boot durchs Schilf trieb, nach der Stelle suchte, wo man – wie es Clive James einmal in einem Gedicht ausgedrückt hat – seine Muscheln gegen Federn eintauschen kann. Ich bewunderte, wie optimistisch Aristoteles war: „Wir leben in Taten, nicht in Jahren, in Gedanken, nicht Atemzügen, in Empfindungen, nicht in Zahlen auf einer Sonnenuhr. Wir sollten die Zeit in Herzschlägen messen.“ Ich wollte Zeitferien; ich stimmte dem Ausspruch J. B. Priestleys zu, dass ein guter Urlaub der ist, den man bei Leuten verbringt, deren Zeitbegriff vager formuliert ist als der eigene.
Operiert wurde ich am nächsten Morgen, und nicht lange nach Mittag hatte ich einen trockenen Mund, ein Chirurg beugte sich über mich und eine Schwester maß die Schläge meines Herzens. Der Eingriff war gut verlaufen, und ich konnte damit rechnen, binnen acht Wochen gut 90 Prozent meiner Beweglichkeit und meines Beugungswinkels wiederzuhaben, wenn ich mich bei der Physiotherapie anstrengte.
Zwischen einer und der nächsten Physio sah ich viel mehr fern als sonst und wurde viel wütender als üblich und las viel auf meinem Kindle, weil normale Bücher mit nur einer gesunden Hand ein Ding der Unmöglichkeit waren, genau wie das Uhraufziehen. Ich las Zen und die Kunst, ein Motorrad zu warten, diese schwülstige spirituelle Reisegeschichte von Robert M. Pirsig, die ein sagenhafter Bestseller wurde, weil sie eine Quelle westlichen Zeitgeists angezapft hat oder vielleicht auch das darstellt, was die Schweden einen kulturbärer nennen, ein ultrazeitgemäßes Buch, das an unseren Annahmen über Kulturwerte kratzt. In diesem Fall wandte sich Zen gegen unsere Annahmen, dass wir alles immer mehr und immer schneller wollten – mehr Materialismus, ein schnelleres, stärker vernetztes Leben, das sich auf Dinge außerhalb unserer Kontrolle oder unseres Begriffsvermögens verlässt.
Wenn man tiefer blickt, dreht sich Zen und die Kunst, ein Motorrad zu warten von Anfang bis Ende um die Zeit. Das beginnt schon mit den Worten: „Ohne die Hand vom linken Griff des Motorradlenkers zu nehmen, kann ich auf meiner Uhr sehen, daß es halb neun ist“; und auf den nächsten 400 Seiten lockert sich dieser Griff kaum jemals, während erkundet wird, was man im Leben für wichtig hält und wertschätzt, und was man auf der Reise letztlich sieht und spürt. Die Motorradtour durch eine sengend heiße Landschaft verleiht dem etwas unmittelbar Bewusstes. Die Reisenden – der Autor, sein Sohn Chris und ein paar Freunde – fahren quer durch die Great Plains in Richtung Montana und weiter, und sie trödeln nicht dabei. „Wir wollen gut vorankommen, aber die Betonung liegt für uns mehr auf dem ‚gut‘ als auf dem ‚vorankommen‘, und mit dieser Akzentverschiebung stellt sich ein ganz anderes Verhältnis zur Zeit ein.“4
Ich musste an den Mann denken, der mir Appetit auf Bücher und Wörter gemacht hat, einen Englischlehrer namens John Couper. Mr. Couper erlaubte mir, den Text zu Bob Dylans „Desolation Row“ in unseren Abiturkurs mitzubringen, wo er analysiert wurde, als wäre er ein Gedicht von Shelley, und das, obwohl er offensichtlich viel besser war. Eines Tages hatte Couper sich morgens während der Schulversammlung in unserer Aula aufs Podium gestellt und eine Ansprache über die Zeit gehalten. Ich glaube, er fing mit ein paar berühmten Zeitzitaten an: „Zeit, die man lachend verbringt, ist Zeit, die man mit den Göttern verbringt“ (unbekannt); „Hüte dich vor der Unfruchtbarkeit eines geschäftigen Lebens“ (Sokrates). Dann las er eine Liste vor, die ich so in Erinnerung habe: „Zeit. Ihr könnt sie aufwenden, nehmen, verlieren, sparen, vergeuden, verlangsamen, beschleunigen, überholen, festhalten, besiegen, freiräumen, totschlagen.“ Es gab noch andere appetitliche Verwendungen, aber die wichtige Botschaft am Ende lautete, dass es ein Privileg war, jung zu sein wie wir und die Zeit auf unserer Seite zu haben, denn die Zeit wartet auf niemanden, und jedermann muss sich beeilen (damals war es eine reine Jungenschule), und was wir auch sonst mit unserer Zeit anfangen mochten, wir sollten sie nicht verschwenden. Das blieb mir in Erinnerung, aber als Lebensregel war es schwer zu befolgen.
Manchmal glaube ich, dass ich meine Kindheit in lauter Bilder der Zeitmessung fassen kann. Vielleicht können wir das alle. Eines Tages, als ich drei oder vier war, brachte mein Vater eine goldene „Carriage Clock“, eine tragbare Uhr in Schuhkartongröße, nach Hause, die in einem Futteral steckte, das mit karmesinrotem Pannesamt ausgeschlagen war; und als mein Fingerchen den Knopf auf der Oberseite drückte, schlug eine Glocke die Stunde. Die Schuluhr in der Aula, die Küchenuhr – und in meinem Schlafzimmer hatte ich einen Wecker namens Big Ben von der Firma Westclox.5
Dann schalteten wir eines Tages den Fernseher an, um uns den irischen Komiker Dave Allen anzusehen. Gewagter ging es bei mir zu Hause nicht: Allen war ein ‚gefährlicher‘ Komiker, der häufig Religionsgemeinschaften gegen sich aufbrachte, vor der Kamera trank und rauchte und Geschichten erzählte, die eindeutig nicht mehr kindertauglich waren. Er sah ein bisschen zwielichtig aus und hatte die Spitze seines linken Zeigefingers durch einen, wie er behauptete, unheimlichen, aber komischen Unfall verloren; später fanden wir heraus, dass es passiert war, als ihm ein Zahnrad in einer Mühle den Finger zerquetschte, als er sechs war.
Eines Abends stand Allen von seinem Stuhl mit der hohen Lehne auf, stellte seinen Schwenker aus geschliffenem Glas hin und fing eine seiner Geschichten an, über die merkwürdige Art, wie wir unser Leben ordnen. „Ich meine“, sagte er, „wie wir nach der Zeit leben … wie wir nach der Uhr leben, nach dem Zeiger. Wir werden mit der Uhr großgezogen, wir werden damit großgezogen, die Uhr zu achten, die Uhr zu bewundern. Pünktlichkeit. Wir leben unser Leben nach der Uhr.“ Allen schwenkte den rechten Arm durch die Gegend vor Staunen darüber, wie verrückt das Ganze war. „Du stempelst dich ein nach der Uhr. Du stempelst dich aus nach der Uhr. Du kommst nach Hause nach der Uhr. Du isst nach der Uhr, du trinkst nach der Uhr, du gehst ins Bett nach der Uhr … Das machst du vierzig Jahre deines Lebens lang, du wirst pensioniert, und Himmelarsch, was geben sie dir dann? Eine Uhr!“
Wegen seines Fluchens gab es haufenweise Zuschaueranrufe (es gab Leute, die am Telefon förmlich darauf lauerten, wenn Allen auf Sendung war, so wie Kandidaten einer Quizshow). Aber so schnell vergaß niemand den Witz, auch nicht das perfekte Timing der Komik, in der jeder schweigende Moment wirkte wie die Pausen in einem Schlagzeugsolo.
Während meiner Genesung verschwendete ich viel Zeit mit meinem iPhone. Als ich eines Abends im Bett lag, hatte ich das dringende Bedürfnis, mir Filme mit Bill Nighy anzusehen. Ich regelte die Helligkeit meines Telefons herunter und stopfte mich auf YouTube voll und sah mir süchtig machende Massen von Richard-Curtis-Filmen und David Hares Stück Skylight an, und als ich damit fertig war, tat ich etwas Unverzeihliches: Ich lud mir kostenpflichtig About Time (Alles eine Frage der Zeit) herunter. Das war eine lächerliche Sache, in der die Männer in der erfundenen Familie von Nighy zurück durch die Zeit reisen können, ihre vergangenen Fehler ausbügeln – ein falsches Wort hier, eine verpatzte Begegnung da – und am Ende glücklich verliebt sind. Wie der Filmkritiker Anthony Lane richtig anmerkte, würde ein richtig Schlauer sich die Zeitungen von diesem Tag ansehen, dann zurückreisen und à la Zurück in die Zukunft auf den Sieger im Pferderennen setzen; aber wie uns über ein Jahrhundert solcher fiktiven Wanderungen gezeigt hat, sind es selten die Scharfsinnigen, die auf Zeitreise gehen. Natürlich wünschte ich mir, ich hätte zurückreisen können und doch nicht auf „Kaufen“ geklickt.
Aber nicht nur Nighys Schauspielleistung zog mich an ihm an. Ich hatte einmal mit ihm und seiner damaligen Frau Diana Quick zu Abend gegessen und fand ihn genauso, wie er in den meisten Film- und Theaterrollen auftritt: der untadlige Anzug und die schwere Brille natürlich, die lässig-makellosen englischen Manieren und seine Kavaliersart, die einen glauben lässt, dass alles, was er sagt, entweder klug oder todkomisch ist. Was ich besonders an ihm mochte, war, dass er sein Leben anscheinend perfekt durchgeplant hatte. Auf die Frage, was er in seiner Freizeit machte, sagte er, er sehe sich viel Fußball im Fernsehen an, besonders Champions-League-Spiele. Die Champions League fasziniere ihn einfach. Tatsächlich, behauptete er, zähle er die ihm verbleibende Zeit auf Erden danach, wie viele Champions-League-Spielzeiten er noch habe. Sollte der FC Barcelona Nighys elegante, aber ermattete Seele mit seinem Kurzpassspiel und der strikten Trainervorschrift, den Ball nicht länger als sieben Sekunden am Mann zu halten, noch die nächsten 25 Jahre lang beschäftigen können, dann käme dabei eine fantastische Lebensspanne für ihn heraus.
Wie ich mich so von meinem Unfall erholte, mein Ellbogen ausheilte und ich wieder ein Buch in den Händen halten konnte, stieß ich in fast allem, was mir unterkam, auf das Erforschen der Zeit: in jeder Geschichte, jedem Buch. Und auch in jedem Film: Jeder Plot war zeitbezogen oder zeitabhängig, und alles, was nicht in einer imaginären Zeit spielte, war Geschichte. In den Zeitungen und im Fernsehen schien es wenig Berichtenswertes zu geben, es sei denn, es war mit einem Jahrestag verknüpft.
Allein das schiere Wort war übermächtig. Alle drei Monate fügt das Oxford English Dictionary der Onlineversion seiner dritten Auflage (die zweite Auflage bringt es in der Druckversion auf zwanzig Bände mit 615.000 Stichwörtern) etwa 2.500 neue und überarbeitete Einträge zu Wörtern und Redewendungen hinzu. Viele neue Wörter sind Slang, und viele andere stammen aus der Popkultur oder der Digitalsprache. Als Gegenstück zu den neuen Wörtern pflegt das OED außerdem eine Liste, welche alten Wörter wir im Englischen am häufigsten verwenden, und das sind die, die wir erwartet hatten: the, be, to, of und natürlich and. Aber was sind die gebräuchlichsten Substantive? Month liegt auf Platz 40. Life an Position 9. Day kommt als fünftes und year als drittes. Person liegt auf Platz 2, das am häufigsten gebrauchten Nomen in der englischen Sprache jedoch ist time.6
Wie das OED vermerkt, bedient sich unser Wortschatz der Zeit nicht nur als eines isolierten Begriffs, sondern als einer ganzen Philosophie: Mehr Handlungen und Redewendungen werden mit „Zeit“ gebildet als mit jedem anderen Wort. Rechtzeitig, jederzeit, Kurzzeit, Genesungszeit, Lesezeit, allzeit. Die Liste geht noch ewig weiter. Sie lässt keine Zweifel an der unerschütterlichen Gegenwart der Zeit in unserem Leben. Und wenn man auch nur den Anfang dieser Liste liest, denkt man sich vielleicht schon, dass wir zu weit gegangen sind und zu schnell reisen, um die Zeit neu zu erfinden oder ganz anzuhalten. Wie Sie jedoch im nächsten Kapitel feststellen werden, hatten wir früher einmal den Eindruck, dass so etwas erstens möglich und zweitens wünschenswert wäre.
1 Seneca, De brevitate vitae 2, 1.2 (übs. Manfred Rosenbach). Die mittelbare Todesursache Senecas war nicht ein Übermaß an Pessimismus, sondern sein misstrauischer Kaiser und Ex-Schüler Nero (A.d.Ü.).
2 Marc Aurel, Selbstbetrachtungen 4,43 (übs.W. Capelle).
3 Augustinus, Bekenntnisse (Confessiones) 11,14 (übs.W. Thimme).
4 Übs. Rudolf Hermstein.
5 Das erinnert mich an den Witz, in dem Big Ben mit dem Schiefen Turm von Pisa spricht und sagt: „Wenn du dich geneigt fühlst – die Zeit dazu hätte ich.“
6 Die Oxford University Press hat dafür online recherchiert und Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Blogs und die Parlamentsberichte (den „Hansard“) ausgewertet.
Die Revolution verlockt unsere Kinder: Die Zehn-Stunden-Uhr findet einen neuen Bewunderer.