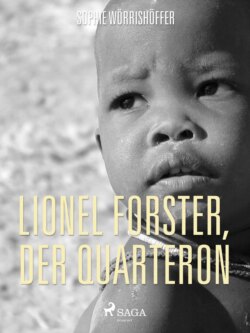Читать книгу Lionel Forster, der Quarteron. Eine Geschichte aus dem Amerikanischen Bürgerkrieg - Sophie Wörrishöffer - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Sechstes Kapitel
ОглавлениеEs war in der ersten Morgenfrühe des folgenden Tages. Nur wenige Personen belebten schon jetzt die Strassen, Leute, welche zur Arbeit gingen, denen man es ansah, dass ihr Tun und Treiben nur im Schatten der Nacht gedieh. Alle diese Menschen blieben, wenn sie an dem Hause des Eisenhändlers Neubert vorübergingen, stehen und sahen zur Tür des Gebäudes auf. Einige schlichen auch wohl auf den Zehenspitzen behutsam über den Fahrdamm und bis unter die Mauern des Hauses, dann aber eilten sie davon, als sei ihnen ein Gespenst entgegengefahren, manche sogar mit einem halberstickten Ausruf des heftigsten Schreckens.
Allmählich wurde der Verkehr lebhafter, herumlungernde Soldaten, Gesindel, das in irgendeiner Torfahrt oder auf einer Treppe übernachtet hatte, auch Offiziere kamen des Weges, und nun bildeten sich Gruppen, die bald zu einer dichtgedrängten Menge zusammenflossen.
Ein Schlüssel knarrte im Schloss, die Tür öffnete sich, und Herr Neubert sah auf die Strasse hinaus.
„Leute!“ fragte er mit ruhiger, weithin verständlicher Stimme, „was geht hier vor? Was habt ihr?“
Niemand antwortete ihm — da sah er im Morgenwind ein weisses Papierblatt hin und her flattern, es war mit einem Stift am Türrahmen befestigt und auf der vorderen Seite beschrieben. Ein schneller Griff brachte es in die Hände des erschreckten Mannes, er erbleichte, seine Füsse schienen den festen Halt zu verlieren, dann trat er plötzlich zurück in das Haus und schloss die Tür.
„Nun hat er’s!“ flüsterten einige.
„Verdientermassen! Man sah ihn immer mit den übrigen Deutschen die Köpfe zusammenstecken, sie haben auch in den Nächten Pakete getragen und allerlei Versammlungen abgehalten. Die Deutschen sollten alle mit blanker Waffe zum Lande hinausgetrieben werden!“
„Hurra für Jefferson Davis!“
„Hipp! Hipp! Hurra!“
Die Menge verlief sich, während drinnen im Hause der Kaufmann das verhängnisvolle Blatt ansah und ein Gefühl des aufsteigenden Entsetzens vergebens zu bekämpfen suchte. Was hier geschrieben stand, das kam einem Todesurteil gleich.
Frau Neubert und Hermann sahen dem Oberhaupte der Familie über die Schulter und lasen mit ihm. Eisige Schauer rieselten durch die Adern der Unglücklichen.
Auf dem weissen Blatte stand Folgendes:
„Vorladung!
Der Kaufmann Ferdinand Neubert wird von dem unterzeichneten Komitee hierdurch aufgefordert, sich am heutigen Abend um elf Uhr im Gasthause zum Stern Amerikas im kleinen Saale einzufinden und zwar zum Zwecke der Verantwortung gegen folgende Anklagen:
1 Parteinahme für die Nordstaaten. Abolitionistische Gesinnung.
2 Pläne zur Flucht durch die Belagerungslinie.
3 Unerlaubte Sympathien für Neger.
4 Teilnahme an heimlichen Versammlungen von Sklaven, (Aufwiegelung derselben durch Reden und Belehrungen.)
Es wird in der anberaumten Versammlung nach Recht und Billigkeit gerichtet werden; sollte aber der Kaufmann Neubert vorziehen, zur festgesetzten Stunde nicht zu erscheinen, so hat er von vornherein auf eine Verteidigung vollständig verzichtet und sich selbst der genannten Verbrechen schuldig erklärt. In diesem Falle ist sein Todesurteil hiermit ausgesprochen. Möge er sich versteckt halten, wo es sei, möge er zu Hilfe rufen, wen er wolle, der Richter Lynch wird ihn finden und seines Amtes walten.
Das Vigilanz-Komitee.“
Frau Neubert legte beide Hände über die Augen und schluchzte leise.
„Vater!“ flüsterte Hermann. „Gehst du hin?“
„Ich gehe,“ nickte der Kaufmann, „wir gewinnen damit Zeit.“
Frau Neubert erhob sich und streckte beide Arme aus.
„Mir ahnt Schlimmes!“ schluchzte sie.
Er schüttelte den Kopf. „Sie bringen mich nicht gleich um, Anna, sie plündern mich nur aus und überlassen den Verarmten seinem Schicksal. Du weisst, dass unsere wertvollsten Besitztümer geborgen sind.“
Die weinende Frau kannte ihren Mann, sie wusste, dass es vergeblich sein würde, ihn überreden zu wollen, und ergab sich stumm. „Welch’ eine Zeit, in der wir leben!“ sagte sie mit gerungenen Händen. „Gott hat Amerika verlassen!“
„Er erbarmt sich endlich seiner schwarzen Kinder! — Und wenn auch über die Weissen noch so grosses Leid kommt, das Ziel wird doch erreicht!“ —
Er war sehr blass, als er diese Worte sprach, aber vollkommen ruhig. „Das Boot liegt sicher versteckt,“ sagte er. „Ich gebe nichts verloren, obwohl wir für unsere Kinder schwerlich morgen noch ein Obdach besitzen werden. Man macht das Haus dem Boden gleich! — Ach, wenn jetzt Mr. Charles Trevor noch lebte!“
Hermann trocknete sich die Augen. „Auch Lionel ist ins Elend gestürzt,“ seufzte er.
„Wir werden ihn mit uns nehmen, mein Junge!“ sagte der Vater.
Draussen wurde an die Tür geklopft, ein Freund aus der deutschen Kolonie hatte von dem Unglück gehört und kam, um zu trösten und seinen Beistand anzubieten. „Deine Frau und die kleine Schar nehme ich auf, Neubert,“ sagte er. „Es wird ihnen, solange mir mein Haus noch bleibt, an nichts fehlen. Packen Sie Ihre Sachen, liebe Frau Neubert. Nehmen Sie mit, soviel sich tragen lässt; Betten, Kleider, Hausgerät, — ich schicke später meine Knechte mit einem Wagen, um es hinüberzubefördern. Das beste wird dann sein, unter der Hand alles Entbehrliche zu verkaufen.“
Herr Neubert schüttelte den Kopf. „Es ist nur noch sehr wenig vorhanden,“ sagte er, „miteinander vielleicht kaum für fünfhundert Dollar. Aber das Haus! das Haus! — All’ mein sauer erworbenes Kapital steckt darin und geht ohne Rettung verloren. Diese Nacht fahren die roten Flammen darüber hin, — es ist nicht anders. Wir dürfen nur vorwärts sehen, Kinder! Kommt, lasst uns auswählen, was mitgenommen werden soll.“
Herr Behrens bot den Eltern und den Kindern zum Abschied die Hand, dann ging er mit dem Versprechen, in einigen Stunden einen Wagen zu schicken. Dieser Freund war treu, der Kaufmann konnte sich auf ihn vollständig verlassen.
Während des ganzen Tages wurde nun für den Umzug gerüstet, und als der Abend herabsank, fand sich die kleine Familie zum Abschied zusammen. Herr Neubert konnte den Seinigen die Todesblässe, welche sein Gesicht bedeckte, nicht verbergen, aber er war jetzt ruhig. „In zwei Stunden hoffe ich euch wiederzusehen,“ sagte er. „Geht mit Gott, die Trennung ist nur kurz.“ Hermann hing am Halse seines Vaters, er konnte vor Schmerz nicht sprechen, nur seine Blicke zeigten, was in ihm vorging. Herr Neubert streichelte das blasse Gesicht, er küsste den Knaben und zog ihn nahe zu sich. „Du darfst nicht weinen, Hermann, du musst dich tapfer beherrschen, mein Junge. Während ich selbst abwesend bin, sehen deine Mutter und deine Geschwister auf dich als auf ihren einzigen Beschützer.“
Der Knabe nickte, er biss die Zähne zusammen, um nicht zu schluchzen.
Noch ein letzter Kuss, eine schmerzvolle Frage des Kleinsten, warum der Papa nicht mitgehe, dann verliess Frau Neubert, umgeben von ihren Kindern, das Haus, in dem sie glückliche Jahre verlebt hatte und das sie nun, aller menschlichen Berechnung nach, nie wieder betreten würde. An der Tür kamen ihr Herr Behrens und seine Frau schon entgegen, um die gern gesehenen Gäste in Empfang zu nehmen.
Es dunkelte bereits. Neubert durfte keinen Augenblick mehr verlieren. Nachdem er das Haus von aussen geschlossen hatte, ging er schnellen Schrittes die Strassen hinab bis zum „Stern Amerikas,“ einer schmutzigen Schenke, die er freiwillig nie betreten haben würde. Der kleine Saal lag nach hinten hinaus, Herr Neubert konnte also nicht erkennen, ob sich dort eine Versammlung befand, er wollte eben seitwärts durch den Garten schlüpfen, als eine Hand seinen Arm berührte: „Ferdinand!“
„Behrens!“ sagte er gepresst. „Du bist also doch hier?“
„Ich will wenigstens in der Nähe bleiben, Neubert, falls es schlimmer ausläuft, als du erwartest.“
Der Kaufmann erschrak. „Du denkst, dass unsere Versammlungen im alten Schulhause entdeckt wären?“ flüsterte er.
„Ich fürchte, ja.“
„Dann müsste es im Schosse der Landsleute einen ehrlosen Verräter gegeben haben! Welchen deutschen Mann möchtest du dessen zeihen, Behrens?“
Der andere schüttelte den Kopf. „Ich weiss es nicht, Neubert, ich kann keinen bestimmten Verdacht aussprechen, aber die Sache scheint mir bedenklich. Hast du einen Revolver bei dir?“
„Nein! Wozu auch?“
„Weil du dich in eine Spitzbubengesellschaft begibst. Hier ist einer, ein sechsläufiger, — du kannst wenigstens einen persönlichen Angreifer damit in Schach halten.“
Der Kaufmann steckte mit einigem Widerstreben die Waffe in seine Brusttasche, dann, als es von einer nahen Kirche elf schlug, drückte er hastig die Hand des anderen und eilte in das Haus, wo ein schwarzer Kellner den späten Gast eintreten liess.
„Guten Abend, Gentlemen!“ grüsste dieser eine rauchende, trinkende und in ihrem Aussehen höchst seltsame Versammlung. „Ich bin Ferdinand Neubert, den Sie zu sprechen wünschten! Was steht Ihnen zu Diensten?“
Lauter verlarvte oder schwarz gefärbte Männer sahen ihm entgegen. Einige lagen in der Weise angeheiterter Fuhrknechte mit beiden Armen breit auf dem Tische, während andere sich auf den Hinterfüssen der Stühle schaukelten. Dampfende Groggläser standen vor allen. Bei dem mit ruhiger Stimme gesprochenen Grusse des Kaufmanns ging ein Murmeln durch die Reihen der Männer; einige lachten spöttisch.
„Warhaftig, du hast Mut, Geselle!“
„Ein gutes Gewissen habe ich!“ versetzte der Kaufmann.
Jemand schlug mit geballter Faust auf den Tisch, dass Gläser und Flaschen klirrten. „Die Gerichtssitzung beginnt. Ferdinand Neubert, weisst du, wer die sind, welche dich vorgeladen haben, die, deren Urteilsspruch jetzt erfolgen soll?“
Der Kaufmann bewahrte seine Ruhe. Er hatte sich so gestellt, dass ein geöffnetes, auf den Garten hinausgehendes Fenster ihm zur rechten für alle Fälle erreichbar blieb, jetzt sah er in das geschwärzte Gesicht des Vorsitzenden und antwortete: „Die Herren nennen sich das Vigilanz-Komitee. Aus eigener Machtvollkommenheit, soviel ich weiss.“
Der Geschwärzte nickte. „Wir zählen hier in der Stadt etwa zweitausend Mitglieder,“ fuhr er in bedeutungsvollem Tone fort, „im Lande einige hunderttausend. Das ist eine Macht, die du wahrscheinlich anerkennen wirst, Ferdinand Neubert!“
Aus der zerfetzten Tasche des Geschwärzten kam jetzt ein zusammengefaltetes Papier zum Vorschein, die Anklageschrift. „Ruhe!“ rief der Strolch, dann begann er mit erhobener Stimme seinen Vortrag. „Ferdinand Neubert, es wird dir schwer werden, die gegen dich vorliegenden Beschuldigungen zu entkräften. Fangen wir an mit dem ersten Punkte. Du bist ein heimlicher Anhänger der verfluchten abolitionistischen Lehre! Gibst du das zu?“
Der Kaufmann sah ihn an. „Hat nicht jeder unter uns das Recht seiner Gesinnung?“ sagte er. „Darf nicht jeder so urteilen und so handeln, wie es ihm dem Rechte gemäss erscheint?“
Der mit dem schwarzen Gesichte schüttelte den Kopf. „Ausflüchte!“ rief er. „Ich will ein Ja oder Nein hören. Bist du ein Anhänger der abolitionistischen Lehre?“
„Ja!“ antwortete Neumann. „Ich bin es! Ich mag nicht lügen!“
Ein Gelächter antwortete ihm. „Du scheinst ein sehr empfindsamer Charakter zu sein,“ fuhr der Fragesteller fort. „Aber desto besser für deine Richter, das Verfahren wird dadurch abgekürzt. Wir kommen jetzt zur zweiten Frage. Was schlepptet ihr nächtlicherweile hin und her, ihr verdammten Deutschen, die ihr alle wie Kletten zusammenhaltet?“
Neubert zuckte die Achseln. „Geschäftsangelegenheiten,“ versetzte er. „Dinge, die keinen Dritten kümmern.“
„Und über die du auch nicht sprechen willst, Kamerad?“
„Nein.“
„Punkt zwei ist eingestanden!“ rief der Vorsitzende. „Weiter im Text also! Du hegst Fluchtpläne, Ferdinand Neubert!“
„Ich will, wenn es mir möglich ist, mein Haus verkaufen und von hier abreisen, ja. Da ich kein Gefangener bin, so bedarf der Plan wohl auch keiner besonderen Erlaubnis.“
„Du scheinst viel Talent zum Rechtsverdreher zu besitzen, alter Junge. Schade, dass dir keine Zeit mehr bleibt, noch einer zu werden. Es kommt nämlich ein letzter Punkt der Anklage, und dieser bricht dir, wie ich glaube, den Hals. Sage mir, welchen Zweck hat es, wenn sich mitten in dunkler Nacht die Sklaven der Umgegend nach Hunderten im leerstehenden Schulgebäude der Washingtonstrasse zusammenfinden, he?“
Ein Murren durchlief den Kreis. Die Köpfe erhitzten sich mehr und mehr, die Augen funkelten hinter den Löchern der Masken. Worte wie „Verdammter Deutscher!“ oder „Schlagt den Hund zu Boden!“ wurden hie und da gehört.
„Ich will euch sagen, was die Abolitionisten im Schulhause treiben,“ fuhr der Sprecher fort. „Sie halten Ansprachen, sie belehren die Schwarzen über alle möglichen Gegenstände, am eindringlichsten aber über solche Dinge, die das Recht der Dienstboten in andern Ländern betreffen, sie wollen heimlich das Feuer so lange schüren, bis es in helle Flammen ausbricht. Die Haupträdelsführer dieser Unternehmungen sind Deutsche, und unter ihnen steht in unermüdlichem Eifer wieder einer den übrigen voran, — du, Ferdinand Neubert! Magst du es leugnen?“
Neuberts Augen flammten auf. „Nein,“ rief er mit starker Stimme, „nein, ich hasse und verabscheue die Sklaverei und ihre Anhänger! — Ein Mann, ein deutscher Mann sagt euch das in eure verlarvten Gesichter. Nun macht mit mir, was ihr wollt!“
Mehrere der anwesenden Buschklepper sprangen bei dieser Rede von ihren Plätzen auf und schienen den wehrlosen Kaufmann zu Boden schlagen zu wollen, sie brüllten vor Wut, Messer und Revolver blitzten im Lampenschein, es war ungewiss, was die nächste Minute bringen würde, als plötzlich der Vorsitzende mit herrischem Tone Halt gebot. „Berührt ihn nicht!“ rief er. „So lieb euch euer Leben ist, berührt ihn nicht! Der Landesverräter soll länger leiden, als während der wenigen Minuten, in denen eine Pistolenkugel tötet, er soll vor allen Dingen zuerst sein Urteil hören! Dein Besitztum ist hiermit konfisziert, Ferdinand Neubert!“ fuhr er fort, „du selbst bist vorläufig zur Gefängnisstrafe verurteilt. Ich sage ‚vorläufig!’ — denn die Freiheit bekommst du nicht wieder, wenn auch der Tag der Hinrichtung noch nicht bestimmt werden kann. Führt ihn in das Gefängnis! Kameraden!“
Die Gauner erhoben sich mit wildem Frohlocken, als plötzlich der Knall eines Pistolenschusses das Zimmer gleichsam erbeben liess. Die Lampe erlosch, Glassplitter flogen umher, ein kräftiger Arm packte von draussen die Schulter des Verurteilten, eine Stimme flüsterte in sein Ohr: „Rasch! Rasch! Hier hinaus!“
Gedankenschnell hatte Neubert begriffen, ehe Sekunden vergingen, stand er im Garten und glitt geräuschlos durch die Büsche davon. Während sich im Saale ein wahrer Höllenlärm entwickelte, lief er, so schnell ihn seine Füsse trugen, quer über Beete und Rabatten, über ein Kornfeld und zwischen Kühen, die erschreckt aufsprangen, aufs Geratewohl vorwärts. Es war Behrens, der ihn gerettet, dessen Kugel die Lampe zerschmettert hatte, aber er konnte den treuen Freund nirgends entdecken, er hatte sich selbst schleunigst in Sicherheit gebracht.
Neubert lief, bis alle seine Pulse zu zerspringen drohten, bis sich Funken vor seinen Blicken zeigten, dann endlich stand er, an einen Baum gelehnt, einen Augenblick still und horchte. Verworrenes Geräusch drang zu ihm, Geschrei und schwere Schritte; er konnte nicht bezweifeln, dass ihm die Raubgesellen folgten.
Er durchwatete einen seichten Bach und sprang an das entgegengesetzte Ufer. Wieder Felder und freie Flächen, wieder eine Strasse, dann ein Baumwollfeld, halb abgeerntet, — er stürmte durch die Furchen, immer verfolgt von den Stimmen der Wegelagerer, rastlos vorwärts ohne Ziel, ohne Aufenthalt.
Da stand plötzlich eine halboffene Pforte gerade vor ihm. Hinein! Hinein! Es war höchste Zeit.
Nichts regte sich zwischen den Gebäuden; der Kaufmann horchte. In dem weiten Hofe war alles todesstill, hinter ihm aber klangen Stimmen aus nächster Nähe. „Hier muss er sein! Sucht ihn! Sucht ihn!“
„Bedenkt, was ihr tut!“ rief ein andrer, „es ist das Hauswesen des Friedensrichters, zu dem dieser Hof gehört.“
„Einerlei! Mr. Dunkan hilft auch keinem Abolitionisten zur Flucht, er liefert ihn uns vielmehr sogleich aus.“
Jedes Wort drang zu den Ohren des Verfolgten. Er schlich an den Hütten der Neger dahin, immer im tiefsten Schatten, lautlos wie ein Geist, — jede Tür war verschlossen, sooft auch die tastende Hand den Drücker berührte, immer war es vergebens.
„Es ist zu Ende,“ dachte der gefolterte Mann. „Gott will, dass ich sterbe.“
Die letzte Tür lag vor seinen Blicken, — sie war ein wenig geöffnet, er konnte hineinschlüpfen und in dem grossen, vollständig finsteren Raume Atem schöpfend stillstehen. Zwei Reihen Betten standen an den Wänden, es war ein Schlafsaal, in dem er sich befand.
„Wer ist hier?“ fragte eine Stimme. „Sind Sie es, Sammy?“
„Jesus! — das ist Lionel!“
„Herr Neubert?“ raunte in höchster Bestürzung der Knabe. „Wie —“
„Pst! Man verfolgt mich. Lionel, können Sie mir keinen Schutz gewähren?“
„Kriechen Sie unter mein Bett, rasch! —“
Draussen erschien Lichterglanz, die Stimme des Mulatten wurde gehört. „Ein Flüchtling, Gentlemen? — Hier ist niemand!“
Ein Hund schlug an, Lionel erschrak heftig. „Die Dogge!“ flüsterte er. „Drücken Sie sich an die Mauer, Sir!“
Der Hund sprang die Tür hinein und fuhr auf Lionels Bett los, um wütend bellen. Ebenso schnell war ihm sein Herr nachgeeilt, jetzt fiel ein voller Lichtstrahl in den Raum, Lionel tat, als erwache er erst im selben Augenblick. „Sammy!“ rief er, „Sammy! was hat Ihr Hund?“
„Kusch dich, Warp! — Kusch dich!“
Das Tier gehorchte. Lionel drückte bedeutsam die Hand des Mulatten. „Bringen Sie das Tier weg!“ flüsterte er. „Die da draussen mit den Larven vor den Gesichtern sind die Todfeinde der Farbigen, die Männer vom Vigilanzkomitee, nicht wahr?“
Ein schlaues Lächeln glitt über das gelbe Gesicht; der Mulatte wandte sich achzelzuckend zu den draussen stehenden Männern. „Hier ist niemand, Gentlemen!“
„Aber weshalb bellte denn dein Hund, Aufseher?“
„Wir erhielten vorgestern einen neuen Sklaven, den Warp noch nicht kennt. Aber ich werde den gestrengen Mr. Dunkan wecken, er mag entscheiden, wie weit die Haussuchung gehen darf.“
„Lassen Sie nur, Aufseher!“ riefen bei diesem Vorschlag des Mulatten sechs Stimmen zugleich. „Es ist gut, wir fangen den Vogel auch an einem andern Orte.“
Und als wünschten sie nicht jetzt mit dem Friedensrichter zusammenzutreffen, machten sich alle davon.
Der Mulatte verschloss hinter ihnen den Zugang, dann kam er wieder in den Schlafsaal, wo Neubert und Lionel miteinander auf der niederen Bettstelle sassen und sich leise unterhielten. Als Sammy eintrat, reichte ihm der Kaufmann die Hand. „Erkanntest du mich, Aufseher?“ fragte er.
Der Gelbe lächelte. „Ich stand am Brunnen,“ versetzte er, „deshalb hörte ich alles, sah alles. Solange mein Arm Sie schützen kann, soll Ihnen nichts geschehen, Sir! Sie meinen es gut mit dem farbigen Volke!“
Die Stimme des Riesen zitterte, er war blass unter der gelben Haut. „Was fehlt Ihnen, Sammy?“ fragte Lionel. „Sie sind aufgeregt, traurig.“
Der Mulatte legte plötzlich beide Hände vor das Gesicht und schluchzte wie ein Kind. „Meine Frau,“ stammelte er, „meine arme Frau, — sie ist heute furchtbar geschlagen worden. Die arme Molly gehört dem Krämer drüben an der Ecke, und der will sie nicht verkaufen, weil er keine andere wiederfindet, um Haus und Kinder so ordentlich im Stande zu halten. Seine Frau putzt sich und geht in Gesellschaften, Molly muss alle Arbeit allein verrichten.“
„Und trotzdem wird sie so unbarmherzig geschlagen, Sammy?“
„Ja, Sir! Die Kinder des Krämers sind krank, Molly muss in jeder Nacht wachen, und da hat sie nun heute das Unglück gehabt, ihre Dame nicht so hübsch und so schnell frisieren zu können wie sonst wohl, — die armen Augen sind ihr nur so zugefallen. — Dafür hat sie grausame Strafe bekommen.“
Der Kaufmann drückte ihm die Hand. „Wenn es Gottes Wille ist, so wird das alles bald ein Ende haben, Sammy! Grüsse die übrigen im alten Schulgebäude, ich darf ja nicht wieder hinkommen, aber wo ich irgend kann, da wird es mein Bestreben sein, dem farbigen Volke zu nützen und den Greueln der Sklaverei entgegenzutreten, das magst du deinen Genossen von mir sagen.“
Hie und da hatte sich während dieser Rede ein schwarzer Kopf über den Bettrand erhoben, hie und da eine Hand sich ausgestreckt. Lionel sah mit Erstaunen, dass alle die armen, geknechteten Wesen den Vater seines Freundes persönlich kannten, er seufzte in Hinblick auf die ungeheure Gefahr, der sich Herr Neubert ausgesetzt hatte. Wohin sollte er flüchten? Wie die Vorbereitungen zur Abreise treffen, jetzt, wo ihn kein Auge sehen durfte?
Der Kaufmann wollte offenbar jetzt schon gehen, er strich mit der Rechten durch das Haar und nahm seinen Hut. „Adieu, Lionel, Gott beschütze Sie! Wenn es mir gelingt, mich verborgen zu halten, so sehen wir uns wieder! Adieu, Sammy!“
Alle Sklaven rechts und links in den Betten flüsterten den Abschiedsgruss, noch einmal lag Lionels Hand in derjenigen des Kaufmannes, dann befahl Sammy seinem Hunde, sich ruhig zu verhalten, worauf er selbst in die Nacht hinausging, um zu kundschaften. Hinter ihm her glitt Neubert, beide lautlos wie Schatten durch die Finsternis schleichend.
Es blieb alles still, auch auf dem Hofe des Herrenhauses. Sammy öffnete die vordere Pforte und sah hinaus, — nur einige Laternen schaukelten noch ächzend im Nachtwind, hie und da huschte eine Katze über den Weg, verschwanden behende Ratten an den Seiten der Rinnsteine. Kein Mensch war zu entdecken.
„Sir,“ flüsterte der Mulatte, „wollen Sie es wagen?“
Der Kaufmann nickte. „Ich muss, Sammy! Denke an meine arme Frau, die sich zu Tode ängstigt, an meine Kinder! — Ich muss zu ihnen und sie beruhigen. Adieu! Gott behüte euch!“ Der Mulatte sah den Flüchtling eilends die Strasse hinabgehen, sah, dass ihn niemand verfolgte oder anredete, und trat befriedigt zurück in den Vorgarten, dessen Pforte er wieder verschloss, um sich dann selbst in den Schlafsaal zu begeben und sein Lager zu suchen. Er sah nicht mehr, dass in dem Augenblick, wo seine Schritte verhallten, zwei dunkle Gestalten von rechts und links aus dem Schatten hervorsprangen und dem Verfolgten den Weg abschnitten. „Haben wir dich?“ sagte eine frohlockende Stimme. „Jetzt bist du uns verfallen!“
Der Kaufmann war ausserstande, sich zu widersetzen, seine Hände wurden auf dem Rücken zusammengebunden. Ein paar Fackeln dienten der Gesellschaft als Leuchten, und so ging es im Geschwindschritt zur Brauerei, die das Vigilanzkomitee als Gefängnis benutzte.
Rasselnd öffnete sich das Eisentor. Nun konnten die Masken fallen, — wer sich einmal hinter diesen Mauern befand, der kehrte nie wieder zu den Seinigen zurück.
Totenstille empfing die Ankommenden; wenn diese grausamen Henker ein neues Opfer in den Kerker schleppten, so kauerten die Gefangenen in den entlegensten Ecken, um weder gesehen noch gehört zu werden. Der ungezügelte Uebermut der Machthaber hätte ja in jedem Augenblick eine Hinrichtung anordnen und sogleich ausführen lassen können.
Man übergab dem Aufseher, einem stumpfen, brutalen Gesellen, den neuen Gefangenen und eilte dann fort, um das hauptsächlichste Geschäft dieser Nacht zu beginnen. Alle bewegliche Habe des Kaufmanns musste fortgeschafft und die Brandfackel unter sein Dach geschleudert werden.
„Da hinein!“ gebot der Aufseher. „Es ist Gesellschaft hier!“
Und mit einem rohen Lachen ging er wieder hinab, um seine Pfeife zu rauchen und dabei so lange der Flasche zuzusprechen, bis er auf den Steinen des Hofes einschlief und wie eine Sägemühle zu schnarchen begann.
Den schauerlichen Räumen fehlte alle Beleuchtung. Der Nachtwind fuhr durch die zerbrochenen Scheiben und brachte, sooft er kam, eine erfrischende Luftwelle, die wenigstens sekundenlang die Lungen erquickte. Zerbröckelnder Kalk fiel von den feuchten Wänden, die Decke zeigte klaffende Risse, der Fussssboden war schlüpfrig, ein Geruch wie von moderndem Stroh erhob sich überall, es raschelte verdächtig in den Ecken, als ob Ratten und Mäuse mit den Menschen diese Stätte des Elends teilten.
Erst ganz allmählich gewöhnten sich des Gefangenen Augen an das herrschende Halbdunkel, er sah an den Wänden des grossen Gemaches eine Anzahl menschlicher Gestalten, wie sie erbarmungswürdiger nicht gedacht werden konnten. Zerlumpte Gewänder umhüllten elende, abgemagerte Körper, denen nur noch ein letzter Rest von Lebensfähigkeit geblieben schien. Manche lagen auf dem Gesicht, ohne sich zu regen, andere kauerten gegen die Wand gelehnt, während einige wenige auf- und abschlichen, mit den Händen gestikulierten und abgerissene Sätze vor sich hinmurmelten.
Ein Grauen durchrieselte des Gefangenen Adern. Ob der Verstand dieser Unglücklichen dem furchtbaren Schicksal erlegen war?
„Guten Abend, Gentlemen!“ grüsste er.
Ein Gemurmel antwortete ihm. „Wieder einer!“ ächzte eine schwache Stimme. „Zwei hat der Aufseher heute im Hofe verscharrt.“
Herr Neubert suchte seinen Platz auf dem Stroh so nahe als möglich gegen die Fenster hin, dann legte er beide Hände unter den Kopf und sah durch die zersplitterten Scheiben zum Nachthimmel empor. Wie Schiffe vor dem Wind, so segelten kleine weisse und graue Wolken an dem scharf abgezeichneten Mondviertel vorüber, bald langsam, bald schnell, hier einzeln und dort in ganzen Zügen, die wie ein wanderndes Gebirge auf dem blauen Grunde dahinglitten.
Er bemerkte zuerst nicht, dass die Säume der Wolken im rötlichen Glanze zu strahlen anfingen, dass mitunter eine rote Lohe das Grau verdrängte, erst als eine langgestreckte, wehende Feuergarbe über den Himmel schlug, erwachte er jählings aus den Banden der schmerzvollen Träume, die ihn umsponnen hielten.
Sein Haus! Ihr ewigen Mächte, — sein Haus! Ruchlose Horden zerstörten, was er mit so unsäglicher Mühe erbaut hatte!
Jetzt hörte er die Sturmglocke, aber er wusste nur zu wohl, dass die Aufforderung aus metallenem Munde ungehört verklingen werde.
Röter und röter wurde der Himmel. Von seinem erhöhten Standpunkte sah der Kaufmann die halbe Stadt wie in ein Meer von Glut getaucht. Purpurner Schimmer umfloss die Spitzen der Dächer, purpurn rollte der Fluss seine Wellen. Endlich tönte ein dumpfes Krachen, Wolken und Funken stoben nach allen Seiten auseinander, dann schien die Wut der Flammen gebrochen, — nun lag das Wohnhaus zerschmettert und zerschlagen.
Aber eins durfte er sich doch zum Troste sagen in dieser furchtbaren Stunde: die Güter, die er im Keller vergraben hatte, waren wohlgeborgen.
Im Osten dämmerte bereits der neue Tag. Jetzt liess sich bei der herrschenden halben Beleuchtung die nächste Umgebung besser erkennen. Wie diese Menschen aussahen! Grau, leichenfarbig, mit kaum noch aneinanderhaftenden Lumpen bedeckt! Schaudernd wandte der Gefangene den Blick, es war ihm, als sollte er ersticken, er fühlte einen Schwindel, dem er nicht zu widerstehen vermochte. Leise schlich er durch das grosse Zimmer, trat an eins der Fenster und sah auf die Strasse hinaus.
Aus der Torfahrt des gegenüberliegenden Hauses löste sich ein dunkler Körper und trat vorsichtig hinaus, ohne jedoch gleich von dem Gefangenen bemerkt zu werden. Dieser verfolgte seine eigenen trüben Gedanken, ihm fiel es nicht ein, sich um die Vorübergehenden zu bekümmern, bis plötzlich von der Strasse her ein kleiner Stein gegen das Fenster flog. Nun sah er hinab, und beinahe hätte ein Schrei verraten, was der ungliickliche Mann empfand. Da unten stand Hermann und streckte ihm beide Arme entgegen.
„Mein Junge!“ murmelte mit erstickter Stimme der Vater. „Ach, mein Junge!“
Dann kamen Männerschritte die Strasse herauf, und Hermann verschwand wie ein Schatten hinter der Torfahrt. In einem Augenblick war das traurige Widersehen zwischen dem Vater und dem Sohne vorüber.
Aber so kurz es gewesen, so viel Ruhe hatte es doch dem Gefangenen gebracht. Die Seinigen wussten nun, wo er sich befand, er schien nicht mehr so ganz verlassen, seit er das blasse, tränenvolle Gesicht seines ältesten Knaben gesehen. Vielleicht gab es doch früher oder später aus dieser Hölle eine Erlösung, vielleicht schlug auch ihm noch die Stunde, wo er frei wurde und zu den Seinigen zurückkehren konnte.