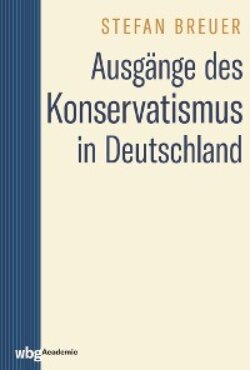Читать книгу Ausgänge des Konservatismus - Stefan Breuer - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I.
ОглавлениеVon dem, was landläufig unter »Konservatismus« verstanden wird5, setzt sich Mannheim durch drei Entscheidungen ab. Konservatismus erschöpft sich für ihn, erstens, nicht in der allgemein menschlichen Neigung zum Festhalten am Gewohnten und zur Reserve gegenüber Neuerungen – eine Neigung, die Mannheim als »vegetativ« und »reaktiv« qualifiziert und in Anlehnung an Max Weber als »Traditionalismus« bezeichnet.6 Während bei Weber dieser Terminus eine erhebliche Schwingungsweite aufweist und dadurch andere Perspektiven eröffnet – traditional bestimmtes Verhalten steht einerseits »ganz und gar an der Grenze und oft jenseits dessen, was man ein ›sinnhaft‹ orientiertes Handeln überhaupt nennen kann«, andererseits diesseits dieser Grenze, etwa wenn es um »traditionale Herrschaft« geht7 – wird er von Mannheim eindeutig auf der Seite des nicht sinnhaften Handelns plaziert und vom Konservatismus abgegrenzt. »›Konservatives‹ Handeln ist sinnorientiertes Handeln und zwar orientiert an einem Sinnzusammenhange, der von Epoche zu Epoche, von einer historischen Phase zur anderen verschiedene objektive Gehalte enthält und sich stets abwandelt.«8
Die zweite Entscheidung folgt gleich anschließend an diese Festlegung. Der mit Konservatismus bezeichnete Sinnzusammenhang ist nicht nur als politische Theorie oder Doktrin im engeren Sinne zu verstehen, sondern als ein »objektiv-geistiger Strukturzusammenhang«, in den »auch Zusammengehörigkeiten allgemein weltanschaulicher, gefühlsmäßiger Art« eingeschlossen sind, bis hin zur »Konstituierung einer bestimmten Denkweise«.9 Es sei eine Tatsache, heißt es an anderer Stelle, daß »mit dem interessenmäßigen politischen Konservatismus zugleich ein weltanschaulicher verbunden ist«, daß der Konservative »eben nicht nur sein Interesse« wolle, »sondern zugleich seine Welt, in der sein Interesse heimisch ist«.10 Es ist diese »konservative Weltanschauung«, auf die sich Mannheims eigentliches Interesse richtet.11
Die dritte Entscheidung besteht in einer strikten Historisierung des Forschungsobjekts. Unter Konservatismus ist nach Mannheim keine allgemein menschliche Abneigung gegen Veränderungen zu verstehen, sondern eine Weltanschauung, die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt herausbildete (Ende des 18., anfangs des 19. Jahrhunderts), in Reaktion auf eine vorgängige Weltanschauung entstand (das Weltbild der exakten Naturwissenschaften) und von bestimmten sozialen Schichten getragen wurde (dem Adel und der mit ihm verbundenen ›freischwebenden‹ Intelligenz). Mannheims Buch beschränkt sich auf die Startphase dieses Prozesses, dem auch von anderen so bezeichneten »Altkonservatismus«.12
Sinnzusammenhang, Strukturzusammenhang, Weltanschauung: das sind Konzepte, die auf die Weltanschauungslehre Wilhelm Diltheys verweisen.13 Tatsächlich hat sich Mannheim in seinen Arbeiten der frühen und mittleren 20er Jahre, in die auch die Konservatismus-Studie fällt, entschieden in die Nachfolge Diltheys gestellt und dessen Werk bescheinigt, auf »eine soziogenetische Kulturerklärung im weitesten Sinn des Wortes« angelegt zu sein.14 Diltheys Verdienst sei es, »in großartigster Weise sowohl in historischen Forschungen wie in methodischen Essays die Verwirklichung einer Durchforschung der geschichtlichen Ideenwelt wie auch der Bewußtseinsstrukturen in Angriff genommen« zu haben.15 Sein Programm, »aus einem Gemeinschaftsbewußtsein, aus einer Weltanschauung heraus die einzelnen Gebilde zu verstehen«, überschreite den Rahmen der Geschichte, sowohl im Sinne der Ereignis- wie der Ideengeschichte, es ziele auf »soziologisch-genetische Sinndeutung« und sei darin, ungeachtet aller Polemik gegen die zeitgenössische Soziologie, Ausgangspunkt für jede nachfolgende, ähnlich ausgerichtete Bestrebung.16
Von diesem demonstrativen Schulterschluß sollte man sich freilich nicht zu der Annahme verleiten lassen, Mannheim sei ein bloßer Epigone Diltheys.17 Gewiß ist in diesen frühen Texten, bedingt auch durch den Einfluß von Lukács, zu dessen Budapester Sonntagskreis Mannheim während des Ersten Weltkriegs gehörte18, sehr viel vom Leben, von Erlebniszusammenhängen und von der Tatsache die Rede, »daß das Subjekt der kulturwissenschaftlichen Erkenntnis nicht bloß das erkenntnistheoretische Subjekt, sondern der ›ganze Mensch‹ ist«19 – Topoi, die unzweifelhaft im Denken Diltheys ihre Wurzel haben. Die Konservatismus-Studie kann nachgerade als Entwurf einer Genealogie der Lebensphilosophie gelesen werden, zeigt sich Mannheim doch überzeugt, daß der moderne Lebensbegriff konservativen Ursprungs ist und einen »Erlebniskeim lebendig [hält]«, welcher erstmals in der Romantik auftaucht und alle folgenden Lebensphilosophien bis hin zu Bergson grundiert.20 Auch das diese Studie tragende Konzept des »Weltwollens« steht in deutlicher Kontinuität zu Diltheys (seinerseits auf Schopenhauer rekurrierendem) voluntaristischem Bewußtseinsmodell, demzufolge die Ausbildung der Weltanschauungen bestimmt ist »von dem Willen zur Festigkeit des Weltbildes, der Lebenswürdigung, der Willensleitung, der aus dem […] Grundzug der Stufenfolge in der psychischen Entwicklung sich ergibt«.21 Gleichwohl: zu jenem extremen »Perspektivismus«, dem sich Mannheim, womöglich unter dem Einfluß Nietzsches, verschreibt, hat Dilthey stets Distanz gehalten, beharrte er doch darauf, den »Quellpunkt des Lebens und der Wirklichkeit zu erweitern, für objektive Erkenntnis tauglich zu machen«.22 Dazu bedurfte es der Überschau, bedurfte es der Synthese und als Mittel dazu: der Allgemeinbegriffe und Idealisierungen, wie sie, wie immer auch psychologisch verkürzt, in Diltheys »Typologie der Weltanschauungen« vorliegen. Mannheim hat diese zwar nicht schlechterdings abgelehnt, ihr aber vorgeworfen, bloß flächenhaft, schematisch und unhistorisch zu sein und letztlich in eine »Auflösung der einmaligen Weltanschauungskomplexe« zu münden.23
Mit der Ablehnung der generalisierenden Abstraktion geht Mannheim auch zu jenen Strömungen in der Soziologie auf Distanz, die er dem »neuzeitliche[n] Rationalismus« zuordnet24: der »reinen Soziologie« Georg Simmels und der »generalisierenden Soziologie« Max Webers.25 Einen Terminus Alfred Webers aufgreifend und diesen gegen dessen Bruder Max wendend, spricht Mannheim von einem ›zivilisatorischen Denken‹, das auf ein »Hineinprojizieren des Zweckrationalen in alle vergangenen Zustände« hinauslaufe und die Soziologie in ein »Pendant zu den rationalen überkonjunktiven Naturwissenschaften« verwandle.26 Ihr setzt er seinen Entwurf einer ›dynamischen Kultursoziologie‹ entgegen, die um den Leitbegriff der »Situation« im Sinne einer singulären, nie identisch wiederkehrenden Ganzheit aufgebaut ist.27 In dem in Rede stehenden Zeitraum ist sie bestimmt durch den Aufstieg des neuzeitlichen Rationalismus, der durch die experimentelle Wissenschaft, den bürokratischen Absolutismus, den modernen Kapitalismus und dessen Träger, das Bürgertum, vorangetrieben wird und zu einer »Entpersönlichung und Entgemeinschaftung« führt, in deren Gefolge »das ›Irrationale‹ (die ursprünglichere Beziehung von Mensch zu Mensch und von Mensch zu Ding)« marginalisiert wird28: durch eine Zurückdrängung des »Lebendigen« auf die Intimbeziehungen sowie auf jene Schichten und Gruppen, die eher Opfer als Träger des Rationalisierungsprozesses sind: den Adel, die Bauern, die mit dem Handwerk in Kontinuität stehenden kleinbürgerlichen Schichten, endlich auch die religiösen Sekten, soweit sie (wie etwa der Pietismus) Traditionen bewahren, die im Lebensstil der modernen Gesellschaftsklassen keinen Platz mehr haben.29
Im Zeitalter der Aufklärung und der Französischen Revolution verdichtet und beschleunigt sich dieser Vorgang derart, daß sich erstmals eine Abwehrfront bildet: nicht nur, aber besonders ausgeprägt in Deutschland. Die Abwehr manifestiert sich auf zwei Ebenen: einer vortheoretischerlebnismäßigen, auf der sich eine konservative »Grundintention« oder auch, wie Mannheim mit Schopenhauer und Dilthey sagt, »Grundstimmung« herausbildet, und einer bewußt-reflexiven, die sich durch die Entwicklung eines eigenen »theoretischen Zentrums« auszeichnet.30 Zur Grundintention rechnet Mannheim jene Dispositionen, die nicht bloß traditionaler Art sind, sondern aus der bestimmten Negation zentraler Aspekte des Rationalisierungsprozesses entspringen. Dazu gehört das emphatische Erleben des »Konkreten«, das dem durch die Aufklärung gesteigerten Abstraktionsvermögen und der Erweiterung des Möglichkeitsspielraums entgegengesetzt wird, gehört die Verklärung des Eigentums, der Vergangenheit und der Geschichte sowie das Ausspielen des ›raumhaften Erlebens‹ gegen das lineare Fortschrittsbewußtsein der bürgerlichen Schichten. Unübersehbar ist hier allerdings der Widerspruch, daß alle diese Formen konservativen Erlebens bestimmte Negationen und damit Ergebnisse von Reflexion sind31, zugleich aber das Gegenteil davon sein sollen: definiert Mannheim doch die Grundintention als eine »Strebensrichtung der Seele«, welche »im unbewußten Denkwollen« verankert sei.32
Dieser Widerspruch ist um so fataler, als er das Fundament der idealtypischen Entwicklungskonstruktion betrifft, die Mannheim für das altkonservative Bewußtsein entwirft. Dieses entfaltet sich in drei Stufen. Am Anfang steht eine Aktivierung des altständischen Bewußtseins in Form des »Urkonservatismus« (repräsentiert durch Justus Möser), der seine politische Spitze gegen den aufklärerisch-bürokratischen Zentralismus richtet.33 Ihm folgt der »romantisierte[n] Konservatismus«, der seine Impulse nicht mehr allein aus der Gegenstellung gegen den bürokratischen Rationalismus bezieht, sondern zugleich aus der Reaktion gegen Aufklärung und Revolution.34 Sozialer Träger dieser romantischen Reaktion ist eine Schicht, die Mannheim in Anlehnung an Alfred Weber als ›sozial freischwebende Intellektuelle‹ bezeichnet.35 Eine dritte Stufe im »konservativ-dynamischen Denken« soll schließlich in der von Hegel entwickelten »Dialektik« vorliegen.36
Ausgeführt hat Mannheim nur die beiden ersten Stufen und auch hier nur deshalb eine gewisse Evidenz erzielt, weil er sich ausschließlich auf das gemeinsame Moment – die Negation des neuzeitlichen Naturrechts – beschränkt und die fundamentalen Differenzen ausblendet, die das altständische Denken von jenem ›subjektivierten Occasionalismus‹ trennen, den Carl Schmitt nur wenige Jahre zuvor als das zentrale Merkmal der politischen Romantik und zugleich als den Grund für deren nahezu beliebige politische Anschlußfähigkeit herausgearbeitet hatte.37 Ob das zutrifft, sei hier dahingestellt, doch fällt auf, daß Mannheim aus heutiger Sicht den Beitrag der Romantik stark überzeichnet und demgegenüber Vertreter des gegenrevolutionären Konservatismus wie die Brüder Gerlach vernachlässigt, die weit mehr von Theoretikern der Restauration wie Haller beeinflußt waren, auch wenn sie sich in ihrer Jugend romantischen Impulsen nicht verschlossen.38 Daß das geplante Kapitel über Hegel nicht zur Ausführung gelangte, dürfte schließlich nicht nur äußere Gründe gehabt haben. Denn obschon Hegel in seinen jungen Jahren Ansichten vertrat, die in mancher Hinsicht »eine Übernahme, Modifizierung oder Weiterentwicklung von Gemeinplätzen adliger-konservativer Kritik am frühen Kapitalismus« waren39, brach er mit diesen doch bald und stellte sich, wenn auch mit gewissen Vorbehalten, auf den Boden der Moderne. In seiner Phänomenologie des Geistes lehrte er den »Glauben an die Allmacht des Wissens«, in seiner Rechtsphilosophie die Trennung von Staat und Gesellschaft, in seiner Geschichtsphilosophie die Durchsetzung des Prinzips der Freiheit des Willens gegen das vorhandene Recht, die mit der Französischen Revolution vollzogen worden sei.40 Kaum überbietbar war endlich die wechselseitige Abneigung, die Hegel und die Romantiker einander entgegenbrachten. War für Hegel die Romantik, zumal die romantische Ironie, ein Exzeß der »leeren Subjektivität« Fichtes41, so meinte Friedrich Schlegel vom System Hegels, es verwechsele in seiner atheistischen Spitzfindigkeit und im Unwesen seines allumfassenden Rationalismus den Satan mit dem lieben Gott.42 Es mag sein, daß Hegels klassizistisch verengter Blick ihn blind machte für die Ansätze zur Autonomisierung des Ästhetischen in der Romantik43, doch wird er damit noch nicht zu einem Vertreter der Anti- oder Gegenmoderne. Seine Dialektik in eine Entwicklungsreihe zu stellen, die mit Justus Möser einsetzt und über Friedrich Schlegel und Adam Müller bis zu Nietzsche und Bergson führt44, ist so abwegig wie nur irgendetwas.
Mannheims Entscheidung, seine Entwicklungskonstruktion auf Hegel zulaufen zu lassen, ist freilich nicht so zu verstehen, als habe er damit die Geschichte des Konservatismus als abgeschlossen betrachtet. Zwar stellt er es für ›historisch-dynamische Strukturzusammenhänge‹, zu denen er auch den Konservatismus zählt, als wesentlich heraus, daß sie in der Zeit einmal beginnen, in der Zeit ihr Schicksal haben und in ihr enden.45 Doch relativiert er diesen Gedanken für den Konservatismus gleich wieder. Auch wenn die alten Lebensformen unter dem Druck der kapitalistischen Rationalisierung dahinschwänden, rette sich das konservative Erleben doch, indem es »immer mehr auf die Ebene der Reflexivität und der methodischen Beherrschbarkeit jene Einstellungen zur Welt erhebt, die für das originäre Erleben sonst verlorengegangen wären.«46 Die konservative Grundintention, eine vortheoretische Willensdisposition, winde sich gewissermaßen aus der Zeit heraus, indem sie zur Theorie werde, zu einer Vergangenheit, die nicht vergehe, die vielmehr imstande sei, »sich stets, den neuen Stufen des Bewußtseins und der Sozialentwicklung entsprechend, [zu] transformieren und hierdurch sozusagen eine Linie im geschichtlichen Geschehen [zu] erhalten, die sonst absterben würde.«47
Zu dieser Auffassung ist Mannheim später auf Distanz gegangen. In einem vier Jahre später erschienenen Essay zu Ehren Alfred Webers kam er wohl noch einmal auf den Konservatismus zurück, rückte ihn nun aber in eine Phänomenologie des »utopischen Bewußtseins«, in der er als Zwischenstufe zwischen dem orgiastischen Chiliasmus der Wiedertäufer und der liberal-humanitären Idee einerseits, der sozialistisch-kommunistischen Utopie andererseits plaziert war. Läßt man den Widersinn einer Konstruktion beiseite, die »die konservative, in die Wirklichkeit eingesenkte Idee« einem Oberbegriff subordinierte, dessen wichtigstes Bestimmungsmerkmal gerade die Inkongruenz des Bewußtseins »mit dem es umgebenden ›Sein‹« sein sollte48, so fällt vor allem die Relativierung auf, die das utopische Bewußtsein in allen seinen Gestalten erfuhr. Die Gegenwart, heißt es dort, stehe im Zeichen einer »allmähliche[n] Senkung der utopischen Intensität«, eines »Verschwinden[s] des Utopischen in jedweder Gestalt« zugunsten einer fortschreitenden »Spannungslosigkeit«, wenn nicht auf der sozialen, so doch auf der ideellen Ebene.49 Zwar begegne man immer noch Utopikern, Romantikern und Ekstatikern, doch handele es sich dabei um Intellektuelle, Angehörige einer »Dünnschicht«, die gegen eine ubiquitär sich ausbreitende »Sachlichkeit« anzukämpfen hätten.50 Mannheim glaubte es nicht länger ausschließen zu dürfen, daß dieser Prozeß zu einer »völligen Destruktion aller spirituellen Elemente, des Utopischen und des Ideologischen zugleich« führen könnte51, wie Herbert Marcuse dies dreieinhalb Jahrzehnte später für die one-dimensional society behauptete, ließ allerdings auch nicht im Zweifel, welche Folgen dies aus seiner Sicht haben würde: »Das Verschwinden der Utopie bringt eine statische Sachlichkeit zustande, in der der Mensch selbst zur Sache wird.«52 Es lag in der Konsequenz dieser Gedankenführung, wenn in Mannheims letztem großen Buch von Konservatismus nicht mehr die Rede war.53