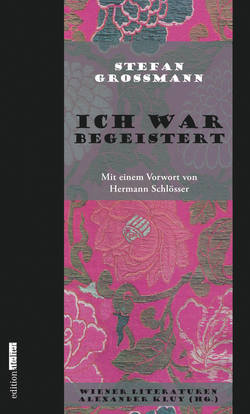Читать книгу Ich war begeistert - Stefan Großmann - Страница 11
Annie
ОглавлениеDamals hatte ich auch eine schicksalsschwere Entscheidung zu fällen. Das Stammcaféhaus war zu wählen, in dem ich mich mit einigen jungen Freunden niederlassen sollte. Man hat über das Caféhausunwesen der Wiener oft die Nase gerümpft und es bespöttelt. Dem Fremden, der es nur in der Nachkriegszeit kennengelernt hat, wo fette, aufgedonnerte Weiber sich in den Fensternischen der Ringstraße breitmachten, mag der Geschmack am Wiener Caféhaus schnell vergangen sein. Aber bis zum Kriege hat das Wiener Café nicht nur seine Berechtigung, sondern auch seine Kultur gehabt. Das Wiener Caféhaus war eine Art von Klub, scheinbar ein Klub mit offener Tür, in Wirklichkeit meistens eine geschlossene Gesellschaft, die es verstand, Eindringlinge, die nicht hingehörten, vom Marmortisch und aus dem Lokal herauszuspötteln. Es gab Cafés für die verschiedenen Lager und Branchen, Arbeiter-Cafés in den Vorstädten, Kaufmann-Cafés in den Geschäftsvierteln, Künstler-Cafés um die Akademie und Sezession herum, Politiker-Cafés beim Reichsratsgebäude, Mediziner-Cafés in der Umgebung des Allgemeinen Krankenhauses.
Wir jungen Leute wählten keck das Café Griensteidl. Es lag auf dem Michaeler Platz, direkt gegenüber der Hofburg. Es hatte noch den entzückenden Charakter des Altwiener Cafés, es war ganz ohne Pomp, ohne Marmor, ohne Plüsch; sein einziger Schmuck bestand in großen, goldgerahmten Spiegeln. Von den vorderen Räumen, in die sich immerhin noch Zufallsgäste verlieren konnten, mußte man durch einen kleinen Biedermeierbogen schlüpfen, wenn man in die geheiligteren hinteren Zimmer gelangen wollte. Da das Café an der Ecke der Herrengasse lag, so gab es an zwei Fronten Fensternischen. In jeder dieser Nischen und an allen Tischen der geheiligten hinteren Räume saß ein sozusagen geschlossener Stammtisch. Das Café Griensteidl war gegen Ende der neunziger Jahre ein geistiges Zentrum der Stadt; in diesem Lager war Österreich, nämlich das junge, das bewußt oder unbewußt an eine Renaissance des auseinanderfallenden Staates dachte. In den geheiligten hinteren Räumen residierten die Politiker. Hier wandelte der bärtige Historiker des sechsundsechziger Krieges, Heinrich Friedjung, monologisierend auf und ab, hier hatte Viktor Adler mit seinem alten Freunde Engelbert Pernerstorfer, der langsam von den Deutschnationalen zu den Sozialisten hinüberrutschte, seinen Spieltisch; der Dritte im Bunde war ein hellblonder Bankdirektor, Otto Wittelshöfer, ein in der Finanzwelt hoch geachteter Mann, den der Nimbus des »geheimen Genossen« umstrahlte. In einem anderen verrauchten Zimmer tagten oder nachteten die Großen des Burgtheaters, das ja nur ein paar Schritte weit entfernt lag. Unser Tisch konnte natürlich nicht in den allerheiligsten Hinterräumen aufgeschlagen werden. Der Zahlkellner Heinrich, der wohlwollende Regisseur des Cafés, hatte uns eine Fensternische in der Herrengasse zuerkannt. Die Geistigkeit des Cafés Griensteidl kam darin zum Ausdruck, daß nicht nur eine Unzahl von in- und ausländischen Tageszeitungen auflag, sondern daß auch sämtliche literarische Wochen- und Monatsschriften von Tisch zu Tisch wanderten. Im Café Griensteidl anerkannt werden, das hieß den Grundstock zum großen Ruhm legen. Aber wie schnuppe war uns jungen Leuten Ruhm oder nicht Ruhm. Damals erschien in einer Münchener Monatsschrift Die Gesellschaft der erste Aufsatz des kleinen Karl Kraus, der auch im Griensteidl geboren wurde. Ich erinnere mich an einen Abend, an dem er mit mir zusammen das Griensteidl verließ, seinen Arm unter meinen schob und ganz ernsthaft an mich die Frage richtete: »Was würdest du dafür geben, wenn du so berühmt wärst wie ich?« Ich wollte ihm nicht direkt ins Gesicht lachen, aber wenn ich später fast allwöchentlich die pathologischen Eitelkeitsexzesse dieses tragischen Zwerges lesen mußte, dann fiel mir dieses erste aufschlußgebende Erlebnis immer wieder ein.
Im Café Griensteidl habe ich den ersten etwas einseitigen Liebesroman meines Lebens zu spinnen begonnen. Zwischen halb elf und elf Uhr abends trat hier eine junge Dame mit ihrer kleinen Clique ein, die in dem ersten Raum hinter dem großen runden Eintrittszimmer sich niederzulassen pflegte. Es war ein junges Mädchen von wunderbarem, milchweißem Teint, hellbraunen, großbewimperten Augen und einer ungewöhnlich schönen Stirn. Eine reizende Fröhlichkeit ging von diesem jungen Mädchen aus, und an vielen Abenden sah ich ihr aus meiner Nische zu, immer entzückter von ihrem kollernden Lachen, bezaubert von den schwer bewimperten Augen, von den weißen Zähnen, die bei ihrem ungenierten Geplauder immer wieder fröhlich zum Vorschein kamen. Von den jungen Leuten, die um sie herum waren, schien keiner sich ihrer besonderen Gunst zu erfreuen. Dann und wann kam eine blonde Freundin mit, aber sie war nur eine stille Hintergrundserscheinung. Die heitere Königin des Tisches war Annie R. Ich hatte durch vorsichtiges Fragen ihren Namen herausbekommen und erfahren, daß es sich um ein junges Mädchen handelte, das im Begriff war, zur Bühne zu gehen. Viele Abende hat es mich beglückt, in meiner Nische zu sitzen und nur sehr vorsichtig, ohne daß ich bemerkt wurde und ohne daß ich gestört hätte, einen schnellen Blick zu Annie R. hinüberzuwerfen. Der Eindruck des strahlenden frohen Mädchens war so stark, daß ich mich an meinen Beobachterplatz in der Nische gewöhnte, und wenn ich einen Abend irgendwo in der Vorstadt oder im Prater verbracht hatte, so scheute ich um Mitternacht den weiten Weg zum Michaeler Platz nicht, um vor dem Schlafengehen wenigstens zehn Minuten lang, hinter einem großen Zeitungsblatt geborgen, einige Blicke an ihren Tisch zu werfen. Kam sie an einem Abend nicht, so fehlte sie mir. An Schlafverschwendung gewöhnt, konnte ich hier bis um zwei Uhr nachts wartend ausharren. Als sie einmal zwei Tage nicht erschien, verfolgte mich der Gedanke, daß sie aus meinem Gesichtskreis verschwunden sein sollte, so sehr, daß ich an meinem Bürotisch vormittags einen Brief konzipierte, den ich an Annie R., Café Griensteidl, am Büfett abzugeben, adressierte. Es war damals Sitte, daß man sich einen Teil seiner Korrespondenz ins Café kommen ließ; in dem Glaskasten, der neben dem Büfett hing, waren immer Dutzende von Briefen an Gäste ausgestellt. Ich hatte in dem Brief Annie R. gefragt, warum sie nicht gekommen sei, und ich hatte ihr gestanden, daß sie mir bitter gefehlt habe. Sie möge es wissen, daß jeder Abend, an dem sie nicht im Griensteidl auftauche, mindestens für einen Menschen in Wien ein verlorener sei. Den Brief hatte ich nicht mit meinem Namen gezeichnet, sondern Gabriel Gram. Am nächsten Abend saß ich in meiner Fensternische. Gegen elf Uhr trat Annie R. mit ihren Freunden ein. Sie wollte sich gerade an ihrem Stammtisch niederlassen, als der Kellner sie auf den Brief im Schaukasten aufmerksam machte. Ich sah ihr erstauntes Gesicht, während ich hinter meiner Zeitung versteckt war; ich konnte beobachten, wie sie den Brief öffnete und ihn mit einem freundlichen Lächeln, aber nicht ohne eine angenehme Nachdenklichkeit, zusammenfaltete. Sie drehte sich um, schien an den Tischen nachzusehen, wo der Schreiber des Briefes sich aufhalten könne. Grund genug, mich rasch noch geschützter hinter meiner Zeitung zu verschanzen. Zum Glück war mein Beobachterposten etwas weit, mein Tisch war noch von einigen Freunden besetzt, so daß es ihr auch bei angestrengtem Suchen unmöglich war, den Briefschreiber zu erkennen. Aber jede suchende Bewegung, jeder durch das Caféhaus schweifende Blick tat meinem Herzen wohl. Nach ein paar Tagen entschloß ich mich, wieder einen Brief zu schreiben. Wieder als Gabriel Gram maskiert. Es war ein Huldigungsbrief, wie ihn das junge Mädchen kaum noch erhalten hatte. Jemand war entzückt von ihr, mit dem sie noch nie ein Wort gesprochen hatte, jemand glaubte sie zu erkennen auf Grund ihrer Bewegungen, ihrer Blicke, ihres Lächelns. Und was wollte Gabriel Gram? Nichts, als dafür Dank sagen, daß er sie sehen konnte. Kein Annäherungsversuch, keine Bitte um Antwort, ja, keine Möglichkeit zu antworten. Und wieder hatte ich die Genugtuung, um elf Uhr abends zu sehen, wie Annie R. den Brief am Büfett entgegennahm. Dieses Mal blieb sie stehen, ließ ihre Freunde sich am Stammtisch versammeln und las, einige Schritte entfernt, verhältnismäßig ungestört, den kuriosen Brief. Schon die Vertiefung in die Lektüre, die Gesenktheit des Kopfes, die Entfernung vom Stammtisch der anderen, ein etwas ungeduldiges Reagieren: – ja, ja, ich komme schon –, als sie von ihren Freunden gerufen wurde, eine unwillkürliche Handbewegung, die ausdrücken sollte: laßt mich doch einen Augenblick in Ruhe –, all das machte den Beobachter in der Fensternische geradezu glücklich. Als die Briefempfängerin nun gar aufblickte und ihre großen hellbraunen Augen ganz langsam suchend das Caféhaus abwanderten, da durchrann mich eine große Seligkeit. Sie steckte den Brief ein, ich spähte von Zeit zu Zeit zu dem Stammtisch hinüber, aber ich hatte nicht den Eindruck, daß sie irgend jemand, auch nicht der blonden Statistin, ein Wort über ihr Brieferlebnis verraten hätte. Nun hätte ich mich ja eigentlich darüber kränken sollen, daß ihr suchender Blick bei mir nicht haltgemacht, daß ihr Auge nicht in meiner Fensternische stillgestanden hatte; denn wenn es wirklich einen solchen coup de foudre gab, der auf schriftlichem Wege erzeugt werden konnte, Herrgott, dann mußte sie doch spüren, aus welcher Ecke der elektrische Strom kam. Aber diese Gedanken verflogen, kaum aufgetaucht, wieder, und zwar aus einem sehr einfachen Grund: Ich war durchdrungen von meiner Häßlichkeit, ich sah mich selbst, wie sie mich sehen mußte, ungewöhnlich mager, erschreckend blaß, höchst dürftig gekleidet, nachlässig in der Haltung, mit jener bewußten Gleichgültigkeit gegen den äußeren Menschen, der damals das Zeichen des Geistigen sein sollte. Nein, nein, sie konnte mich nicht erkennen, und sie sollte mich nicht erkennen. Und im übrigen, was wollte ich von ihr? Ich wollte ihr eine Freude machen. Sonst nichts. In den nächsten Tagen geschah es, daß Annie R., wenn sie abends ins Café kam, vor allem schnell zum Büfett ging und fragte: »Ist ein Brief für mich da?« War nichts da, so sagte ihr Gesicht: schade. Und zuweilen blickte sie ringsumher und sagte deutlich und ganz laut: »Schade.« Ich muß übrigens hinzufügen, daß ich einige List darauf verwendete, nicht entdeckt zu werden. Ja, diese Angst ging so weit, daß ich mich bezwang und von Zeit zu Zeit einige Tage vom Café wegblieb, weil ich durch meine regelmäßige Anwesenheit aufzufallen fürchtete. Es kostete mich sehr viel Überwindung, an dem Tage, an dem der dritte Brief eintraf, dem Café fernzubleiben. Nach und nach bürgerte es sich ein, daß Gabriel Gram alle drei, vier Tage einen Brief absandte. Kein Zweifel, Annie R. wartete schon auf diesen Brief, ihre Phantasie war entzündet, und der unbekannte Huldiger bedeutete ihr vielleicht mehr als die allzu Bekannten am Stammtisch. Aber ich sollte die Feigheit meiner Huldigungen büßen. Je enthusiastischer meine Briefe wurden, desto bitterer fraß sich in mir das Bewußtsein ein, wie groß wird die Enttäuschung sein, wenn sie dich nun leibhaftig vor sich sieht? Und weil ich als Gabriel Gram etwas in ihrem Leben zu bedeuten schien, deshalb gab ich die Partie für Stefan Großmann verloren. Närrisches Jugendspiel, das zwei, drei Monate dauerte. Dann schien es mir, als ob nicht Annie allein, sondern auch alle ihre Freunde das Café absuchten. Es blieb mir nichts übrig, als zu schreiben und aus dem Griensteidl wegzubleiben oder meine Ecke zu besetzen und nicht mehr zu schreiben. Ich mußte Gabriel Gram wieder abtreten lassen, wenn ich als Stefan Großmann existieren wollte. Anfang Juli fand das Versteckspiel sein Ende. Annie R. war an das Kurtheater in Ischl engagiert. Das Café Griensteidl, im Sommer immer leer, schien an diesen heiteren Juliabenden vollkommen ausgestorben. Fast als einziger saß ich in meiner Nische und starrte zu dem Tisch, der leer blieb. An einem solchen Sommerabend voller Sehnsucht setzte ich mich im Griensteidl hin und wagte den ersten Brief nicht mehr als Gabriel Gram, sondern mit meinem wahren Namen zu unterzeichnen. Zwei Tage darauf konnte ich am Büfett die Antwort entgegennehmen. Es war ein ungewöhnlich liebenswürdiger und geradezu freundschaftlicher Brief. Natürlich, schrieb sie, habe sie schon seit Wochen gewußt, daß die Briefe nur aus meiner Nische kommen könnten, aber sie habe mich nicht gegen meinen Willen demaskieren wollen. Und im übrigen fragte sie mich, ob ich denn krank sei, so sähe ich aus, und ob ich denn nicht für vier Wochen ins Salzkammergut in ihre Nähe, »zu mir«, kommen könne. Ich steckte den Brief lautlos in die Tasche, ich drehte mich um, um zu sehen, ob niemand mich beobachtete, wie ich Annie beobachtet hatte. Es war keinMensch an diesem heißen Sommerabend im Café. Da zog ich den Brief aus der Tasche und las ihn, am Büfett stehend, noch einmal. Und dann setzte ich mich in meine Nische und las den Brief ein drittes Mal.
Ich konnte nicht auf vier Wochen ins Salzkammergut. Knirschend hatte ich noch meinen Bürodienst zu absolvieren. Aber ich konnte jeden Sonnabendnachmittag nach Ischl, ich konnte eine Nacht und einen Tag dort verbringen und in der Nacht vom Sonntag auf Montag zurückkehren. Es hatte sich herausgestellt, daß Gabriel Gram kein schlechter Wegmacher für mich gewesen. Sanft hatte er die Enttäuschung in der Wirklichkeit schriftlich vorbereitet. Der Kristallisationsprozeß, von dem Stendhal spricht, war geglückt. Annie R. sah mich nicht, wie ich war, sondern wie ich in ihrer Vorstellung lebte, und da ich überdies in einem Zustand hellster Verzauberung war, und da ich schweigen durfte, nachdem ich ihr das Schönste schon geschrieben hatte, und da weit und breit kein Stammtischfreund unser Beisammensein störte, und da wir auf diese Stunde des Zusammenseins monatelang gewartet hatten, so hätte der kleine Roman seinen normalen und banalen Verlauf nehmen können. Aber wir waren beide blutjung. Die Spannung zwischen uns war vielleicht zu groß. Die Angst, etwas von diesem ganz unerwarteten Glück zu verlieren, lähmte mich, und meine Leidenschaft machte mich zaghaft. Ich war ein junger Joseph, aber Annie war keine Frau Potiphar. So sahen wir uns mit trunkenen Augen an, spürten uns, zerdrückten uns die Hände und sind einander doch nicht ganz nahe gekommen. Möglich, daß immer noch Gabriel Grams Schatten zwischen uns stand, möglich, daß hinter all ihren lieben und zärtlichen Worten doch eine innerste Enttäuschung verschwiegen blieb. Freilich, wenn ich am Montag früh ins Büro kam nach einer Nacht, die ich in der dritten Klasse im Gedränge sitzend oder stehend, im Halbschlaf – ach, wieder ein Schlafdefizit! – verbracht hatte, fühlte ich mich wie zerschmettert. Doch die Wochentage gingen hin, und ein neuer Sonntag kam. Dieses schöne und entnervende Spiel dauerte bis in den September.
Vom Herbst an war Annie R. an das Wallner-Theater in Berlin engagiert, und das bedeutete für mich den zweiten Aufbruch aus Wien. Der Koffer, mit dem ich nach Berlin fuhr, war wohl etwas größer als der, mit dem ich nach Paris gereist war. Meine Brieftasche enthielt ein paar kleine Banknoten mehr als die fast leere Börse, die ich in den Schweinezug genommen hatte. Aber im Grunde hatte ich wieder, ganz aufs Geratewohl, meine bürgerliche Existenz abgebrochen. Ich hatte für Berlin ein sehr kurzes und sehr klares Programm: ich wollte mit Annie zusammen sein, und ich wollte nie mehr Büroarbeit tun.