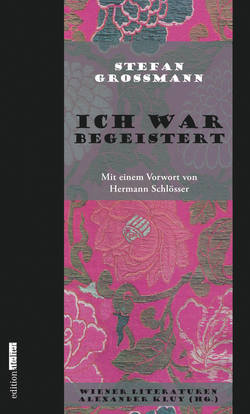Читать книгу Ich war begeistert - Stefan Großmann - Страница 9
Tänze im Branntweinladen
ОглавлениеIch habe nicht die Absicht, die Geschichte meiner Kindheit zu schreiben, wozu auch? Derlei Konfessionen machen nur den Psychoanalytikern Spaß, und wer möchte diesen Talmudisten des Unterleibes Spaß machen? Ich überspringe also die erste Kindheit.
Mein Vater war nach dem großen Krach der siebziger Jahre verarmt, und schlimmer noch, er hatte jede Lust verloren, sich wieder hinaufzuarbeiten. Er hatte die Fähigkeit des Orientalen, stundenlang in göttlichem Nichtstun auf einer Caféterrasse in der Praterstraße zu sitzen bei einem Schwarzen und sehr vielen Gläsern Wasser, und je älter er wurde, umso schwächer wurde seine Aktivität, und umso länger saß er auf der Caféhausterrasse und sinnierte vor sich hin. Mit dem letzten Reste unseres Vermögens hatte meine Mutter ein kleines Teegeschäft in der Praterstraße gekauft, in einem jener schönen zweistöckigen Altwiener Häuser mit großem Hofe und sehr vielen Straßen- und Hofbalkons. Das Haus hieß, weil es an der Ecke der Weintraubengasse stand, das Weintraubenhaus. Das Teegeschäft, das wir besaßen, hatte einen wunderschönen kleinen Chinesen, der mit übergeschlagenen Knien im Auslagefenster saß, und hinter ihm waren große bunte Teekisten und Teepäckchen aufgestapelt. Fast nur zum Schmuck standen daneben etliche Flaschen Jamaika-Rum. Unglücklicherweise schien die Bevölkerung der Praterstraße eine Abneigung gegen das Teetrinken zu haben; es konnten viele Stunden vergehen, ohne daß die Klingel von der Ladentür klirrte. Meine Mutter, energisch wie sie war, erkannte bald, daß wir dem zweiten Konkurs entgegengingen, und mein Vater, der fast ebenso gleichgültig wie der philosophische Chinese im Auslagefenster die drohende Katastrophe übersah, wurde aufgepulvert. Meine Mutter beschloß, das Übergewicht der Teekisten und Teepäckchen zu beseitigen und die Jamaikaflaschen in den Vordergrund des Auslagefensters zu stellen. Was aber war eine geschlossene verkapselte Rumflasche? Vor allem bekam die Rumflasche Nachbarschaft. Es wurden die herrlichsten glänzendsten Bouteillen polnischer Schnäpse neben sie gestellt, noch heute schwirren mir ihre Namen durch den Kopf: Kontu- schowka, Malakoff, Rostopschin – meistens wurden die stärksten polnisch-russischen Schnäpse nach russischen Generälen genannt. Die grünen, hellgelben, wasserklaren Schnäpse glitzerten in den wohlgeformten Flaschen. Aber es war wichtig, nicht nur Flaschen, die verkorkt und verkapselt waren, auszustellen, sondern – meine energische Mutter wußte das sehr gut – es kam darauf an, die Schnäpse in kleinen Mengen, womöglich in offenen Gläsern an die Bevölkerung loszuwerden. Dazu war eine besondere Erlaubnis des Magistrats nötig. Es gelang meiner Mutter, den Vater aus seiner Caféterrassenbeschaulichkeit herauszureißen, und da er unter den Gemeinde- und Bezirksräten viele Freunde hatte, so erhielt er eines Tages die gewünschte Schankkonzession.
Der Tag war sicher entscheidend für mich, das sollte ich später spüren. Meine Mutter erkannte, daß die beste »laufende Kundschaft« zwischen vier und sieben Uhr früh, wenn Wirtshäuser und Cafés geschlossen waren, sich hierher verirren müsse. Wir wohnten damals an der Donau, nicht am Kanal, der grau durch die Stadt fließt, sondern an der richtigen grünengroßen Donau, die etwa eine halbe Stunde weit draußen an den Praterauen vorbeifließt. Eines Tages wurde beschlossen, daß ich jeden Morgen um vier Uhr diesen Laden aufsperren solle. Ich besuchte damals die Realschule, ein dreizehnjähriger Junge. Unvergeßlich, auch heute noch, diese Wege nachts oder im Morgengrauen, zu Fuß – die Straßenbahn fuhr noch nicht – von der großen Donau in die Praterstraße. Schließe ich die Augen, so sehe ich diesen Weg vor mir, meistens den Winterweg im Schnee, schlecht beleuchtet, ungepflastert, menschenleer. Kam ich vor dem Weintraubenhaus an, so war der Laden noch kalt, dumpf, ungeheizt und roch nach Rum und Schnäpsen. Das erste, was ich zu tun hatte, nachdem ich die Gasflamme angezündet, war, ein kleines Feuer in dem eisernen Öfchen zu machen. Aber ich fror noch immer schmählich; ich glaube, man friert als Kind fast so sehr wie als alter Mann, und man friert doppelt und dreifach, wenn die Augen noch voll Schlaf sind. Flackerte erst das Feuer im Öfchen, so hatte ich ein sehr einfaches Mittel, mich warm zu machen: ich lief und tanzte im Kreise durch den verhältnismäßig großen Laden und sang dazu ein Couplet, das ich noch heute vorzutragen imstande bin, es hatte den Refrain: »Sehn’s, so heiter ist das Leben in Wien«. Wie kam ich zu diesem aus vielen anderen Wiener Liedern?
Das Weintraubenhaus lag direkt neben dem alten Karl-Theater. Dank dieser Nachbarschaft war meine Jugend von Theaterluft durchströmt. Ich kannte sehr früh schon Zuschauerraum und Bühne, Schauspieler und Habitués, Kulissenschieber und Garderobefrauen. Dort hatte ich eine Wiener Posse gehört, in der ein heute längst verschollener Komiker dieses Tanzcouplet, während er im Kreise über die Bühne hüpfte, allabendlich zu singen pflegte. Jeden Morgen übte ich mit hohen Sprüngen dieses Tanzlied – die einzige gymnastische Übung meines Tages –, langsam wich der Schlaf aus den Augen, und das Blut strömte warm in Füße und Hände. Ich freute mich selber an meinem musikalischen Monolog, und trotzdem diese Morgenstunden zwischen vier und sieben Uhr das beste meines Schlafes weggenommen hatten, war ich, wenn ich meinen Rundgesang absolviert hatte, froh und guter Dinge. Zuweilen gab ich eine zweite Nummer zu, es war ein ganz dummes Lied, das aber den Vorteil hatte, daß ich dabei meine wachsende Tenorstimme mächtig fühlen konnte. Ich schmetterte es zu den Flaschen, den Fässern im Hintergrunde und wurde nur dann und wann gestört durch den Eintritt eines Gastes, der sein Gläschen begehrte.
Die Kundschaft bestand aus Arbeitern, die auf dem Wege in die Fabrik einen kräftigen Schnaps zu sich nehmen wollten, aus Fiaker- und Einspännerkutschern, die ihren nächtlichen Standplatz am Karl-Theater für eine Viertelstunde verließen, um sich an meinem Öfchen und an unserem Schnaps zu wärmen, und aus armen halb erfrorenen Frauenzimmern, die ihre traurigen Nachtmärsche mit einem Vanillelikör oder einem kräftigeren Allasch unterbrachen.
Ich bin noch heute nicht imstande, diese eigentlich melancholischen Situationen des um den Schlaf betrogenen Jungen anders als heiter und mit innerster Dankbarkeit anzusehen. Niemals hätte ich jene natürliche Beziehung zu den einfachen Leuten, die mir mein ganzes Leben lang treu geblieben ist, ohne diese Morgenstunden im Schnapsladen erreichen können. Niemals hätte ich die Verbundenheit mit den Arbeitern aus Büchern lernen, und nie hätte ich den Irrsinn der Mechanisierung des erotischen Lebens so deutlich erfassen können als damals, als diese vom Nachttrabe erschöpften Freudenmädchen bescheiden sich auf das Bänkchen hockten, wohin ich ihnen ihren Vanillelikör brachte.
Die Kutscher wurden meine besten Freunde, die Arbeiter brachten dem dreizehnjährigen Jungen die ersten sozialistischen Zeitungen. Jawohl, ich war zu früh aus dem Schlaf gerissen, aber ich danke diesen Morgenstunden mein geistiges und politisches Erwachen. Und zu allem immer wieder die Nähe des alten Karl-Theaters. Der kleine, schlecht erleuchtete Laden, voll von Schnapsluft und Pfeifenrauch, war immer wieder durchsummt von den Liedern aus dem Karl-Theater. Eine merkwürdige Mischung von politischem Verschwörertum, sozialer Erbitterung und musikseliger Tanzfreudigkeit herrschte hier zwischen vier und sieben Uhr morgens.
Um halb acht Uhr löste mich meine Mutter ab. Dann bekam ich schnell einen dünnen Kaffee mit einer Semmel, packte meine Bücher in den Ranzen und wanderte in die Realschule. Saß ich erst in meiner Bank, so meldete sich das fürchterliche Schlafdefizit dieser Monate und Jahre. Besonders in der Chemiestunde, wenn Formel auf Formel mir entgegenwankte, begann ich immer wieder einzunicken. Eines Tages schüttelte mich der Chemieprofessor wach, der gleichzeitig mein Ordinarius war – der Gute, ich werde seinen Namen Cyrill Reichel nicht vergessen –, und fragte: »Zum Teufel, Großmann, warum sind Sie denn immer so schläfrig?« Ich antwortete ehrlich: »Weil ich um drei Uhr aufstehen muß.« Der gute Cyrill – ich sehe seine buschigen Brauen und seinen dicken breiten Schnurrbart noch vor mir – fragte: »Was, um drei Uhr müssen Sie aufstehen?« Und nun erzählte ich ihm, übrigens keineswegs in anklägerischer Art, sondern um mich zu entschuldigen und zu verteidigen, von meiner Morgenarbeit. Er hörte mir zu, ich weiß nicht, ob er an meinen Worten zweifelte. Aber etwa eine Woche später stand ich eines Tages hinter der Budel und traute meinen Augen nicht, als sich die Glastür öffnete und mein Chemieprofessor Cyrill Reichel mitten unter Kutscher, Proletarier und Huren eintrat. Es war der einzige Augenblick in jenen Morgenstunden, in denen ich zu zittern begann; nie hatte ich, wenn ich so allein in dem leeren Laden stand, den Gedanken gehabt, ich könnte überfallen und die spärliche Kasse könnte geraubt werden; immer waren meine Nerven in ungestörter Zuversicht. Aber – als jetzt der Chemieprofessor eintrat, da hatte ich nur ein Gefühl: wie kommst du eigentlich dazu, mich in meiner privaten Sphäre aufzustöbern? Ich hatte nur die Empfindung der Unzulässigkeit seiner Visite. Ihn ging nur an, was ich in der Schule trieb, über mein Leben außerhalb der Schule hatte er kein Aufsichtsrecht. Erst viel später habe ich begriffen, daß es die freundschaftlichste Handlung war, die der gute Cyrill mir erwiesen hat. In dem Augenblick seines Erscheinens empfand ich nichts als störrische Wut.
Wenige Tage darauf wurde mein Vater zum Direktor der Realschule gerufen, und es wurde ihm in entschiedenen Worten vorgehalten, daß ich unmöglich der Schule folgen könne, wenn ich schlaftrunken und schon ermüdet in den Unterricht komme. Cyrill Reichel siegte. Der nächtliche Zulauf im Branntweinladen war von Tag zu Tag, oder eigentlich von Nacht zu Nacht gestiegen. Meine Mutter stellte eine Kassiererin an, und ich konnte bis sieben Uhr morgens schlafen.
Aber der Realschule war ich nun doch entfremdet. Mein geistiges Zentrum lag nicht mehr in der Schule, und deshalb fehlte die Aufgeschlossenheit und Aufmerksamkeit des Schülers. Ich saß wohl in der Schulbank, aber ich hatte mich innerlich abgesperrt und dem Einfluß der Lehrer vollkommen entzogen. Zwei Lehrer spürten das, der Turnlehrer Albin Horn, ein grobschlächtiger, antipsychologischer Geselle, der die geistige Verachtung verdiente, die damals den Turnlehrern entgegengebracht wurde. Ich war ein schmächtiger und blasser Junge, ein fanatischer Leser – ich erinnere mich, daß ich sehr oft auf der Straße im Gehen las, zuweilen sogar in der Dämmerung, so daß ich nur, von Laterne zu Laterne hüpfend, schnell einen Blick in das Reclambüchel werfen konnte. Diesen geschwächten, übergeistigen Jungen hätte ein verständnisvoller Turnlehrer erst recht heranziehen und zu körperlicher Aktivität verlocken müssen. Mein Albin Horn wurde über meine gymnastische Unzulänglichkeit so böse, daß er das faustdicke Seil, das für Springübungen an der Wand hing, herunterholte und mich damit verhaute. Ich kann nicht sagen, daß ich darüber unglücklich war, denn schon in dem Moment, in dem ich mißhandelt wurde, hatte ich den Plan gefaßt, mittels dieser Mißhandlung mich von dem Turnunterricht gänzlich zu drücken. Ich ließ mir die Züchtigung nicht gefallen, sondern rannte zum Entsetzen Albin Horns auf der Stelle zum Direktor, und zehn Minuten später war ich vom Turnen für immer dispensiert.
Der andere Lehrer versuchte das Interesse für die Schule auf mildere Art zu entfachen. Es war der Professor für Deutsch und Geographie, Dr. Franz Willomitzer, der Herausgeber einer ausgezeichneten deutschen Grammatik, in der ich noch heute mit Vergnügen blättere. Er sah sehr soigniert aus, wir bewunderten seinen modischen Anzug, seinen sorgfältig gepflegten Henri IV-Bart, und, was noch wichtiger war, er verstand es, durch seinen freien Vortrag unsere, auch meine Aufmerksamkeit zu fesseln. Er war ein deutschgesinnter Liberaler, und seine nationale Oppositionsstellung gegen den Völkermischmasch Österreichs kam auch in seinen Vorträgen zum Ausdruck. Er wagte es, aus den offiziellen Geschichtsbüchern die lakaienhaftesten Dithyramben auf die Habsburger wegzustreichen. Er murmelte so nebenbei, wenn wir auf diese Geschichtsklitterungen stießen: »Diesen Passus können Sie übergehen.« Eines Tages kam er in die Stunde, den Pack blauer Schulhefte unter dem Arm. Wir hatten einen Aufsatz über den Charakter des armen Spielmannes in der Novelle von Franz Grillparzer zu schreiben. Professor Willomitzer stieg langsam das Podium empor, legte mit einer gewissen Feierlichkeit die Schulhefte auf den Kathedertisch, machte eine Spannung erzeugende Pause und sagte dann in jenem halblauten Ton, auf den wir viel mehr lauschten als auf die Überdeutlichkeit der anderen Lehrer: »Den besten Aufsatz hat Großmann geschrieben; man könnte ihn, so wie er ist, drucken.« Dieses beinahe hingenuschelte Lobeswort ist für mein Leben entscheidend geworden, von diesem Augenblick an war ich Schriftsteller! Übrigens bin ich dem Thema des Grillparzerschen armen Spielmannes treu geblieben. Die Figur des Musikers, der ein Hubermann ohne Geltungsbedürfnis war, zu stolz, um nach dem Ruhm der Presse und des Publikums zu gieren, dieser Musiker von Natur, der lieber vor Kindern in der Brigittenau aufspielte als vor abgestumpften Zeitungsschreibern und Damen in Abendtoilette, dieser bedürfnislose Verschwender steht meinem Herzen heute noch so nahe wie damals in der Schulbank. Ich sehe ganz Österreich von vielen armen Spielmännern bevölkert, die aus ihrer Brigittenau nicht hinausfinden und nicht hinausfinden wollen! … Meinem gütigen Lehrer Franz Willomitzer habe ich als Schriftsteller noch viele Jahre jede Arbeit, die mir gelungen schien, zugeschickt, und er schrieb mir immer wieder ein paar verständnisvolle, selten auch ein paar lobende Worte dazu. Ich habe in meinem Leben Lob selten vertragen. Im Grunde bedeutet Lob eine noch größere Anmaßung als Kritik. Nicht vielen Menschen habe ich das Recht eingeräumt, mich zu loben, aber mein alter Deutsch-Professor Franz Willomitzer steht noch heute zuweilen hinter meiner Schulter und murmelt mir zu: »Klare Disposition, Großmann, das ist das Wichtigste.«
In der siebenten Realschulklasse, ein halbes Jahr vor der Matura, lief ich aus der Schule. Ich hatte kurz vorher eine Prüfung in Mineralogie abzulegen. In zwei Nächten hatte ich mir das Lehrbuch eingepaukt, ohne auch nur einen Stein vor Augen gehabt zu haben. So schnell wie ich den Lehrstoff aufgenommen, so hurtig hab’ ich ihn auch wieder vergessen. Als ich mir auf dieselbe Art »darstellende Geometrie« einbläuen sollte, vielleicht für vier Tage, da lief ich davon. Sich dieses Diarrhöe-Wissen anzueignen, war zu sinnlos. Mein Vater lag in schwerem Siechtum zu Bett, ein halbes Jahr lang, während ich im Prater herumbummelte oder in der Universitätsbibliothek hockte oder die Bücher des Arbeiterbildungsvereins Gumpendorf durchackerte, ein halbes Jahr lang habe ich meinen Vater belogen und ihm Schulbesuch vorgetäuscht. Es gehört heute noch zu meinen Schreckensträumen, daß ich am Bett meines schweratmenden Vaters stehe und er dahinterkommt, daß ich all die Zeit die Realschule geschwänzt habe.
Nicht nur meiner Familie war ich entfremdet, all die Leute, die mir sagten: »Du mußt an einen Broterwerb denken; der Mensch lebt nicht nur von Luft. Geld, Geld, Geld, darauf kommt es an«, all diese Leute redeten eine andere Sprache als ich. Ich war von den Arbeitern, denen ich in jenen frühen Morgenstunden ein Gläschen Schnaps vorgesetzt hatte, sozialistisch infiziert worden. Ich hörte täglich von Verhaftungen, Konfiskationen, harten Richtersprüchen, und alles, was jung, knabenhaft und unverbildet in mir war, trieb mich zu den Verfolgten, deren Rechtschaffenheit und Selbstlosigkeit ich in den Morgenstunden vor der Schule – gründlichere Schule! – besser als Polizisten, Richter und Fabrikanten kennengelernt hatte.
Nie wäre der Sozialismus mit solchen Affektwerten geladen worden, wenn nicht die Romantik der Staatsverbote und die noch lockendere Romantik des Einsatzes der eigenen Person, der lodernde Zauber der Gefahr den einzelnen jungen Menschen an die Sache innerlich gebunden hätte. Während ich so, nicht durch volkswirtschaftliche Theorien, sondern vor allem durch das Abenteuer der Geheimbündelei in die sozialistische Bewegung verstrickt wurde, wuchs meine Isolierung in der Familie. Meine von Sorgen bedrückte und durch das Siechtum des Vaters doppelt besorgte Mutter erschien meinem halb knabenhaften Geist merkwürdigerweise als die Inkarnation des kapitalistischen Denkens. Geld, Geld, Geld, das sie nie hatte und nie in größeren Mengen zu erwerben imstande war, Geld war das wichtigste Wort in ihrem Wörterbuch. Der merkantile Geist der Verwandten, dieses ewige Zweckdenken, und noch dazu das Denken an sehr kleine Zwecke, erzeugte in mir, ich kann es nicht leugnen, antisemitische Regungen. Ich erinnere mich sehr deutlich an einen Versöhnungstag der Juden in der Leopoldsstadt, an dem sie in Feiertagskleidung nach dem Tempel durch die Straßen promenierten. Ein kleiner Junge stand vor dem geschlossenen Laden eines Geschäftes mit einem Farbentopf in der einen und einem Pinsel in der anderen Hand. Mit diesem Pinsel malte er auf die geschlossene Geschäftstür die Worte: »Hoch Schönerer.« Schönerer – das war der Name eines deutschvölkischen, judenfeindlichen Führers, der eine Zeitlang in Wien volkstümlich war. Der kleine Judenjunge verdeckte mit seiner Figur die gemalte Schrift, die Spaziergänger ahnten nicht, welche Überraschung er tückisch für sie vorbereitete. Plötzlich bemerkte ein Vorübergehender, mit schwarzem Gehrock und Zylinder angetan, die provozierende Inschrift. Im Nu wurde dem Jungen Pinsel und Farbentopf aus der Hand gerissen, und die Hiebe hagelten auf den Buben von allen Seiten herunter. Nicht nur weil die Großen in einer so starken Übermacht waren, schlug mein Herz für den kleinen bösartigen Jungen, sondern ich begriff schon damals den antisemitischen Protest des jüdischen Knaben, und ich schloß mich ihm an. Die sozialistische Bewegung in ihren Anfängen war übrigens reich an antijüdischen Protesten. Engels hat den toten Lassalle einen Baron Itzig geheißen, Marx hat sich in seinem viel zu wenig beachteten Aufsatz über die jüdische Frage vernichtend antijüdisch geäußert. Es kam gerade den jüngsten Führern des Sozialismus darauf an, sich von dem jüdischen Kleinbürgertum, dem sie entsprossen, zu distanzieren. Auch ich habe diesem instinktiven Antisemitismus meiner Jünglingsjahre einen entscheidenden Ruck zu danken, nämlich die Loslösung von der Familie.
Eines Abends ging ich mit jungen Gesinnungsgenossen in eine Versammlung, in der ein verschollener Apostel, Dr. Theodor Hertzka, über die Gründung eines sozialistischen Experimentsstaates in Uganda redete. Das war nun die verlockendste von allen Theorien: Sozialismus plus Afrika, eine funkelnagelneue, nur auf Erkenntnis aufgebaute Mustergesellschaft. Hertzka nannte seinen Staat, nach dem er strebte, »Freiland«. Die dogmatischen Marxisten verhöhnten den Utopisten, aber unsere Wangen wurden heiß, wenn wir an »Freiland« dachten, und wir diskutierten das Freilandprojekt viele Abende lang. Einmal hatte ich das Glück, von Dr. Hertzka zu einer Diskussion in seine Wohnung geladen zu werden. Nur Auserwählte, die an dem Bau mitwirken sollten, waren gekommen. Die Besprechung dauerte bis ein Uhr nachts. Aber wer sah an diesem Abend auf die Uhr? Ich kam zum erstenmal sehr spät nach Hause, ich mußte dem Hausmeister Sperrgeld bezahlen – unerhörte Verschwendung in den Augen meiner Mutter –, dann mußte ich an der Wohnungstür läuten und meine Mutter aus dem Schlaf wekken. Aber Uganda war ja ganz nahe, die ersten Beträge für den Freiland-Staat waren gezeichnet, und die eigentliche Befreiung der Menschheit stand ja vor der Tür. Meine Wangen glühten noch vor Begeisterung, als ich meine Mutter aus dem Schlaf läutete. Nach wenigen Sekunden schlürfte sie heran, schlaftrunken und schlecht gelaunt. Sie hatte mir kaum die Tür geöffnet, da brannte mir schon eine Ohrfeige im Gesicht. Ich taumelte in mein Zimmer und beschloß, das Elternhaus morgen zu verlassen. Nach dem Mittagessen hatte ich meine Habseligkeiten in einen Koffer gepackt und war aus dem Reiche meiner Mutter verschwunden.
Ein Freund, Freiländer wie ich, der damals sein Einjährigen-Freiwilligen-Jahr absolvierte, nahm mich bereitwilligst in seinem Mietzimmer auf. Ich wußte noch nicht, wo ich morgen zu Mittag essen würde, aber ich war glücklich. Ich besaß dreißig Kreuzer. Mit diesem Vermögen in der Tasche lief ich abends in die Nähe des Karl-Theaters. Auf irgendeine Weise mußte ich den ersten freien Abend im Karl-Theater verbringen. Natürlich würde ich, wenn es sein mußte, zwanzig Kreuzer für die höchste Galerie geopfert haben, aber ich hatte Glück. Ich schlich gegen halb sieben Uhr am Bühneneingang herum, um sieben Uhr tauchte der Chef der Statisterie auf, dem ich dann und wann im Weintraubenhaus einen kräftigen Slibowitz gereicht hatte. Ich grüßte, er kam auf mich zu: »Kannst mittun heute abend, fünfundzwanzig Kreuzer.« Man spielte ein englisches Stück: A dark secret. Ich hatte mit einigen anderen Jungen und Mädchen an den Ufern eines Flusses herumzuwandeln, in den später der Komiker Karl Blasel hineinzuspringen hatte. Mit welcher Inbrunst wandelte ich zum erstenmal an den Ufern des Theaterstromes, wie neugierig blinzelte ich über die Rampenlichter hinüber in einen dunklen, manchmal von Murmeln und Gelächter belebten Zuschauerraum; zum erstenmal sah ich einen ununterbrochen zischelnden Souffleur in seinem Kasten, zum erstenmal erlebte ich die sorglos-frivol-unschuldigen Gespräche der kleinen Schauspieler. Ich stand hinter der dritten Kulisse mit brennenden Wangen und sah auf die Bühne, sah in die leere Hofloge. Plötzlich stand ein großes Mädchen in weißem Trikot neben mir. Sie hatte im Zirkusbild des nächsten Aktes zu tun. Ich muß ein vollkommen verwirrtes Gesicht gemacht haben, als sich das halb entkleidete Mädchen sanft an mich lehnte, und ich werde den schelmischen Ton ihrer Stimme nie vergessen, mit dem mir, zum erstenmal in meinem Leben, eine kleine lustige Laszivität ins Ohr geflüstert wurde.
Der Einjährige, der mir so hilfreich Nachtquartier angeboten, war eine besonders spannende Figur für mich, denn er hatte ein Liebesverhältnis. Der Kreis, in dem er lebte, war mir an den Freilandabenden bekannt geworden. Ich sah den Einjährigen – daß er in voller Uniform an der Gründung des Zukunftsstaates mitzuarbeiten wagte, erhöhte seinen Nimbus – immer in Begleitung von zwei Schwestern, großen Erscheinungen von römischer Schönheit. Ich kannte die Brüder dieser Schwestern, wir hatten in ihrem Hause zuweilen Musik gehört, Bücher eingetauscht und Bücher besprochen. Alle diese jungen Menschen waren drei, vier Jahre älter als ich, und zwischen einem siebzehnjährigen und einem einundzwanzigjährigen liegen zuweilen nicht vier Jahre, sondern liegt die Kluft einer Lebensperiode. Im Hause der römischen Schwestern wurde kein lautes Wort geredet. Die meisten dieser leise und bedeutsam geführten Gespräche verstand ich nicht. Ich weiß nur, daß das am meisten gesprochene Wort das Wort »Leiden« war. Jeder war stolz darauf, ein Leid auf sich genommen zu haben. Vielleicht war dies die Folge des Einbruchs der russischen Romane, die damals zum erstenmal mit Heißhunger verschlungen wurden. Dostojewski, Tolstoi, Turgenjew – wie konnten wir es wagen, nachdem wir das alles mit Begeisterung geschluckt hatten, zu leben ohne zu leiden? Im tiefsten Schatten Dostojewskis schienen die beiden römischen Schwestern selbst zu stehen, ihre schwarzen Scheitel waren ganz schlicht frisiert, und der tiefe Blick aus ihren wunderschönen großen Augen schien jeden zu fragen: leidest du auch? Am meisten fragten diese Blicke meinen Freund, den Einjährigen, der in seiner bunten Dragoneruniform eigentlich mehr unternehmend als leidend aussah. Das Schlimmste an der Geschichte war, daß die beiden Schwestern abwechselnd, einmal die ältere, einmal die jüngere, sämtliche Lebensfragen mit meinem Einjährigen nachts in seinem Zimmer zu besprechen pflegten. Das wäre nicht weiter bitter gewesen, wenn mich mein Freund nicht gebeten hätte, abends, wenn eine der Schwestern bei ihm zu Besuch war, nicht hinein zu kommen, sondern ihren Abschied im Vorzimmer abzuwarten. Dieses Vorzimmer war nun ein verdammt ungemütlicher, finsterer Raum, in dem man nicht einmal lesen konnte, und der Abschied der Schwestern zog sich, je länger die Beziehung dauerte, in umso spätere Nachtstunden hinaus; manchmal wurde es zwei, drei Uhr, bevor ich aus meiner andachtsvoll erduldeten Vorzimmerexistenz erlöst wurde. Warum harrte ich so sanftmütig aus? Es war der ungeheure Respekt vor dem »Erlebnis«, dem ersten in meiner Nähe, der mich stumm und geduldig machte. Die Liebe ging in meiner Nachbarschaft vorüber, und ich habe von jeher vor dem Blitzschlag der Leidenschaft eine andachtsvolle Regung gespürt. Es war schon ein gütiger Wink des Schicksals, daß die Liebe so dicht in meiner Nähe eingeschlagen hatte und daß ich sie also sehen konnte, ohne doch von ihr betroffen zu sein. Nur einen kleinen Nachteil brachte mir die Sache: ich war wieder in der schmählichsten Weise um meinen Schlaf betrogen, und mein Schlafdefizit stieg allmählich ins Uneinbringliche. Um die Abende, an denen das Zimmer des Einjährigen von einer der beiden Schwestern okkupiert war, auszufüllen, ging ich nun Abend für Abend in den Arbeiterbildungsverein Gumpendorf. Dort traf man Arbeiter und Handlungsgehilfen, Studenten und einige Doktoren, dann und wann auch einige junge Genossinnen, und auch hier wurde nach russischem Muster diskutiert, daß sich die Balken bogen. Nur an sehr heißen Sommerabenden blieb der bescheidene Klubraum leer. An einem schwülen Juliabend hatte in Gumpendorf eine Diskussion über Monogamie und Erbrecht stattfinden sollen. Es erschien bloß ein Schweizer Genosse, der Referent, und eine Genossin, aus Böhmen, die im Anfang der dreißiger Jahre stand. Der Schweizer, der auf die feurige Tschechin schon lange ein Auge geworfen, aber nicht den Mut hatte, ihr das zu gestehen, brachte kein Wort hervor. Er war wissenschaftlicher Theoretiker durch und durch. Nach langem geladenen Schweigen platzte der sachliche Mensch heraus: »Genossin, wollen Sie zu mir in geschlechtliche Beziehungen treten?« Erst nach Jahren haben wir über die Geschichte so lange gelacht, wie sie es verdiente. Die Sozialisten waren damals in zwei Lager geteilt, in die Radikalen und in die Gemäßigten. Ich wäre nicht siebzehn, achtzehn Jahre gewesen, wenn ich nicht mit Leib und Seele zu den Radikalen gehört hätte. Freilich waren die Themen, die wir uns stellten, etwas verzwickt, und man schlängelte sich nicht leicht mit seinen Schlagworten durch. So wurde viele Wochen über die Frage beraten und geredet: »Soll der Arbeiter durch Bildung zur Freiheit, oder soll er durch Freiheit zur Bildung gelangen?« Wir Jünglinge bürgerlicher Herkunft neigten dazu, daß der Arbeiter erst Freiheit und dann Bildung (die im vorigen Jahrhundert so überschätzte Bildung) erwerben solle. Aber die Arbeiter im Bildungsverein waren meistens entgegengesetzter Ansicht. Nein, nein, man müsse zuerst gebildet sein, und erst der gebildete Arbeiter gäbe einen verwendbaren Kämpfer ab. Wenn ich heute daran denke, wieviele Ideen und Ideale damals auf die Köpfe der von Tagesarbeit erschöpften Arbeiter losdonnerten, so bin ich erstaunt, daß sie diesen Anprall von vielzuviel Geisteskräften ohne innere Beschädigung überstanden haben. In unserer radikalen Gruppe, die den Übergang zu den anarchistisch Geführten bildete, hat noch eine besondere Diskussion jahrelang gewütet. Die Frage war: Individualismus oder Kommunismus. Ein schottischer Dichter, der nach Deutschland verschlagen war, John Henry Mackay, hatte Stirner entdeckt und in den Gärungstopf der Zeit den »Einzigen und sein Eigentum« geworfen. Aus diesem Hexenkessel von Bestrebungen und Tendenzen holte sich jeder heraus, was zu seiner Veranlagung am besten paßte. Die Anarchisten, die in ganz kleinen Gruppen arbeiten wollten, hielten sich für Individualisten, obwohl gerade sie die hingebungsvollsten Schwärmer gewesen sind. Wohingegen die nüchternen Köpfe, die einen großen, den ersten Konsumverein ins Leben zu setzen trachteten, sich als Kommunisten erklärten. Zuweilen wurde dieser Kampf der Theorien mit besonderer Erbitterung ausgefochten, und ich erinnere mich genau einer verhältnismäßig großen Versammlung in einem Vorort, in Fünfhaus, bei der die Individualisten die Kommunisten am Ende mit Bierkrügeln von ihren falschen Ideen abzubringen trachteten, die Kommunisten bearbeiteten die Individualisten mit Stuhlbeinen und Sesselkanten. Selten ist ein Kampf der Theorien mit so viel blutigen Löchern bezahlt worden wie an diesem Abend.
Ich genoß das Glück, frei über meinen Tag zu verfügen, ich las in der Universitätsbibliothek, was ich wollte. Meine Versuche, Marx zu lesen, sind freilich nur halb gelungen. Ich las die polemischen Schriften, besonders den Achtzehnten Brumaire, der ja einer der hinreißendsten politischen Pamphlete ist, mit Genuß, aber schon der erste Band des Kapitals – und ich bin über den ersten nie hinausgekommen – machte mir Schwierigkeiten. Mag sein, daß ich von Jugend an mich an unvergleichlichen Sprachkünstlern verwöhnt hatte. Wer das Schopenhauersche Deutsch, die klarste, biegsamste und dann wieder wie aus Eichenholz geschnittene Sprache, Seite für Seite genossen hat, der hatte an dem Marxschen Deutsch schwer zu kauen. Überhaupt lasen alle meine Freunde rings um mich Marx und seinen »Übersetzer« Kautsky, so daß ich eines Tages, als mir Vorwürfe über meine mangelnde Marx-Disziplin gemacht wurden, mit einigem Recht erwidern konnte: »Müssen wir denn alle den gleichen Weg gehen? Wenn ihr alle Marxisten seid, dann brauche doch ich es nicht auch noch zu werden.«
Tagsüber saß ich viel bei den römischen Schwestern. Ihr »Leid« realisierte sich allmählich, ich hatte noch keine Ahnung, in welcher Richtung. Die schönen hochgewachsenen Mädchen wurden blaß, und ihre Augen tränten leicht. Beide dichteten ein bißchen. Eine von ihnen, die ältere und größere, die ich immer mit besonderer, ich möchte sagen, scheuer Andacht beobachtete, trat in einer Dämmerstunde auf mich zu und und fragte mich mit dem Leidenston, der damals üblich war, fast hingehaucht, während der volle Blick ihrer großen Augen in mich tauchte: »Liebst du mich?« Ich war in größter Verlegenheit, an nichts hatte ich weniger gedacht. Es interessierte mich, zuzuschauen, wie die anderen romantisierten, aber ich selbst hatte eher eine leise Abneigung gegen diese Seelenübungen. Die allgemeine Mimosenhaftigkeit hatte merkwürdigerweise in mir eher einen gewissen brutalen Trotz wachgerufen. In meiner Verwirrung und, aufrichtig gesagt, um nicht unhöflich zu erscheinen, antwortete ich auf die Seelenfrage: »Ich weiß es nicht.« Ich hätte, wenn ich ganz aufrichtig gewesen wäre, hinzufügen müssen: Ich habe darüber noch nicht nachgedacht. Aber ich glaube, daß meine rechtschaffene Antwort die schöne Römerin verstimmt hat. Nie mehr ist zwischen uns von Liebe die Rede gewesen. Freilich stellte sich nach einiger Zeit heraus, daß beide Schwestern in anderen Umständen waren. Mein Einjähriger hatte auf ziemlich skrupellose Weise Seelenromantik getrieben –, und dafür hatte ich nun den Schlaf meiner Nächte hergeben müssen! Die leidselige Stimmung des Kreises war mir schon lange unerträglich geworden. Ich hatte mir ein Heftchen Epigramme angelegt, und es macht mir noch heute Spaß zu denken, daß ich junger Kerl inmitten dieser ausschweifend gefühlvollen Umgebung Epigramm auf Epigramm gespitzt habe. Gegen die allgemeine Mitleidswelle, gegen das wahllose Mitleid mit Jedermann lehnte ich mich auf. Ich schrieb in mein Epigrammheft:
Mitleid mit allen Betrübten?
Freund, wer hätte so viel Gefühl.
Also sei es unser Ziel:
Mitleid mit den Geliebten.
Das kann ich noch heute, einige Jahrzehnte später, so ziemlich unterschreiben.
Ich habe zu erwähnen vergessen, daß die eigentliche Grundlage meiner freien Existenz ein paar Lektionen waren, die mir Professor Willomitzer verschafft hatte. Obwohl ich aus der Realschule davongerannt war und obwohl ich ihm in einem Ermahnungsgespräch, das er zu führen sich bemüßigt fühlte, meinen scheinbar müßiggängerischen Tag erzählt hatte, hat er mir nicht nur Stunden, die ich seinen Schülern gab, gelassen, sondern mir noch eine besondere deutsche Grammatikstunde verschafft. Ich verdiente gerade so viel, um mittags das Essen in der Volksküche, abends einen bescheidenen Imbiß in der Nähe des Arbeiterbildungsvereins zu bezahlen. Aber die schlechte Ernährung, die Schlaflosigkeit, diese verfluchten Seelenromane in meiner Nähe, all das zehrte an mir. So konnte ich nicht weiterleben. In dieser Situation geschah es, daß einer der Arbeiter, die ich in den Morgenstunden im mütterlichen Geschäft kennengelernt, der Monteur Matthias Huber, nach Paris ging. Er lud mich ein, mit ihm zu kommen. Huber war ein kleiner, stiller, sanfter, etwa vierzigjähriger Mensch, der Freude am Denken hatte. Die echten Revolutionäre, die ich in meinem Leben traf, haben immer unansehnlich ausgesehen und so leise sich bewegt wie Zolas gut gesehener Souvarine. Mir fehlte das Geld zur Reise. In meiner Phantasie spielte es eine große Rolle, daß ich gehört hatte, es ginge allwöchentlich ein ungarischer Schweinezug nach Paris, der nur bis Wien von ungarischen Wärtern begleitet werde. In Wien wurden neue Leute engagiert, die im Notfall mit dem Bahnhofspersonal auch einige französische Worte sprechen konnten. Der Schweinezug dauerte fünf Tage. Ich könnte nun erzählen, daß ich auf einem solchen Zuge nach Paris gefahren bin. Aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, muß ich gestehen, daß ich es nicht mit voller Bestimmtheit behaupten kann. Ich habe so intensiv an diesen Zug gedacht, ich habe diese Waggons mit grunzenden Schweinen in so vielen Nächten vor mir gesehen, ich kenne den engen Sitz des Wärters, der nur durch eine schmale Holztür abgeriegelt ist, ich habe die endlose Dauer dieses langsam hinkriechenden Zuges – mindestens in meiner Phantasie – so oft und so lebendig empfunden, daß ich heute nicht mehr mit voller Bestimmtheit zu sagen vermag: bin ich in diesem Schweinezug gefahren, oder habe ich es nur geträumt oder gefürchtet? Habe ich es erzählt, weil es so gewesen ist, oder habe ich es erzählt, weil es so hätte gewesen sein können? Es hat in meinem Leben eine Menge Situationen gegeben, die, wenn ich sie oft geschildert habe, ihre wirklichen Konturen und Farben allmählich geändert haben. Wenn ich frei und ungezwungen erzählen soll, wie ich nach Paris gekommen bin, so würde ich die Reise im Schweinezug zum besten geben. Wenn ich aber vor mir selber einen Eid auf die Richtigkeit meiner Erzählung ablegen müßte, so würde ich zu stottern beginnen. Sei es wie es sei, an einem Herbsttage in der ersten Hälfte der neunziger Jahre kam ich in Paris an.