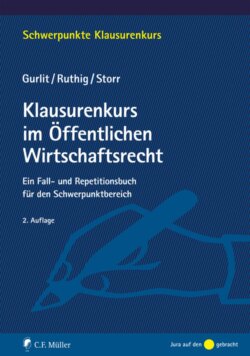Читать книгу Klausurenkurs im Öffentlichen Wirtschaftsrecht - Stefan Storr - Страница 53
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Lösung A. Die Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde I. Beteiligtenfähigkeit (Verfassungsbeschwerdefähigkeit)
Оглавление39
Verfassungsbeschwerde kann gem. § 90 Abs. 1 BVerfGG von „jedermann“ mit der Behauptung erhoben werden, in einem seiner Grundrechte oder grundrechtsgleichen Rechte verletzt zu sein. Gemeint sind solche des Grundgesetzes. Da die Verfassungsbeschwerdebefugnis also nicht auf die Verletzung von Unionsrecht gestützt werden kann, kann sich aus diesem auch nicht die Beteiligtenfähigkeit ergeben[1].
Exkurs:
Auch den Gewährleistungen der EMRK kommt kein Verfassungsrang zu, so dass sie ebenfalls kein geeigneter Prüfungsmaßstab für das Verfassungsbeschwerdeverfahren sind[2]. Das BVerfG zieht sie bzw die Entscheidungen des EGMR aber sehr wohl als Konkretisierungen der Grundrechte des GG heran[3]: Es müsse jedenfalls die Möglichkeit bestehen „in einem Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht zu rügen, staatliche Organe hätten eine Entscheidung des Gerichtshofs missachtet oder nicht berücksichtigt. Dabei steht das Grundrecht in einem engen Zusammenhang mit dem im Rechtsstaatsprinzip verankerten Vorrang des Gesetzes, nach dem alle staatlichen Organe im Rahmen ihrer Zuständigkeit an Gesetz und Recht gebunden sind (vgl BVerfGE 6, 32, 41)“.
Die Verfassungsbeschwerdebefugnis setzt voraus, dass der Beschwerdeführer überhaupt Träger von Grundrechten oder grundrechtsgleichen Rechten sein kann, knüpft also an die Grundrechtsfähigkeit an[4]. Während der Anspruch auf „ihren“ gesetzlichen Richter für alle Prozessbeteiligten gilt[5], bedarf die Verfassungsbeschwerdebefugnis bei S im Übrigen näherer Prüfung. Träger von Grundrechten können (außer natürlichen Personen) nach dem insoweit eindeutigen Wortlaut des Art. 19 Abs. 3 GG nur inländische juristische Personen des Privatrechts sein. Maßgebend für die Qualifikation als inländisch ist der (tatsächliche) Sitz[6]. Danach ist S als ausländische juristische Person einzuordnen. Allerdings folgt aus den Grundfreiheiten und dem allgemeinen Diskriminierungsverbot des Art. 18 AEUV das Verbot einer Ungleichbehandlung in- und ausländischer juristischer Personen. Jedenfalls im verfassungsgerichtlichen Verfahren lässt sich diese nur dadurch erreichen, dass man die Grundrechtsberechtigung juristischer Personen aus Art. 19 Abs. 3 GG auf juristische Personen aus Mitgliedstaaten der EU erstreckt[7].