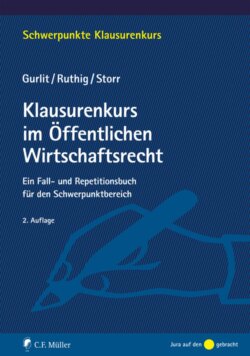Читать книгу Klausurenkurs im Öffentlichen Wirtschaftsrecht - Stefan Storr - Страница 65
На сайте Литреса книга снята с продажи.
bb) Die Systemgerechtigkeit der Ausnahmeregelung
Оглавление50
Allerdings hat der Gesetzgeber in § 7 Abs. 2 NRSG Ausnahmetatbestände geschaffen und damit selbst sein Schutzkonzept durchbrochen. Damit gibt der Gesetzgeber zu erkennen, dass er dem Gesundheitsschutz einen gegenüber einer ausnahmslosen Regelung nur reduzierten Stellenwert einräumt, wodurch sich auf der anderen Seite die Argumentationslast hinsichtlich der Rechtfertigung für ein Absehen von Ausnahmen auch für andere Bereiche zulasten des Gesetzgebers verschiebt. Solche Ausnahmeregelungen müssen sich daher auf ihre Konsequenz und Folgerichtigkeit überprüfen lassen[37]. Dies kann sub specie des Art. 12 GG als Frage der Angemessenheit, aber auch im Rahmen des Art. 3 GG geprüft werden[38].
Nicht zu beanstanden ist die flächenmäßige Begrenzung der Einraumkneipenregelung auf Räumlichkeiten mit weniger als 75 m². Diese dürfte sachgerecht sein[39], überschreitet aber vor allem nicht die Grenzen des gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums. Da Praktikabilität und Einfachheit des Rechts zu den notwendigen Voraussetzungen eines gleichheitsgerechten Gesetzesvollzugs gehören, ist der Gesetzgeber befugt, auch generalisierende und typisierende Regelungen zu treffen. Die Tatsache, dass der Umbau zu einer Mehrraumkneipe hier nicht an der Bereitschaft der S, sondern dem Denkmalschutzrecht scheiterte, steht dieser Typisierungsbefugnis daher wohl auch nicht entgegen.
Allerdings könnte die Regelung aus einem anderen Grund gegen die Verfassung verstoßen. Obwohl in Gaststätten, die über Nebenräume verfügen und in Einraumkneipen bis zu einer bestimmten Größe (§ 7 Abs. 2 NRSG) sowie in Wein-, Bier- und Festzelten (§ 7 Abs. 5 NRSG) das Rauchen erlaubt ist, fehlt es an Ausnahmeregelungen für die Erlebnisgastronomie, also solche Gaststättenkonzepte, die erkennbar durch eine Verknüpfung von Getränke- und Tabakkonsum gekennzeichnet sind. Insoweit könnte man an der Konsequenz und Folgerichtigkeit der Regelung zweifeln. Gerade weil der Gesetzgeber sein Schutzkonzept an der Gesundheit der Nichtraucher ausrichtet[40], überzeugt es nicht ohne Weiteres, dass solche Gastronomiekonzepte verboten werden, die sich überhaupt nur an Raucher wenden. Diese dürften kaum von Nichtrauchern aufgesucht werden und gefährden diese viel weniger als es etwa bei einem Festzelt der Fall ist. Dies gilt umso mehr, als die Umstellung für S jedenfalls in ihren Auswirkungen einer Betriebsaufgabe gleichkommen würde[41]. Damit kann man die Verfassungsmäßigkeit der Regelung verneinen. Allerdings besteht bei einer derart strengen Prüfung der Ausnahmen die Gefahr, dass man vom Gesetzgeber ein „alles oder nichts“ verlangt, wenn zwar ein generelles Rauchverbot verfassungskonform ist, eine Ausnahmeregelung aber zwangsläufig typisieren muss[42]. Dementsprechend hat das BVerfG in den späteren Entscheidungen wohl großzügigere Maßstäbe angelegt. Danach wäre es zulässig, die Ausnahmeregelungen ausschließlich an der Betriebsgröße zu orientieren. Allenfalls könnte man in einem solchen Fall vom Gesetzgeber eine Begründung für die Differenzierung verlangen[43], die im vorliegenden Fall allerdings fehlt. Auch ein solches Begründungserfordernis ist allerdings nicht unproblematisch, schuldet doch der Gesetzgeber nach verbreiteter Auffassung „nichts als das Gesetz“. Es muss daher genügen, wenn sich das hinter einer Regelung stehende Konzept aus dieser entnehmen lässt.
Hinweis:
In der Klausur sind selbstverständlich auch nach der eher knappen gegenteiligen Entscheidung weiterhin unterschiedliche Auffassungen vertretbar. Es kommt entscheidend auf die Begründung an.