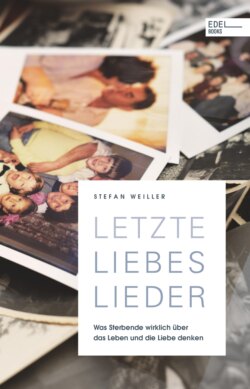Читать книгу Letzte Liebeslieder - Stefan Weiller - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VALSE MODERATO, VALSE LENTO Rainer, 83 Lippen schweigen
ОглавлениеManchmal, da höre man ihn ein bisschen summen. Weihnachtslieder oder Walzermelodien. Eine Pflegerin hat ihn einmal darauf angesprochen, was er denn da für ein schönes Lied gesungen habe. Aber der Mann wehrte ab. Er und singen? Niemals. Sie müsse es an den Ohren haben.
Er ist ein Kauz, aber ein netter. Und manchmal höre man ihn durch die Tür reden. Aber darauf spricht ihn keiner mehr verwundert an, denn er ist so gut wie nie allein. Er redet mit seiner Frau. Und er erzählt auch gern von ihr.
»Meine Frau liebt Kalendersprüche. Einer der glücklichsten Tage ihres Lebens muss der gewesen sein, als ihr die Idee kam, ihre liebsten Kalendersprüche nicht mehr schweren Herzens wegzuwerfen oder in einer Schublade verschwinden zu lassen, sondern sie mit bunten Magneten an den Kühlschrank zu pinnen. Mit jedem Jahr unseres Lebens kamen mehr kleine Zettel hinzu, manchmal mit Sprüchen eines Abreißkalenders, dann wieder irgendwelche Weisheiten aus Romanen und Frauenzeitschriften.
Der Kühlschrank wirkte mit der Zeit, als hätte er Ausschlag oder eine Art Gefieder aus Papier, das sich bei jedem Luftzug und beim Schließen der Tür aufzuplustern schien. Das Gerät hatte eine Art Eigenleben. Das will man doch nicht von einem Kühlschrank. Oder?
›Anna, kannst du nicht Socken stricken, wie normale Frauen auch? Oder sammle doch mal Kochrezepte.‹ Daraufhin hat Anna eine Woche nicht mit mir gesprochen. Als ich mürbe genug für ihre großzügige Vergebung war, hat sie mir klargemacht, dass ich sie ja liebe – und daher auch ihre Kalendersprüche und ihre schlechte Küche mitlieben müsse. Dazwischen gebe es nichts. Und ich solle froh sein, dass sie überhaupt für uns koche und meine Klamotten mitwasche. Und Strümpfe stricken? – Das ginge dann doch zu weit, meinte Anna. ›Strick du doch‹, sagte sie. Und bei dieser Gelegenheit: Heute sei ein guter Tag, mir die Waschmaschine und den Herd genauer zu erklären. Ich habe nie mehr ein Wort wegen des Kühlschranks gesagt.
Kam man also in die Küche, wurde man mit Sinnsprüchen bedrängt, wie etwa diesem: ›Wer alles mit einem Lächeln beginnt, dem wird alles gelingen. Dalai Lama.‹ Also nichts gegen Tibet, aber so viel gute Laune erträgt man doch nicht an einem Montagmorgen, wenn man um fünf aufstehen muss, um sich in die Arbeitswoche zu quälen. Aber Anna lachte.
Ein Kalenderspruch hat mich regelrecht beunruhigt: ›Wenn dir die Scheune abbrennt, kannst du endlich den Mond sehen und die Sterne. Mizuta Masahide, Dichterin und Samurai.‹ Ich sagte: ›Anna? Schatz? Kannst du bitte einfach das Fenster öffnen, wenn du den Mond sehen willst?‹
Und Anna lachte.
Lachen und Anna, das gehört zusammen:
›Immer wenn wir lachen, stirbt irgendwo ein Problem.‹ Diesen Spruch mochte Anna so gerne, dass sie ihn, wann immer es ging, zitierte: Auto kaputt. Anna lachte und sagte mit erhobenem Zeigefinger: ›Immer wenn wir lachen, stirbt irgendwo ein Problem.‹ Und ich sorgte für die Reparatur.
Einkommenssteuererklärung abzugeben. Mäuse im Keller, aber keine auf der Bank – Anna lachte und ich machte.
So ging das immer.
Einen Kalenderspruch legte Anna sogar in den Kühlschrank hinein, darauf stand: ›Wir können lieben, was wir sind, ohne zu hassen, was wir nicht sind. Kofi Annan.‹ Und Anna ergänzte handschriftlich: ›Friss nicht so viel, dann musst Du Dich später auch nicht hassen. Anna und Kofi.‹
Ich neigte zu nächtlichen Fressattacken. Kofi und Anna haben mir das verleidet.
Eines Tages kam Anna mit einem neuen Spruch in der Hand auf mich zu. Er lautete: ›Planen Sie Ihr Leben so, als ob Sie in einem Jahr sterben müssten.‹ ›Huch, Rainer‹, hat Anna gesagt, ›das trifft mich jetzt. Rainer, es wird Zeit. Wir machen einen Tanzkurs.‹ ›Was?‹, habe ich entsetzt ausgerufen. ›Einen Tanzkurs!? Anna, irgendwo sind auch Grenzen.‹ ›Ja, eben, Rainer, ja, eben. Willst du, dass ich sterbe, ohne je mit dir getanzt zu haben?‹ Anna wartete die Antwort nicht ab, sondern sagte zustimmend und mit rollenden Augen: ›Na also. Aber immer erst mal Diskussionen, der Herr.‹
Mit der Zeit wurde das Tanzen wunderbar und gehörte zu uns wie der mit Zetteln gefiederte Kühlschrank.
Eines Nachts hat Anna drei Worte gesagt, ganz leise und blass, sie sagte: ›Rainer, mein Herz.‹ Innerhalb einer Woche starb sie. Und ich suche sie seit Jahren.
Und jetzt sterbe ich. Dann werde ich als alter Mann vor Anna stehen. Und sie wird nichts sagen, sondern wie die viel zu junge Frau, die ich damals loslassen musste, um mich herumtanzen. Wir tanzen Walzer und Anna wird lachen. Dieses Bild kann mir keiner nehmen, weil Anna es mir geschenkt hat. Kurt Tucholsky hat angeblich folgenden Kalenderspruch geschrieben: ›Es gibt vielerlei Lärm, aber nur eine Stille.‹ So war Anna und das Leben mit ihr: einmalig wie die Stille.
Nach ihrem Tod haben wir jeden Tag in Gedanken miteinander geredet, und bald werden wir wieder miteinander tanzen.
An so was glauben Sie nicht? Das täte mir aber leid für Sie.«
»Ist der Tod weniger traurig, wenn man keine Verwandten und Freunde hat, denen man fehlen wird?«, fragte sich die Mitarbeiterin des Hospizes, als sie an diesem Abend die Lebens- und Sterbedaten des alten Mannes in das Gästebuch eintrug und anschließend, nach Tradition und Kultur des Hauses, im Eingangsbereich eine Kerze für ihn entzündete. Es gab niemanden, außer den Behörden, den sie informieren konnte. Zwar meinte eine Pflegerin, der alte Mann habe einmal einen jüngeren Halbbruder erwähnt, aber niemand kannte den Namen oder eine Adresse. Manche Bewohner im Hospiz haben keine
sozialen Kontakte mehr, weshalb der weit verbreitete Wunsch vieler Menschen, im vertrauten Zuhause zu sterben, mitunter nicht erfüllbar ist. Damit war der alte Mann also kein Einzelfall. Im Hospiz lebte er in Gemeinschaft. Der Sterbende wollte sich die Einsamkeit des Todes in seinen letzten Monaten ohnehin nicht vorstellen, denn er wusste sich erwartet und bald mit seiner Frau vereint. Das machte ihn fröhlich genug, um zeitweise
zu summen.
So sehr er seine Frau vermisste, so wenig sollte er aber vermisst werden. Der Staat stand finanziell und sozial für ihn ein. Die Kommune bezahlte die Trauerfeier. Seine eigenen verbliebenen Mittel wurden zwar herangezogen, reichten jedoch bei Weitem nicht aus. Nach dem Tod seiner Frau hatte der Mann ein paar Jahre Zerstreuung in Spiel und Alkohol gesucht und dabei fast sein gesamtes Hab und Gut verloren. Davon und von den Schuldgefühlen des Versagens sollte er sich nie mehr vollständig erholen.
Obwohl eine Feuerbestattung billiger gewesen wäre, respektierte der zuständige Sachbearbeiter in der Kommune den letzten, sogar schriftlich auf einem Blatt Papier mit Unterschrift fixierten Beerdigungswunsch des Mannes und genehmigte die Bezahlung einer – im Vergleich zu einer Feuerbestattung – teureren Erdbestattung. Blumenschmuck war in diese Sozialbestattung nicht eingepreist.
Mitglied einer Kirche war der Verstorbene nicht. Dennoch gestaltete ein evangelischer Pfarrer auf Bitten des Hospizes, das um die Bedeutung des Glaubens bei dem Verstorbenen zu wissen meinte, eine kurze Liturgie am Sarg, dem günstigsten Modell auf der Preisliste des Beerdigungsunternehmers. Geld erhielt die Kirche für diese Gefälligkeit nicht. Eine Vertreterin des Hospizes legte ein kleines Blumengebinde, das sie privat bezahlt hatte, auf dem kargen Sarg ab. Eine ehrenamtliche Vertreterin der Kirchengemeinde, die einen Beerdigungsbesuchsdienst für alleinstehende Verstorbene gegründet hatte, trug einen kurzen Bibeltext und ein weltliches Gedicht von Rainer Maria Rilke vor, das sie schön fand und das daher viel mehr mit ihr als mit dem Toten zu tun hatte. Man ging den Weg vom Vorraum der Friedhofshalle bis zum Grab, der Pfarrer verlas dort ein Vaterunser und Psalm 23: »Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln«. Es folgte der Erdwurf der drei Menschen. Die Sargträger beteiligten sich daran nicht, sondern standen abwartend daneben, die Köpfe respektvoll geneigt. Zum Abschluss schloss der Seelsorger mit den Worten: »Der Herr hebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden.« Nach circa zwanzig Minuten waren alle Wege gegangen, das Amen gesprochen, alles vorbei. Man reichte einander die Hand zum Gruß. Der Pfarrer und die Friedhofsmitarbeiter eilten zu einem der nächsten Bestattungstermine, die an diesem Tag im Halbstundentakt geplant waren.
Schon kurz nach dem Tod des Mannes bereitete das Hospiz sein Zimmer für den nächsten Gast vor.
Zu den wenigen Habseligkeiten des Alten zählte eine einzige Schallplatte, er bewahrte sie sogar in schwersten Zeiten in seinem Gepäck auf: Die lustige Witwe, Franz Lehár, eine Aufnahme aus den 1960er-Jahren. Einen Schallplattenspieler besaß er jedoch nicht. Deshalb schlug eine Hospizmitarbeiterin vor, die Schallplatte auf dem Plattenspieler eines neu eingezogenen Zimmernachbarn aufzulegen. Doch der alte Kauz lehnte das Angebot entschieden, ja geradezu empört ab: Die Schallplatte zu hören wäre ohne seine Frau nicht dasselbe gewesen. Eine dumme Idee, attestierte der Mann.
Doch ein paar Tage später brachte ausgerechnet er den Wunsch auf, eine einzige Melodie noch einmal hören zu wollen, vorausgesetzt es bereite keine Mühe. Der Zimmernachbar stimmte gern zu und bot an, dem alten Mann und einer ehrenamtlichen
Hospizhelferin sein Zimmer und den Plattenspieler für eine Stunde zu überlassen. Er sei mobil genug und würde sich solange im Garten die Zeit vertreiben. Der alte Mann wehrte ab und sagte, dass seinetwegen niemand das Zimmer verlassen müsse, während seine Musik erklinge. Außerdem wolle er gar nicht allein sein und niemandem Umstände bereiten, was seine größte Sorge zu sein schien. Die Schallplatte wurde also vom Nachbarn aus der Hülle gezogen, deren Bild verblasst und an den Kanten zerschlissen war. Dabei fiel ein vergilbtes, kleines Blatt eines Abreißkalenders heraus, das der alte Mann vom Boden aufheben und sich überreichen ließ, um es, wie ein Vögelchen, die ganze Zeit zwischen seinen Händen verborgen zu halten. Die schwarze Scheibe war wellig. Sie wurde behutsam auf den Plattenspieler gelegt und knisterte beim Abspielen schrecklich. Der alte Mann schien aufgewühlt, von einer sichtbaren Freude und spürbaren Ergriffenheit, die sich auf alle Anwesenden übertrug. Immer wieder hauchte er erregt dazwischen: »Hören Sie es? Haben Sie es gehört?« Die Hospizhelferin und der Nachbar bestätigten, wie schön es sei. Der Alte aber schien mit dieser Antwort unzufrieden und drängte: »Ja, hören Sie es denn nicht?« »Doch«, sagte man, »es klingt ganz wundervoll.« Fast reagierte der alte Mann ungehalten: »Nein, nein, Sie verstehen es nicht. Hören Sie denn nicht, dass man zu dieser Musik eigentlich gar nicht richtig tanzen kann?« Zum Beweis verlangte er, dass man die Nadel erneut in jene Rille setzen solle, in der der Walzer Lippen schweigen begann. Und tatsächlich: Das Tempo unterschied sich während des Stückes immer wieder erheblich, ja manchmal schien sich die Musik so sehr zu verlangsamen, dass Bewegung kaum noch vorstellbar war und die Melodie regelrecht stillzustehen schien. »Das war unsere liebste Tanzmusik, denn es gab darin die Momente des völligen Innehaltens und der Innigkeit und dann wieder die Momente des beschwingten Tanzes.« Das, so erklärte der Mann, passte einerseits zu ihm und andererseits zu seiner Frau. Sie liebte es zu tanzen, doch er liebte es noch viel mehr, seine Frau einfach nur in den Armen zu halten. Wurde er rot, als er das sagte? Fast meinte die Hospizhelferin, einen Farbwechsel in seinem faltigen Gesicht zu erkennen. Dem alten Mann standen kurz Tränen in den Augen, und schließlich forderte er regelrecht mürrisch: »Machen Sie das aus, es ist genug.« Man schaltete das Gerät aus, schob die Platte zurück in die Hülle und überreichte sie ihrem Besitzer. Der steckte das Kalenderblättchen hinein, als würde es zur Schallplatte gehören. Dann dankte er und ließ sich wieder in sein Zimmer bringen, das er bis zu seinem Tod nie wieder verlassen hat.
Der Nachbar mit dem Plattenspieler machte sich daran, mehr über die Musik des alten Mannes zu erfahren. Er fand heraus, dass Komponist Franz Lehár über Lippen schweigen die Tempobezeichungen »Valse moderato, valse lento« geschrieben hatte, also »gemäßigt« und »langsam«.
Die alte Schallplatte steht bis heute in einem Bücherregal des Hospizes, weil es unmöglich geworden war, sie einfach wegzuwerfen, nachdem man ihre Geschichte kannte. Und vielleicht finde sich doch noch der Halbbruder – oder zumindest ein Musikliebhaber, dem man die Platte samt Geschichte eines Tages überlassen könne. Man wisse ja nie, meint die Hospizleiterin. Auch die Kommune bemühte sich anfangs, doch noch einen Angehörigen ausfindig zu machen, der die Kosten der Bestattung übernehmen könnte. Die Suche blieb erfolglos und wurde schließlich eingestellt.
Auf der Grabstelle des Mannes wächst ein praktisches Immergrün, gepflegt wird sie im Rahmen eines sozialen Projekts, das sich um Gräber von Obdachlosen und einsam Verstorbenen kümmert. Die Liegezeit beträgt 20 Jahre, dann wird die recht unscheinbare Fläche, die – abgesehen von den Helfern des sozialen Grabpflegeprojekts – vermutlich niemand aufsucht und vor der wohl niemand je innehält, neu belegt. Das Grab der Frau wurde bereits vor Jahren abgeräumt, weil ihr Mann es nicht bezahlen konnte.
Das Hospizteam hatte den Namen des Mannes am Totensonntag seines Sterbejahres im Rahmen einer allgemeinen Gedenkfeier, bei der aller Verstorbenen der vergangenen zwölf Monate gedacht wurde, ein letztes Mal verlesen.
Im Hospizgarten liegt für ihn ein runder, flacher Stein mit seinem Namen aus. Auf der Rückseite stehen aber zwei Namen: »Anna & Rainer«. Und ein Zitat aus Lippen schweigen, das der Nachbar, der den alten Mann um neun Wochen überlebte, in kleinen Blockbuchstaben akkurat auf den Stein geschrieben hat: »Bei jedem Walzerschritt tanzt auch die Seele mit.« Während der Name und die Lebensdaten des Mannes, die mit einem wasserfesten Lackstift auf der Vorderseite aufgebracht wurden, rasch verwittert sind, kann man die beiden Vornamen und das Liedzitat auf der Unterseite des Steins noch recht gut lesen, sofern ihn jemand umdreht, was aber nur selten geschieht und, sobald die Geschichte vergessen sein wird, vermutlich nie mehr.
Franz Lehár wurde 1870 in Komárno, damals Österreich-Ungarn, heute Slowenien, geboren. Zu seinen größten Erfolgen zählt die 1905 uraufgeführte Operette Die lustige Witwe. In der Zeit des Nationalsozialismus arbeitete Lehár weiterhin in Deutschland. Dem international bekannten Komponisten, der eng mit jüdischen Librettisten zusammenarbeitete, kann ein durchaus ambivalentes Verhältnis zu den Nazis nachgesagt werden. Es heißt, Die lustige Witwe sei Hitlers Lieblingsoperette gewesen. Was konnte Lehár dafür, dass auch Nazis seine ewigen und zwingenden Melodien mochten? Die zweifelhafte Ehre, vom schrecklichsten Despoten des 20. Jahrhunderts für die musikalische Schöpfung Anerkennung erhalten zu haben, mag ohne politisches Wohlverhalten oder zumindest Stillhalten kaum zu erreichen gewesen sein. Ein Widerstandskämpfer war Lehár nicht. Auf der anderen Seite hat er stets an seiner jüdischen Frau, Sophie Paschkies, festgehalten. Eines Morgens habe Lehar sie aufgefordert: »Nimm den Nerzmantel, wir gehen heiraten.« Sein internationales Renommee als Operettenkönig rettete ihr das Leben.