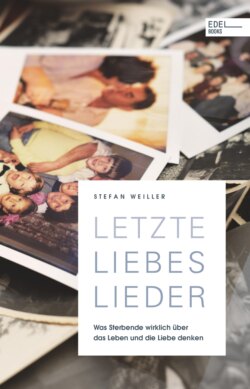Читать книгу Letzte Liebeslieder - Stefan Weiller - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LASST DAS STERBEN IN EUER HAUS Juliana, 69 Voglio una casa
ОглавлениеZu Beginn des Gesprächs sind Mund und Nase hinter einer mintgrünen Atemmaske verborgen. Juliana zieht sie bald unter ihr Kinn – und zeigt in allem ein Lächeln, das erstaunt.
»Für mich gab es diesen einen bestimmten Punkt, an dem ich mich der Wahrheit stellen musste. Was ich durchdacht habe und verstehe, macht mir weniger Angst. Ich bedrängte meinen Arzt damals, mir möglichst genau zu erklären, was mich erwartet.
Er sagte, meine Leberfunktion werde eines Tages nachlassen. Ich würde sehr müde werden und bekäme vermehrt Juckreiz. Möglicherweise werde mir öfter übel und Wasser lagere sich in meinem Bauch ein. Aber ich müsse nicht leiden. Zu jeder Zeit erhielte ich die passende Medizin. Irgendwann würden auch die Nieren nicht mehr richtig funktionieren und mein Urin verfärbe sich sehr dunkel. Das dürfe mich nicht erschrecken.
Mein Bewusstsein trübe sich vermutlich ein. Der Geist schütze sich im Sterbevorgang mit Halluzinationen und Visionen vor dem Kampf des Körpers, so habe er es oft bei anderen Kranken beobachtet. Der Körper helfe dem Geist, er schütte Hormone und Botenstoffe aus, die es zur Verklärung brauche. Sollte der Seele zum Elysium sonst noch etwas fehlen, werde man das Notwendige synthetisch von außen zuführen: Schmerzmedikamente und vielleicht auch sedierende Mittel.
Es sei zu erwarten, dass meine Verdauung träge werde. Ich könne mitunter weder den Harn noch den Stuhlgang kontrollieren. Es sei normal, eines Tages nicht mehr allein auf die Toilette zu können. Kein Grund sich zu schämen.
Auch meine Atmung werde sich verändern. Das Gefühl zu ersticken steigere sich vor allem durch meine Angst, nicht durch tatsächliche Luftknappheit. Man werde mir über eine Nasenbrille Sauerstoff zuführen und mich damit entlasten. Wahrscheinlich sei, dass meine Pulsfrequenz variiere, mein Blutdruck schwanke und manchmal kalter Schweiß auf meiner Stirn stünde.
Mein Arzt sicherte mir zu, dass man mich bestens versorgen werde. Die heutige Medikation bewahre ein hohes Maß an Lebensqualität. Natürlich könne ich jederzeit alles fragen und erbitten. Ehrlichkeit sei grundlegend für den richtigen Einsatz der Mittel.
Nach Bekanntwerden meiner unheilbaren Krankheit bemerkte ich bei Freunden und Angehörigen beim ersten Zusammentreffen ein Unbehagen. Gerade für diejenigen, die noch keine Bekanntschaft mit dem herannahenden Tod machen mussten, ist das Thema Sterben eine riesige Herausforderung. Ich kann die Befangenheit verstehen und will sie mit einer anderen extremen Situation vergleichen, die Sie vielleicht auch kennen:
Erinnern Sie sich an Ihre allererste Begegnung mit einem Säugling? Wussten Sie gleich, wie man ihn hält? Hatten Sie Angst, ihn fallen zu lassen, ihm unabsichtlich wehzutun, ihn zum Weinen zu bringen? Konnten Sie seine Laute, sein Schreien, sein Glucksen deuten? Verstanden Sie seine Körpersprache? Vielleicht hatten Sie – bei aller Neugierde und Zuneigung – auch ein bisschen Angst vor dem Kontakt mit dem Neugeborenen. Und erst durch die Erfahrung und wiederholte Begegnungen wich die Angst. Sie lernten, das Kind zu lesen, zu begreifen, zu berühren, seinen Weg zu begleiten. Genauso ist es mit Sterbenden. Als Freund oder Angehöriger haben Sie vielleicht Angst vor bestimmten Fragen, vor den Antworten oder vor der Ohnmacht. Sie haben Angst, das Falsche zu sagen oder zu tun. Wie fasst man einen Sterbenden an? Wie erkennt man ihn? Wann stirbt er eigentlich? Was braucht er? Was fürchtet er? Was genießt er? Was tut ihm gut? Was kann ihn trösten? Was würde ihn überfordern? Nur die Erfahrung kann uns diese Fragen beantworten, und die stetige Konfrontation kann unsere Ängste beseitigen und eine beruhigende Anpassung fördern. Wir sind die Summe unserer Erfahrungen, wir brauchen ehrliche Geschichten – auch über die Umstände des Todes.
Die meisten Menschen sterben recht isoliert im Krankenhaus. Dort sehen Sie als Angehöriger nur einen kleinen Ausschnitt, aber Sie leben nicht mit dem Sterbenden. Es gibt keine Gewohnheiten, kein Vertrauen, sondern scheinbar nur Ausnahmezustände in befremdlicher Umgebung. Und dann stirbt der Mensch und Sie besuchen den Leichnam beim Bestatter, vielleicht ohne mit dem Verstorbenen länger in Kontakt zu sein. So also mangelt es vielen Menschen wiederum an Erfahrung, an Begegnung, an Austausch und nicht selten an Mut. Der Tod ist nicht mehr Teil des Lebens, Ihres Lebens. Das sollte sich ändern. Denn sobald Sie bei Sterbenden sind oder sich in das Sterben hineinversetzen, werden Sie diesen Lebensabschnitt besser verstehen. Sie werden begreifen, mit Herz, Verstand und Hand. Und immer werden Sie das Sterben und der Tod traurig machen, aber Sie lernen, all das als Teil des Lebens zu akzeptieren und sogar zu schätzen. Darin liegt eine Chance.
Es ist normal, traurig zu sein. Es ist normal, sich allein und hilflos zu fühlen. Aber man kann und muss mit allem einen Umgang finden.
Viele Sterbende fühlen sich sozial isoliert und nicht mehr zugehörig. Meine Zimmernachbarin schämt sich, weil sie ihren Körper nicht mehr so gut kontrollieren kann. Sie hat Darmkrebs und Angst vor der Reaktion ihres Umfelds. Nun will sie ihre kleinen Enkelkinder nicht mehr zu sich lassen, um sie zu schützen. Ist das nicht schrecklich?
Zum Glück habe ich Menschen an meiner Seite, die mit mir das Leben teilten und es nun auch aushalten, mit mir zu sterben. Manche wohnen weiter entfernt, aber sogar mit ihnen halte ich Kontakt und wir verabreden uns zu Telefonaten. Wir konfrontieren einander mit unseren Gefühlen und Ängsten.
Ich wünsche uns Menschen, dass wir das Sterben in die Familien holen, in den Freundeskreis. So wie man zu einem Baby, diesem unbekannten Wesen, geht, so kann man zu einem Sterbenden gehen. Es sind Menschen an den gegenüberliegenden Ufern desselben Lebensflusses. Und wir werden beide Seiten kennenlernen. Wie schön, wenn wir das in Begleitung tun und zu allen Zeiten des Lebens Fürsorge und Anerkennung erfahren: im Werden und im Vergehen.
Das Sterben anzunehmen, wie auch das Leben, ist auch eine Frage der Bildung, Beratung und Erfahrung. Das Sterben ist ein unausweichlicher, interessanter, inspirierender, erschreckend-notwendiger Teil unseres Lebens. Deshalb erlaube ich mir einen sehr allgemeinen Appell: Seid bei den Sterbenden, lasst das Sterben in eure Gedanken, in euer Haus, denn in eurem Leben ist es schon.
Und auch die Trauer braucht ihren Platz und bewohnt mehr als nur ein Zimmer in unserer Seele, sie nimmt zuweilen vom ganzen Körper Besitz.
Ich weiß, was Trauer bedeutet. Ich hatte eine besonders enge Verbindung zu meiner Mutter. Bis zu ihrem Tod habe ich sie gepflegt. Als sie gestorben war, fühlte ich mich fünf Jahre regelrecht ohnmächtig.
Weil sie für viele andere Menschen ›nur‹ die Mutter war, die ich verloren hatte, habe ich meine Trauer über den Verlust verheimlicht, um nicht als psychisch krank zu gelten. Ich schämte mich, weil ich meine Mutter so sehr vermisste, dass ich ohne sie zunächst kaum leben konnte. Ich habe darüber meine Arbeit verloren. Wer einen Partner oder ein Kind verliert, wird eher Akzeptanz finden, wenn seine Trauer lange andauert. Aber wenn Eltern sterben, gilt das als der natürliche Lauf der Dinge, den Menschen zu akzeptieren haben und souverän verarbeiten sollen. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich akzeptiere den Tod. Aber viele respektieren die Trauer nicht und unterteilen sie in Kategorien und Phasen, die man fristgerecht und nach Lehrbuch durchlaufen soll. Länger als ein halbes Jahr intensiv zu trauern beschreiben viele Experten als behandlungsbedürftige Störung. Manche Menschen verwenden den Begriff Trauerarbeit, weil sie damit das Gefühl haben, die Trauer in der eigenen Hand zu halten. Doch der Leistungsdruck, der daraus resultieren kann, ist enorm.
Meine Mutter stellte mir als Kind Atteste gegen die Teilnahme an den Bundesjugendspielen aus, wenn sie spürte, dass ich leiden würde. Sie hatte meine Not oft bereits verstanden, bevor ich sie ihr erklären konnte. Sie sang mit mir. Sie las mir Geschichten vor oder erfand sie neu. Manche Heldin in ihren Geschichten trug meinen Namen. Und wenn ich als Kind fragte: ›Mama, bin ich das Mädchen aus der Geschichte?‹, hat sie gesagt: ›Du könntest es sein.‹ Meine Mutter kochte Tee, wenn ich krank war, und als ich schon längst allein wohnte, reichte ein Anruf und sie setzte sich in ihr Auto, um nach mir zu sehen. Sie war die schlechteste, aber leidenschaftlichste Autofahrerin der Welt. Meine Mutter wusste, wann es genug war, und gab ihren Führerschein mit 78 Jahren freiwillig ab. Sie war bereit, sich von Argumenten überzeugen zu lassen, und neigte nicht dazu, beleidigt zu sein, wenn man sie kritisierte. Sie musste nie schreien, um gehört zu werden. Sie lehrte mich, meinen Vorurteilen echte Erfahrungen entgegenzusetzen. Sie setzte sich in ihrer Freizeit für sozial benachteiligte Menschen ein, und ich lernte als Kind, dass man mit jedem Menschen nur reden muss – schon wird man ihn besser verstehen und vielleicht auch sich selbst. Sie hielt aus, dass ich erwachsen wurde und eigene Entscheidungen traf. Sie reichte dem Mann meiner Träume, der keineswegs die Kriterien eines perfekten Schwiegersohns erfüllte, ganz selbstverständlich ihre Hand. Sie kommentierte es nicht, als ich ihr Jahre später sagte, dass mein Mann und ich fortan nicht mehr gemeinsam träumten. Mit einem Händedruck und einer Umarmung konnte sie alles sagen. Sie fragte intensiv und unbequem, aber sie bohrte nicht nach. Sie sagte nie den schrecklichsten Satz einer Mutter: ›Das habe ich mir gleich gedacht.‹ Sie teilte ihr Geld, weil sie es nicht nur als ihres betrachtete. Sie konnte um Entschuldigung bitten und hatte dafür manchen Grund, denn sie war bestimmt nicht fehlerlos. Vielleicht konnte sie deshalb so gut vergeben. Sie betrachtete sogar längere Pausen nicht als Lücke, sondern als eine Brücke, die still zu einem neuen Anfang führt. Sie hielt sich nie für eine Freundin, sondern blieb die Mutter – und in den richtigen Momenten stand sie einfach nur im Hintergrund. Sie wusste um ihre Schwächen. Sie wollte lieber sich selbst als andere verändern. Sie konnte nicht nur mütterlich sein, sondern auch absolut kindisch. Sie blieb da, wenn alle anderen sich abwendeten.
Nach dem Tod meines Vaters, den ich durchaus achtete, aber der mir immer ein bisschen fremd geblieben war, bin ich zu ihr gezogen. Nach ihrem Schlaganfall habe ich sie versorgt und die Pflege um sie herum organisiert. Sie wollte in die Warteliste eines Heims aufgenommen werden, und bei jedem Mal, wenn ihr ein Platz angeboten wurde, redeten wir darüber, wie wir weitermachen. Wir lernten gemeinsam, ihren nahenden Tod zu akzeptieren, zumal er ihr zur Erlösung wurde. Dass ich ihr Sterben begleiten konnte, zählt zu den wertvollsten und intensivsten Erfahrungen meines Lebens. Das heißt nicht, dass es nur leicht war. Ich habe mich meiner Mutter nie näher verbunden gefühlt als in den Monaten ihrer Krankheit. Wir haben zu der Zeit miteinander und füreinander gelebt. Ich möchte die Krankheitsphase nicht missen. Meine Mutter war Halbitalienerin, eine Linie unserer Vorfahren verweist auf Umbrien. In ihrer letzten Lebenswoche sagte meine Mutter zu mir: ›Wenn wir glauben können, dass wir uns wiedersehen, können wir mit einem Lächeln Arrivederci sagen. Arrivederci, Juliana, non piangi.‹
In ihren letzten Lebenstagen sprach sie häufiger Italienisch, was ich nur wenig sprechen kann, aber recht gut verstehe. Doch meist redeten wir gar nicht mehr. Es kann, so durfte ich lernen, eine eigentümlich friedvolle, fast heilige Stille über ein Haus kommen, in dem ein Mensch im Sterben liegt. Wir spannen uns ein in den schützenden Kokon ihres herannahenden Todes. Die Welt blieb draußen. Da gab es nur noch uns. Eines Abends summte ich ihr ein altes italienisches Lied, das sie einst mochte und mir als Kind beigebracht hatte. Es ist weltbekannt und handelt vom Sterben, und wenn man es besonders leise singt, versteht man es am besten:
O partigiano, portami via,
O bella, ciao! bella, ciao!
Bella, ciao, ciao, ciao!
O partigiano, portami via,
Ché mi sento di morir.
Ich wusste damals nicht, dass es unser letzter Abend sein würde.
Nun werden Sie vielleicht denken, dass dieses Lied das wichtigste Lied ist, das mich mit meiner Mutter verbindet. Aber das stimmt nicht, denn das wichtigste Lied, sozusagen ›ihr Lied‹ hat meine Mutter selbst nie kennengelernt.
Fünf Jahre nach ihrem Tod habe ich alleine Umbrien bereist, die Herkunftsregion meiner Mutter, wo es schon lange keine Verwandten mehr gab. Auf dieser Reise habe ich das Lied Voglio una casa kennengelernt. Ich bin absolut sicher, dass meine Mutter dieses fröhliche Lied nicht kannte, geschweige denn sang, trotzdem verknüpfe ich es mit ihrer Lebensfreude und Stärke. Für mich klingt das Lied, als hätten sie oder der Himmel es mir geschickt. Es markiert das Ende meiner Trauer, denn es war die erste Melodie, die ich nach dem Verlust meiner Mutter mitsingen konnte. In diesem Lied geht es um das Weiterleben nach einer Tragödie. Am Ende meines Lebens kann ich sagen: Ich habe geliebt. Und wer will sagen, welche Liebe die größte ist?«
Voglio una casa: »Ich will ein Zuhause!« Rhythmisch scheint das Lied der italienischen Sängerin Lucilla Galeazzi geradezu vor Entschlossenheit aufzustampfen. Entstanden ist es unter dem Eindruck eines Erdbebens der Stärke 5,7, das 1997 Umbrien erschütterte. In 77 Dörfern wurden rund 9000 Gebäude beschädigt. Menschen wurden obdachlos. Andere starben unter den Trümmern. Das Lied beschreibt die Sehnsucht, dass die Gemeinschaft nach der dramatischen Erfahrung des Erdbebens wieder vereint sein wird und dass die Menschen wieder ein Zuhause finden. Zuversicht wird einkehren, Ängste werden überwunden sein und man wird in Gemeinschaft und Sicherheit leben können. Zugleich sind die Forderungen des Textes sehr konkret: Robust, sicher, warm, für alle Generationen geeignet und bezahlbar soll jedes Zuhause sein. Mit der packenden Melodie, der klaren Botschaft ist Voglio una casa längst zum Volkslied geworden, das im italienischen Gemüt zu Hause ist und auf manchen Festen zu Gast.