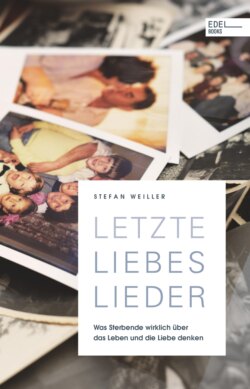Читать книгу Letzte Liebeslieder - Stefan Weiller - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
BEDENKE, DASS DER ANDERE STERBLICH IST Veronika, 94 Möge die Straße uns zusammenführen
ОглавлениеRückblickend kommt sie zu einer Erkenntnis, die sie in ihrer Jugend für undenkbar hielt: »Die beste Zeit des Lebens sind die Jahre zwischen achtzig und neunzig.« Keine Zukunftsangst, keine Konkurrenz in Liebe und Beruf, kein Druck zur Selbstfindung, keine Situation, die man nicht schon von irgendwoher kennt, keine großen Weichenstellungen mehr, keine Gespenster, keine Neigung zur Enttäuschung, keine Vergleiche mehr mit Gleichaltrigen. Sechs der sieben Todsünden sind weg: Neid, Wollust, Habgier, Zorn, Völlerei, Hochmut – kein Thema mehr. Für ein bisschen Trägheit habe sie mit ihren 94 Jahren ein gutes Alibi. »Also alles viel besser als mit dreißig«, findet sie. Alt sein ist für sie weder eine Leistung noch ein Versagen, weder eine Belohnung für die Einhaltung bestimmter Tugenden noch eine Rechtfertigung, sich den Lastern zu überlassen. Ihr Alter nimmt sie nicht als Ausrede, sich nicht mehr verändern zu müssen. Sie lerne jeden Tag etwas dazu: etwa, dass sich die Dinge von Nahem betrachtet ganz anders darstellen als von Ferne besehen. Dass Moral einfach ist, wenn sie anderen übergestülpt wird und den eigenen Kreis gar nicht berührt. Das hat sie in der Jugend zwar geahnt, aber erst im Alter hat sie es verstanden.
Das Altwerden bereitet ihr Freude. Bis vor zwei Jahren arbeitete sie als Seniorenmodel. Sie spielte in einem Imagefilm ihrer Seniorenwohnanlage mit, für die sie mit Überzeugung Werbung machte. Ein Modehaus schickte sie bei einer Firmenfeier sogar über einen kurzen Laufsteg. Mit 91. Eine späte kleine Karriere. Und überhaupt: Sie sieht zehn Jahre jünger aus, geschätzt wie 84, an manchen Tagen und im richtigen Licht wie 82.
Zu gern hätte sie die 100 geschafft. Aber daraus werde wohl nichts. Lamentieren will sie darüber nicht. Widerstand gegen das, was zum Leben eben dazugehört, müsse zu Widerstand im Sterben führen. Sie geht, wie sie gelebt hat: in Dankbarkeit.
Gottvertrauen helfe ihr über Klippen der Angst. Sie will glauben wie ein Kind. Ganz so wie sie es gelernt hat. Und deshalb will sie eines klar sagen:
»Gott hat für mich einen Bart. Ich erinnere mich, wie meine Großmutter – eine schlichte Frau von geringer Schulbildung – vom lieben Gott erzählte, wie sie ihn als gütigen und freundlichen Meister unseres Lebens beschrieb. Ich habe ihr das gerne geglaubt und mir ein frommes Kinderbild von Gott ausgemalt, wie er da auf seiner Wolke sitzt, die Beine baumeln lässt, durch seinen flauschigen Bart streicht und lächelt. Zu bestrafen und zu richten gab es im Leben meiner Großmutter ohnehin wenig. Da war nichts, was sich die Menschen ihres Lebens untereinander nicht hätten verzeihen können. Zur Vergebung war kein Gott nötig, dazu reichte die Liebe. Trotzdem lehrte mich Großmutter zu glauben und zu verstehen, dass es für manche Anlässe einen lieben Gott braucht: für jene, die für uns Menschen zu groß sind, wie etwa den Tod.
Großmutters Gott – sie nannte ihn in meiner Gegenwart immer nur den ›lieben Gott‹ – war so freundlich, dass ich ihn gut als Lebensbegleiter annehmen konnte.
Als Erwachsene lernte ich, Gott als geschlechtsneutrales Geistwesen zu betrachten, evangelische Gottesdienste können ja so spröde und zuweilen einfältig sein wie katholische distanziert und schematisch. Ich habs katholisch versucht, aber die wunderbare Sprache Luthers war mir so heilig, dass ich wieder zu den Protestanten zurückkehrte. Man soll – ganz im Sinne des Apostels Paulus – alles prüfen und nur das Gute behalten.
Emanzipation von allem, was nach eingehender Prüfung nicht passt und sich schlecht anfühlt, ist nötig. Apropos Emanzipation: Frauen und Männer sind gleichberechtigt – und alle anderen auch.
Ich vertraue Ihnen etwas an: Mein Enkel ist heute eine Enkelin, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und ›sie‹ ist mir heute so lieb, wie ›er‹ es mir früher war.
Manchmal nenne ich sie versehentlich immer noch Thorsten, denn Thorsten ist ja nicht tot, sondern wurde als Frau neu geboren. Vor ein paar Tagen sagte sie: ›Oma, wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich mich damals umgebracht. Als keiner aus der Familie mich annehmen wollte, hast du es einfach gemacht.‹ Dann kamen uns die Tränen, zu denen wir einander umarmten. Ich habe Angst um sie. Welchen Zeiten geht sie entgegen? Welche kommen auf sie zu?
Ihre Mutter will die Tochter nicht akzeptieren – und versündigt sich damit an der Liebe zu ihrem Kind, das für seinen Mut und seine Stärke Bewunderung verdient – zumindest Verständnis. Vor Thorstens Bekenntnis zu sich selbst konnte ich mir nicht vorstellen, was es wirklich heißt, wenn ein Mensch sich in seinem Körper nicht zu Hause fühlt. Ich glaube, dass ich sogar gegen diese Art von Operationen und Veränderungen war, wenngleich ich nie etwas gesagt hätte, weil es keinem anderen Menschen zusteht, darüber zu befinden, wie der Nachbar lebt.
Man lernt Moral meist dann zu überdenken, wenn man selbst davon betroffen ist. Aus der Distanz ist es leicht, einen Menschen wegen seiner Andersartigkeit zu verachten, aber sobald man ihn kennenlernt und ihm zuhört, wenn er ganz nah ist, dann sieht und versteht man erst richtig.
Am Hospiz schätze ich, neben der Entlastung in Pflegeangelegenheiten und Gesundheitsfragen, dass es ein freundlicher, respektvoller Ort ist. Niemand belehrt oder kritisiert dich; vielleicht weil einem das baldige Lebensende etwas Unberührbares verleiht. Man muss sich hier für nichts schämen, nichts muss einem peinlich sein. Hier darf jeder im Sterben sein, wie er im Leben immer sein wollte, es sich aber vielleicht lange nicht traute. Das ist eine Lehre, die Gesunde, Weiterlebende aus dem Hospiz ziehen können: Seid, wer ihr zu sein meint, und spart das nicht bis zum Schluss auf.
Im Hospiz ist nicht Schluss. Ein Tag hält hier sogar mehr Zeit bereit, weil Zeit eine andere Bedeutung gewonnen hat. Mein Nachbar aus dem Nebenzimmer hat hier erst bekannt, dass er aus einer Sintifamilie stammt. Er fürchtete, Ausgrenzung zu erfahren und Alltagsrassismus. Jetzt sagt er endlich, dass er auch deutscher Sinto ist. Wie soll ich das finden? Ich finde es großartig! Ich mag seine Musik, die man aus seinem Zimmer hört.
Es ist nie zu spät, man selbst zu sein. Hier im Hospiz ist alles wichtig und zugleich irgendwie alles auf befreiende Weise erlaubt. Was die Leute denken, wenn meine Enkelin zu Besuch kommt? Es ist einfach egal. Was zählt, ist meine Freude und ihr Gefühl, endlich sie selbst zu sein.
Ich glaube, wenn wir andere Menschen immer so behandeln würden, als müssten sie morgen sterben, würden wir vielleicht respektvoller, liebevoller, toleranter miteinander umgehen. Der Perspektivwechsel wäre also, nicht das eigene Sterben als Maßstab für ein würdiges Leben zu nehmen, sondern das Sterben der anderen. Mensch, bedenke, dass der andere sterblich ist. Und behandle ihn gut, auf dass er auch dich wie einen Sterbenden behandelt. So steht es für mich in gewisser Weise in der Bibel. Lesen Sie genau nach und Sie werden es vielleicht finden.
Wenn Sie ganz alt sind, kämpfen Sie nur noch für die wichtigsten Dinge, weil Sie für die vielen kleinen Auseinandersetzungen schlicht zu müde sind. Ich kämpfe für meine Enkelin. Dazu habe ich einen Plan: Ich will meine Tochter und meine Enkelin an meinem Sterbebett zusammenführen. Einer Sterbenden darf man schließlich nichts abschlagen. Oder?
Wo haben wir begonnen? Ach ja, beim Glauben und meiner Musik. Ich singe sehr gerne ein bestimmtes Lied, mit einem Text, der mir eigentlich fast ein bisschen zu simpel ist. Die Melodie ist bestechend hübsch. Wann immer das Lied gesungen wird, hebt es mich, weil es Gemeinschaft verheißt, bis hinauf zum lieben Gott.
Tief in der Kammer meines kindlichen Herzens, in dem auch dieses Lied sein Zimmer hat, behielt der liebe Gott mein ganzes Leben hindurch seinen langen weißen Bart.
In über neun Jahrzehnten habe ich Dinge entstehen und zerfallen und abermals entstehen sehen. Moden tauchten auf und gingen unter. Gott bleibt Gott. Und ich durfte mich verändern.
Ich bin froh, dass ich in einer Zeit sterben darf, zu der Sterbehilfe in Deutschland noch nicht umsetzbar ist. Ich bedauere jeden, der unter dem persönlichen, gesellschaftlichen und familiären Druck steht, sich vielleicht möglichst rasch zu töten, um niemanden zu belasten und um kein Geld mehr zu kosten. Mein Weiterleben stellt zum Glück niemand infrage, nicht einmal ich.
Alles zu seiner Zeit. Ich habe meine Enkelin an der Hand und Ärzte, die mein Leid gut im Griff haben, bis ich in die Hand Gottes gehe.
Gott braucht für mich eine konkrete Gestalt. Er ist mein Schutz, wie der Fallschirm eines Fallschirmspringers, dem kann man doch im Fallen auch nicht sagen: Ach übrigens, der Fallschirm, das war nur eine Art Symbol dafür, dass wir schon alle irgendwie unten ankommen werden.
Gott kann doch nicht nur Geist sein. Wie sollte er mir seine Hand reichen? Und wie sollte ich all die wiedersehen und erkennen, die vorausgegangen sind? Und jene, die da noch kommen?«
Möge die Straße uns zusammenführen
Und der Wind in deinem Rücken sein;
Und bis wir uns wiedersehen,
Halte Gott dich fest in seiner Hand.
»Beate, jetzt zieh doch endlich deinen Stock aus dem Hintern und versöhne dich mit dem Kind. Streite mit deiner Tochter, sage ihr, was du fühlst, höre ihr zu und dann versöhne dich.« Es war nicht ihr letzter Satz, aber einer, der ihrer Tochter aus den letzten Lebenstagen der alten Mutter in Erinnerung bleiben wird. Und weil ihr Schwiegersohn dabei war, ergänzte sie: »Das gilt auch für dich, Dieter.«
Bei ihrer Beerdigung waren Tochter und Enkeltochter nach dem äußeren Eindruck der Gäste einvernehmlich traurig und standen am Grab dicht nebeneinander, so nah, wie man es seit Jahren nicht mehr gesehen hatte. Und leider bisher auch an keinem Tag mehr, der darauf folgte. Aber noch ist es nicht vorbei, meint die Enkelin und vertraut darauf, dass die Oma recht behält und man sich die Hände reichen wird. Diese Möglichkeit schenkt der Enkelin Zuversicht; doch alle Würde erhält sie nur aus sich selbst – ganz so, wie ihre Oma immer gesagt hat, der sie ein Bild von Gott verdankt, den sie, wie sie es bei Oma gelernt hat, gern den »lieben Gott« nennt.
Der Musiklehrer Markus Pytlik hat das Lied Möge die Straße gedichtet und komponiert. Als Vorlage diente, wie es in vielen Quellen heißt, ein »alter irischer Segen«. Unbestimmt bleibt, wie alt der zugrunde liegende Segen ist. Als Pytlik das Lied komponierte, hatte die keltisch-irische Spiritualität die deutschen Kirchen längst auf breiter Basis erreicht und wurde im Spannungsfeld zwischen ursprünglicher frühmittelalterlicher Frömmigkeit einerseits und leicht konsumierbarem Sakralkitsch andererseits wahrgenommen. Generell sind irische Segen durch Naturmetaphern gekennzeichnet. Sonne und Mond, Wind und Regen können als Zeichen göttlichen Wirkens gedeutet, verstanden und erlebt werden. Diese Allverfügbarkeit spiritueller Naturerfahrung mag den Erfolg des Liedes zusätzlich fördern.