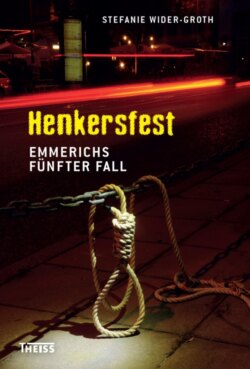Читать книгу Henkersfest - Stefanie Wider-Groth - Страница 7
2
Оглавление„Hörst du?“, röhrte Lutz, im Duell mit einem fulminanten Gitarrensolo, gut gelaunt in das geneigte Ohr seines Freundes Emmerich. „Das Blaulicht? Deine Kollegen sind in der Nähe unterwegs.“
„Mir völlig wurscht. Bin außer Dienst.“
„Der Bassist ist gut, nicht wahr?“
Emmerich, dessen Aufmerksamkeit naturgemäß dem Schlagzeug galt, nickte beiläufig.
„Ich würde allerdings“, trompetete Lutz mit fachmännischem Gesichtsausdruck, „keinen dieser Fünfsaiter benutzen.“
„Natürlich nicht“, stimmte Emmerich lauthals zu. „Du könntest ihn ja gar nicht spielen.“
Eine beleidigte kleine Weile lang hielt Lutz den Mund, wippte im Rhythmus mit dem Fuß und hörte zu, bevor er die Pause vor dem nächsten Stück nutzte:
„Der Schlagzeuger kann mehr als du.“
„Das ist kein Kunststück“, räumte Emmerich gutmütig ein. „Schließlich ist er zwanzig Jahre jünger und im Training.“
„Wenn wir so eine Sängerin hätten …“
„Vergiss es.“ Emmerich beobachtete leidenschaftslos die gut gebaute, junge Frau, die in der Tat über ein beachtliches Stimmvolumen verfügte. „Auch die ist zwanzig Jahre jünger. Mindestens. Wir werden keine Rockstars mehr.“
„Leider“, entgegnete Lutz kleinlaut, reckte beim neuerlichen Ertönen eines Martinshorns den Kopf, spähte über die Menge hinweg und fügte hinzu: „Jetzt kommt auch noch ein Krankenwagen.“
„Geht mich nichts an. Wahrscheinlich Ärger in der Altstadt. Zum Wohl.“
Sie prosteten sich zu. Auf der Bühne wurden die Instrumente gestimmt, ein Mann mit Kellnerschürze trat hinzu, gestikulierte und reichte der Sängerin einen Zettel. Die griff zum Mikrofon, verdrehte die Augen und erklärte gelangweilt:
„Achtung, eine Durchsage. Gesucht wird Reiner Emmerich. Ich wiederhole, Reiner Emmerich. Falls er sich hier irgendwo aufhält … bitte so schnell wie möglich da unten an die Straßenkreuzung kommen. Ein Kollege braucht ihn.“ Die Basstrommel unterstützte ihre Worte mit drei dumpfen Schlägen. „Fertig, Jungs? Wir machen weiter. Two, three, four …“
„Scheißdreck“, brüllte Emmerich mit Inbrunst in das einsetzende Gitarrenriff hinein.
***
Inzwischen war es Nacht geworden. Emmy hatte eine Portion italienischer Vorspeisen vom Pappteller verdrückt, ein Wasser dazu getrunken, eine Zigarette geraucht und immer noch keine Spur von Bernd entdeckt. Längst stand sie wieder nahe bei der Bühne und überlegte, was zu tun war. Ein Hotel kam aus finanziellen Gründen nicht infrage. Nach Hause, zur Mutter, der es schlecht ging, zu fahren, hatte wohl ebenso keinen Sinn. Wobei es durchaus in ihrer Absicht gelegen hatte, ihr einen Besuch abzustatten, wo sie nun schon einmal da war. Allerdings erst am Tag darauf und schon gar nicht um diese Zeit. Die Aussicht, sich die Nacht in irgendwelchen Kneipen um die Ohren zu schlagen, konnte jedoch auch nicht als erfreulich bezeichnet werden. Ohne Bernd und die von ihm avisierte Unterkunft würde Emmy kaum etwas anderes übrig bleiben, als unverrichteter Dinge den Zug zurück nach München zu nehmen. Außer Spesen nichts gewesen, murmelte sie schlechter Laune vor sich hin. Selber schuld, ich hätt’s mir denken können, Bernd war und ist ein blöder Hund …
„Emily?“
Vor ihr stand ein Unbekannter, ungefähr in ihrem Alter, in Jeans und T-Shirt, mit kleinem Ziegenbart, spärlicher Kopfbehaarung und einer dieser Brillen mit dickem, schwarzem Rand, die sich gegenwärtig, besonders bei Politikern, großer Beliebtheit erfreuten. Emmy sah ihn fragend an.
„Du bist doch Emily?“, wiederholte der Unbekannte seine Frage. „Emily Schlaicher? Die mit mir auf dem Gymnasium war? Sag bloß, du kennst mich nicht mehr.“
„Äääh …“
„Micha. Michael Föhnfelder. Ich hab zwei Jahre in der gleichen Klasse eine Reihe hinter dir gesessen.“
„Jetzt echt?“
„Damals hatte ich noch eine andere Frisur.“
„Wirklich?“
„Na, klar. Ich hab dich ewig nicht mehr in der Stadt gesehen.“
„Ich wohn ja auch schon lange nicht mehr hier.“ Emmy versuchte, aus der Erinnerung heraus, ein jüngeres Gesicht auf das vorhandene ihres Gegenübers zu projizieren, was ihr aber nicht gelingen wollte. „Und Schlaicher heiße ich auch nicht mehr.“
„Du bist verheiratet?“ Allenfalls ein kleiner Schimmer der Enttäuschung war im Ausdruck des Unbekannten wahrzunehmen.
„Verwitwet“, korrigierte Emmy, lediglich der Ordnung halber.
„Ach du meine Güte“, entgegnete der fremde Micha mitleidig, aber unverkennbar erleichtert. „Das musst du mir erzählen. Komm, lass uns was trinken …“
„Ich weiß nicht“, wehrte Emmy ab. „Eigentlich bin ich schon wieder auf dem Rückweg. Mein Zug … ich sollte zum Bahnhof …“
„Quatsch mit Bahnhof. Zeit für einen Drink ist immer. Wo wir uns so lange nicht gesehen haben. Fahr doch später. Oder du bleibst noch über Nacht. Kannst bei mir pennen.“
Das Angebot ließ Emmy zögern. Eine Unterkunft umsonst eröffnete die Möglichkeit, wenigstens einen Teil ihrer Pläne am morgigen Samstag umzusetzen und noch nach der Mutter zu sehen, bevor sie die Rückreise antrat. Andererseits stand zu befürchten, dass für die Übernachtung trotzdem eine Entlohnung erwartet wurde, wenn auch nicht in Form von Geld.
„Erinnerst du dich noch an Dr. Häfele?“, machte Emmy schließlich einen Versuch, die Identität des angeblichen Klassenkameraden zu überprüfen.
„Chemie“, erwiderte der Ziegenbart wie aus der Pistole geschossen. „Als die Schießbaumwolle brannte. Ich hatte ein Loch in meinem nagelneuen Fanta-4-T-Shirt.“
Endlich formte sich in Emmys Kopf ein Bild. Das eines mageren Jünglings in viel zu großen Hosen, wie sie früher einmal modern gewesen waren. Einer, der eher zu den Unscheinbaren denn zu den Vorlauten gezählt und auf den Spitznamen „Föhni“ gehört hatte. Unter dem er in Emmys kopfinternem Speicher auch abgelegt war, weshalb bei „Micha“ keine Erinnerungen wach geworden waren. Unschlüssig sah sie auf ihre Armbanduhr, sie hatte keine Ahnung, wann ein Zug zurück nach München ging.
„Jetzt komm schon“, forderte Micha energisch und griff nach ihrem Rucksack. „Ich hab Durst. Und keine Angst, ich tu dir nichts.“
***
Wo die Hauptstätter Straße, einer Stadtautobahn gleich, am Wilhelmsplatz vorbeiführte, stand, nach wie vor im quittengelben Hemd, Mirko zwischen einem uniformierten Polizisten auf der einen und Gabi auf der anderen Seite. Schon von Weitem war zu sehen, dass die Gruppe in eine Diskussion verwickelt war, bei der der Polizist nur eine Nebenrolle spielte. Emmerich eilte hinzu und wandte sich an Mirko Frenzel.
„Was ist los? Und gnade dir Gott, wenn’s nicht was wirklich Wichtiges ist.“
„Messerstecherei in der Weberstraße.“ Mirko deutete vage Richtung Altstadt. „Gleich da drüben. Sieht so aus, als hätten wir einen Toten.“
„Das mag so sein oder auch nicht“, erklärte Gabi mit Elan. „Reiner hat jedenfalls nichts damit zu tun.“
„Bitte, Frau Emmerich. Ich kann doch nichts dafür, dass wir gerade in der Nähe sind.“
„Wen interessiert denn Nähe? Der Dienstplan zählt. Mein Mann hat frei.“
„Sie werden es vielleicht nicht glauben, aber das gilt auch für mich. Trotzdem können wir nicht einfach …“
„Es kommt überhaupt nicht infrage, dass mein Mann …“
„Glauben Sie mir doch, es wird nicht lange dauern. Wir werden uns die Sache nur kurz ansehen. Zuerst mal sind die Kollegen vom KDD an der Reihe.“
„Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Aber den Reiner braucht da keiner.“
„Guter Spruch, den merke ich mir“, grinste Mirko und sah seinen Vorgesetzten an. „Jetzt sag doch auch mal was.“
„Was denn?“ Emmerich betrachtete Gabi unbehaglich, ihre Augen sprühten Blitze.
„Mein Gott, sie ist doch nicht meine Frau“, nuschelte Mirko etwas undeutlich, aber nicht so, dass er nicht verstanden wurde.
„Sie“, sagte Gabi und stampfte mit dem Fuß auf, „haben es bislang ja auch zu keiner Frau gebracht. Soweit ich weiß. Und wenn Sie so weitermachen, wird das auch nichts mehr.“
„Also ehrlich, Spatz.“ Emmerich legte einen Arm um die Schultern der erbosten Gattin. „Wir wollen nicht persönlich werden, oder? Mirko kann wirklich nichts dafür. Er tut nur seine Pflicht.“
„Ist doch wahr.“ Gabi wischte sich eine Zornesträne aus dem Augenwinkel. „Jedes Mal, wenn man sich einen schönen Abend machen will, muss irgendwas passieren.“
„Nicht jedes Mal“, widersprach Emmerich sanft. „Das gehört nun mal zu meinem Job. Stell dir vor, ich wäre Arzt …“
„Du bist keiner. Warum sollte ich mir so was vorstellen?“
„Wenn ich dir verspreche, dass es bestimmt nicht lange dauert? Du und deine Freundinnen … euch wird doch nicht langweilig …“
„Es geht nicht um mich. Du hast heute frei.“
„Aber das wird vielleicht mein Fall. Deshalb würde ich schon gerne …“
„Weißt du was?“ Gabi zückte ein Taschentuch und putzte sich die Nase. „Mach doch, was du willst. Ich warte jedenfalls nicht auf dich.“
„Musst du nicht.“
„Dann ist’s ja gut.“
„Spatz.“ Emmerich zog sie an sich. „Ich will keinen Streit mit dir.“
Gabi steckte das Taschentuch wieder ein, sah ihn für den Bruchteil einer Sekunde so trotzig an, als sei sie nicht etwas über fünfzig, sondern etwas über fünf und drückte ihm einen schnellen Kuss ins Gesicht.
„Wir haben keinen Streit“, sagte sie leise. „Das Leben ist zu kurz dafür.“