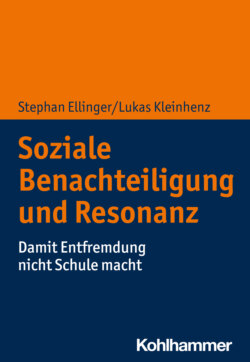Читать книгу Soziale Benachteiligung und Resonanzerleben - Stephan Ellinger - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorwort
ОглавлениеDieses Buch wird von einer zentralen Frage im Kontext sozialer Ungleichheit strukturiert: Wie kann es gelingen, dem offensichtlich als zwangsläufig akzeptierten Muster zu begegnen, dass Kinder, die in sozialen Risikolagen aufwachsen, in der deutschen Schule signifikant weniger Erfolg haben als Kinder aus bürgerlichen Lebensstilgruppen? Es geht dabei nicht um einen weiteren Versuch, gebetsmühlenartig die unterstellte Ungerechtigkeit anzuprangern und politische Veränderungen zu fordern, sondern um die Frage, wie aus einer sozialen Gefährdungslage eine relevante soziale Benachteiligung und schließlich in der Schule eine Lernbeeinträchtigung wird und wie dieser pädagogisch begegnet werden kann.
Der Blick auf Lernbeeinträchtigungen, auf Schulversagen und auf die Reproduktion von Bildungsferne wird nach der Problemfeldsichtung in Kapitel 1 ( Kap. 1) zunächst bewusst durch eine soziologische Brille aufgenommen.
In Kapitel 2 ( Kap. 2) besuchen wir die fiktiven Lebenswelten von drei Mädchen und zwei Jungen, die ihre Kindheit bis zur Einschulung in unterschiedlichen Soziallagen in Deutschland verbracht haben. Die Geschichten sollen die Bandbreite der individuellen Lebenslagen, aus denen Kinder eingeschult werden, bewusst machen.
Nach diesem narrativen Überblick wird in Kapitel 3 der theoretische Rahmen ( Kap. 3) aller weiteren Überlegungen grundgelegt. Für den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und erfolgreichem Lernen in der Schule, so die These, ist die Qualität des Resonanzerlebens in der Institution Schule entscheidend.
In Kapitel 4 und 5 ( Kap. 4; Kap. 5) werden folgerichtig die Mechanismen primärer, sekundärer und tertiärer Resonanzbenachteiligungen entwickelt und erläutert. Hier zeigt sich, dass der frischgebackene Abc-Schütze entweder seine Resonanzfähigkeit in der Schule ausbauen und vertiefen – und infolgedessen erfolgreich lernen – kann oder aber die Schule zur Entfremdungszone wird, in der sich die Weltbeziehung zunehmend gestört entwickelt.
Im neuen Umfeld begegnen dem Kind dann Lehrkräfte, mit denen die Interaktion misslingt und Angebote, die ihm nichts sagen und zudem auf eine ihm fremde Weise unterbreitet werden. Weil das Kind nicht berührt ist, sich selbst nicht als wirksam erlebt und nicht über Erlebtes staunt, wird Lernen und damit auch die Schule zunehmend fremd und schwierig.
Kapitel 6 ( Kap. 6) widmet sich abschließend der Frage, was eine Lehrkraft können, wissen und wollen sollte, um Kinder aus sozialen Gefährdungslagen ebenso wirkungsvoll beim Lernen zu unterstützen wie vorschulisch sozial ungefährdete Kinder.
Dieses Buch will einen blinden Fleck in der pädagogischen Forschung aufgreifen. Zwar ist in den letzten Jahren der Zusammenhang zwischen Resonanzerleben und schulischem Lernen angesprochen und in die pädagogische Diskussion eingeführt worden (vgl. Beljan 2019; Rosa 2016), allerdings sucht man eine erhellende Begründung dafür, dass Schule für bestimmte Gruppen überzufällig häufig zur Entfremdungszone wird, ebenso vergebens wie die notwendige Inspiration zum pädagogischen Handeln. Man könnte formulieren: »Kinder aus armen Familien sind eben dümmer« oder »Na ja, wenn er zuhause keine Unterstützung hat, muss er sich eben mit dem Hauptschulabschluss zufriedengeben – egal, wie begabt er ist«, oder auch »Ob Sie das ungerecht finden oder nicht, selbst Rassim muss diese Anforderungen erfüllen, egal, welches schwere Schicksal er zu tragen hat«. Die Überlegungen im Buch wollen an diese Stellen blicken und bisherige Überzeugungen zur sozialen Benachteiligung vor dem Hintergrund neuerer Erkenntnisse aus der Resonanzforschung weiterentwickeln. In diesem Sinne enthält das vorliegende Buch auch ein überarbeitetes Kapitel aus der vergriffenen Monografie »Förderung bei sozialer Benachteiligung« aus dem Jahr 2013.
Die Autoren danken Eva-Maria Lechner herzlich für die wertvollen Hinweise zum Manuskript und wünschen den Leserinnen und Lesern viele Aha-Erlebnisse und Inspirationen für die eigene pädagogische Arbeit. Rückmeldungen und Anregungen sind sehr willkommen und werden nicht unbeachtet bleiben.
Würzburg im September 2021
Stephan Ellinger und Lukas Kleinhenz