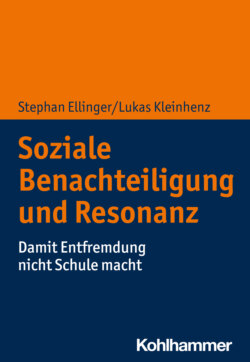Читать книгу Soziale Benachteiligung und Resonanzerleben - Stephan Ellinger - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Soziale Gefährdungslagen im Überblick
ОглавлениеEs soll in diesem Buch um den Prozess der Resonanzbenachteiligung einzelner Kinder und um Resonanzförderung gehen. Um die ganze Tragweite dieser Problematik zu verstehen, wollen wir einen Schritt zurücktreten und den Blick zunächst auf die nahezu unbegrenzten sozialen Differenzlinien in unserer Gesellschaft richten. Sie machen deutlich, dass jede und jeder in unterschiedlichen Aspekten anders ist. Wir können anhand des Geschlechts, der Hautfarbe, des Alters, der sexuellen Neigung, der Religion, der Wohngegend, der besonderen Begabung, des finanziellen Vermögens, der Geschwisterzahl, der Berufe der Eltern, der Bildung der Eltern, der Hobbys, der Muttersprache, der Zweitsprache, des Berufes, einer Behinderung, einzelner Gesundheitsmerkmale, familiärer Vorbelastungen und und und differenzieren. Die Merkmale sozialer Ungleichheit führen an sich noch nicht zwingend zum schulischen Versagen. Anderssein kann über kurz oder lang jedes Mitglied einer Gesellschaft treffen, denn es leitet sich vom Vergleich, vom sozialen Setting, von einem entstandenen Mainstream und von einer etwaigen mangelnden Passung ab. Ohne eine Aufwertung bestimmter Merkmale innerhalb eines Bewertungssystems gibt es keine Abwertung anderer Lebens- oder Seinsformen.
Darüber hinaus gefährden konkrete suboptimale Sozialisationsbedingungen bereits vor der Einschulung die gesunde Weltbeziehung betroffener Kinder. Solche primären Beeinträchtigungen entstehen nicht in erster Linie im Spannungsfeld zwischen unterschiedlichen Soziallagen, sondern müssen als unmittelbare Auswirkung belastender und schädlicher Erfahrungen am Individuum selbst verstanden werden.
Ausgehend von den oben genannten Differenzlinien lassen sich vier Formen sozialer Gefährdung im Überblick beschreiben:
Eine sozio-ökonomische Gefährdung resultiert aus Armut und Arbeitslosigkeit. In Deutschland ist jedes fünfte Kind von Armut betroffen. Das geringe Familieneinkommen führt zunächst zu objektivem Geldmangel, aufgrund dessen notwendige Anschaffungen nur eingeschränkt möglich sind. Einem armen Kind fehlt vielleicht das eigene Zimmer, fehlt womöglich der eigene Schreibtisch oder sogar das eigene Bett. Kurz gesagt: Es fehlen Rückzugsmöglichkeiten, Raum für Erkundungen und Gestaltung eines eigenen Umfeldes. Allerdings fehlen ihm auch Anschaffungen, die über das Allernötigste wie Kleidung und Nahrungsmittel hinausgehen. Häufig rangieren Bildungs- und Kulturgüter in der Priorität weit unten. Damit fehlen Inspirationsquellen für Fantasieausflüge, für die Entwicklung einer Traumwelt, für altersgerechte und inspirierende Identifikationsfiguren. Der Geldmangel kann überdies auch zu Einschränkungen im Bereich sozialer Kontakte führen: Arme Kinder haben kein Geld für Ausflüge, kein Geld für Geburtstagsgeschenke, kein Geld zum Ausgehen. Sie können nicht ohne Weiteres andere Kinder zu sich nach Hause einladen und vielleicht auch nicht auf Fahrdienste der Eltern zurückgreifen. Arme Familien haben häufig Kontakt zu armen Familien, deren Lebenswelt ähnlich begrenzt ist wie die eigene. Durch eventuelle Nebenjobs und resultierende Überforderung der Eltern sind gemeinsame entspannte Zeiten des Spielens, der emotionalen Nähe und des Beziehungsaufbaus ebenso gefährdet wie eine fürsorgliche Unterstützung im kindgerechten Erkunden der Umgebung.
Die sozio-kulturelle Gefährdung wurzelt häufig in der Zugehörigkeit zu Sozialmilieus, die als bildungsfern bezeichnet werden und betrifft u. a. auch Kinder mit Migrationshintergrund. Die bewusste Andersbehandlung und Laufbahnsteuerung durch die Lehrkräfte sind bekannt. Darüber hinaus finden betroffene Kinder selbst häufig keine Anknüpfungspunkte für die Ideenwelt des bürgerlichen Kindergartens und der bürgerlichen Schule, keinen Zugang zur dort gebotenen Literatur, zum Theater, zu Kunst, zu Spiel oder zu anderen Kulturgütern. Sozio-kulturelle Gefährdung entsteht allerdings nicht nur durch das komplementäre Verhältnis aufeinandertreffender Kulturen, kultureller Prägungen und Sozialmilieus. Eltern betroffener Kinder sind häufig mit der Unterstützung ihrer Kinder in bürgerlichen Institutionen überfordert. Selbst wenn sie sich engagieren wollen, wird ihnen am Ende die Schuld am Versagen oder an der Auffälligkeit der Kinder gegeben. In Fällen, in denen die Eltern an die Gerechtigkeit der Institutionen glauben, beugen sie sich diesem Urteil oder resignieren. Dies gilt im Blick auf vorschulische Institutionen ebenso wie im Blick auf die Schule selbst.
Von sozio-emotionaler Gefährdung sind drittens Kinder betroffen, die in sogenannten Risikofamilien aufwachsen. Hier liegt häufig eine Kumulation spezifischer Probleme vor. Dazu kann eine sehr junge Elternschaft ebenso zählen wie schwere oder chronische Krankheit eines Mitglieds der Familie oder Suchterkrankung und psychische Erkrankung der Eltern. Zudem gelten Familien mit überdurchschnittlich hoher Kinderzahl, instabilen und wechselnden Partnerschaften der Erwachsenen und nur einem Elternteil als Risikofamilien. Der mögliche dauerhaft erhöhte Stresslevel, eine wenig verlässliche positive Stimmung und Verlustängste belasten Kinder stark. So sind auch Traumatisierungen z. B. durch das Erleben von häuslicher Gewalt, Missbrauch und Verwahrlosung zum Bedingungsfeld einer sozio-emotionalen Gefährdung zu zählen. Das Aufwachsen in einer Risikofamilie hat für Kinder nicht zwangsläufig Entwicklungsstörungen zur Folge. Forschungsbefunde zeigen allerdings, dass Kinder aus solchen Familien ein höheres Risiko tragen, unsichere Bindungsmuster, das Gefühl der Unterlegenheit und eine erlernte Hilflosigkeit zu entwickeln.
Als vierte Form potentieller sozialer Benachteiligung lässt sich die sozio-physio-emotionale Gefährdung beschreiben. Grundlegende Differenzlinien sind Alter, Geschlecht, Krankheit und Behinderung. Jedes Anderssein birgt prinzipiell in den jeweiligen sozialen Kontexten das Potenzial, zu einer Bevorzugung oder zu einer Benachteiligung zu gelangen. Grundlegend hierfür ist die soziale Bezugsnorm, eine häufig missverstandene Form »objektiver Bewertung«, die nicht individuelle Verarbeitungsprozesse, sondern lediglich äußere Formen im Vergleich zur aktuellen Bezugsgruppe fokussiert. Körperliche Merkmale und Veranlagungen können von außen betrachtet »objektiviert« werden. Sie entwickeln allerdings eine individuelle emotionale Dynamik und gereichen potentiell zur primären Resonanzbeeinträchtigung, indem der Lebensraum des Betroffenen und die erlebten Rückmeldungen das Entstehen einer gesunden Weltbeziehung beeinträchtigen. Je nachdem, wie eindringlich dem Betroffenen eine körperliche Einschränkung oder ein empfundener Makel bewusst werden und in welchem Umfang ihn daraufhin Minderwertigkeitskomplexe und Einschränkungen in der Auseinandersetzung mit der Welt beschäftigen, gerät er zunehmend in die Rolle sozialer und emotionaler Deprivation.
Soweit die vier sozialen Gefährdungslagen, mit denen knapp ein Viertel der Kinder und Jugendlichen in Deutschland in Kontakt kommen. Obwohl selbstverständlich klar ist, welche schier unendlichen Kombinationsmöglichkeiten beispielsweise bei einem vierstelligen Zahlenschloss entstehen, werden die konkreten sozialen Risiken vieler Kinder in den Erhebungen und Initiativen von Forscherinnen und Forschern häufig wie eine Art Hintergrundrauschen behandelt und die Auswirkungen auf die Lernfähigkeit entweder ignoriert oder stark vereinfachten Kausalitäten zugeordnet. Diesen soll dann möglichst mit der Entwicklung standardisierter Förderprogramme oder direktiver Lernhilfen begegnet werden. Eine Zugangsform, die nicht nur erkennbar aus dem Verständnishorizont bürgerlicher Lebensentwürfe stammt, sondern – wie zu zeigen sein wird – für die Unterstützung sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher ungeeignet ist.