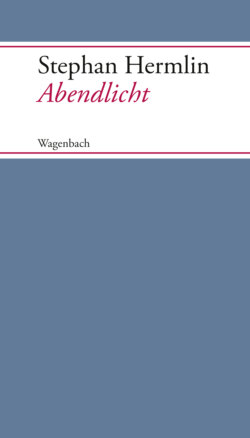Читать книгу Abendlicht - Stephan Hermlin - Страница 10
ОглавлениеIm Sommer 1931 fiel mir auf meinem täglichen Schulweg eine kleine Menschenansammlung vor den beiden Schaufenstern eines Zeitungsvertriebs auf. Ich trat hinzu und blieb eine Weile stehen, nachdem ich bemerkt hatte, daß die Leute in eine politische Diskussion vertieft waren. In den Schaufenstern hingen nebeneinander die Titelblätter der Berliner Zeitungen, vom nationalsozialistischen »Angriff« bis zur kommunistischen »Roten Fahne«. Die Gruppe von Männern bestand aus Arbeitslosen; die geringe Unterstützung, die sie erhielten, erlaubte den meisten nicht, eine Tageszeitung zu kaufen; hier konnten sie durch die Scheiben des Ladens wenigstens die wichtigsten Nachrichten lesen.
Es wurde mir zur Gewohnheit, täglich an dieser Stelle stehenzubleiben und den Gesprächen, die manchmal hitzig wurden, zu folgen. Das rasend um sich greifende Interesse an politischen Vorgängen hatte auch mich erfaßt; ich konnte leicht erkennen, daß die Diskutierenden drei Gruppen zuzurechnen waren: es waren Sozialdemokraten, Kommunisten oder Nationalsozialisten; Vertreter anderer Meinungen gab es nicht. Zu Hause begann man sich zu wundern: ich kam immer später zum Essen. Ich redete mich heraus, indem ich vorgab, mehr Zeit für Sport und eine Arbeitsgemeinschaft in der Schule zu brauchen.
So gut wie alle jene Männer, die ihre Zeit vor dem Zeitungsvertrieb verbrachten, waren Arbeiter oder kleine Angestellte, sie interessierten sich kaum für das, was mich bisher interessiert hatte, sie wußten nichts davon, aber ich fühlte, daß sie vieles kannten, was mir verborgen geblieben war. Es kam mir nicht in den Sinn, an ihren Gesprächen teilzunehmen. Ich blieb mehrere Wochen lang ein stummer Zuhörer.
Ich bemerkte, daß Sozialdemokraten und Kommunisten, wenn sie auch einander immer wieder mit ironischen oder gehässigen Bemerkungen bedachten, gegenüber den Nationalsozialisten ziemlich einig waren. Von den Argumenten, welche die drei Gruppen vorbrachten, überzeugten mich die der Kommunisten am meisten. Auch gefielen mir die Kommunisten, die ich täglich sah – sie hatten, obwohl es ihnen offensichtlich nicht gut ging, etwas Freudiges und Zuversichtliches an sich.
Ich fühlte, wie ich blaß wurde, als einer von ihnen mich eines Tages plötzlich ansprach. Es war nur wenige Tage vor dem Beginn der Sommerferien. Zwar war ich manchmal von Blicken, gleichgültigen oder wohlmeinenden, gestreift worden, aber hier trat jemand auf mich zu, zwei blaßblaue Augen sahen mir gerade ins Gesicht und eine Stimme sagte: »Na, was bist denn du für einer … Bist wohl Gymnasiast, wie?« Die Stimme klang ironisch, aber keinesfalls feindselig; ihr Klang war metallisch, aber man dachte, wenn man sie hörte, nicht an ein edles Metall, eher an das Scheppern von Blech, aus der Stimme hörte man den Willen, sich nichts vormachen zu lassen, sie war wach, illusionslos, tapfer, unschön, ich liebte die Berliner Stimmen, auch Melancholie klang in ihr, eine Melancholie, die sich selber nicht wahrhaben will. In diesem Augenblick, als der Fremde mich anredete, kämpfte in mir die Empörung über das plötzliche und selbstverständliche »Du« mit einer rätselhaften Freude. Ich gab Auskunft über mich, ja, ich besuche das und das Gymnasium, ich wohne dort und dort, ich sei gegen die Faschisten. Wir wechselten noch ein paar Worte, ehe der Fremde mich plötzlich fragte: »Na, wie ist es … Willst du bei uns Mitglied werden?« Er hatte aus seiner Jackentasche einen Zettel gezogen, ein zerdrücktes, nicht sehr sauberes Blatt, das er mir hinhielt. Der Zettel war nicht gedruckt, er war in verwischten, blassen Lettern auf einem Abziehapparat hergestellt worden und bekundete, der Unterzeichner sei von jetzt an Mitglied des Kommunistischen Jugendverbandes Deutschlands. Damals konnte man auf der Straße seinen Eintritt vollziehen, es gab keine Bürgen und keine Kandidatur, und einem neuen Genossen wurden keine Blumen überreicht. Noch nie war ich in einer politischen Vereinigung gewesen; ich gehörte keinem Sport- oder Wanderverein an. Ich blickte auf den zerdrückten, verwischten Zettel und unterschrieb. Die Straße drehte sich langsam und unaufhörlich um mich.
Ich wußte damals nicht, was alles ich unterschrieb: die Verpflichtung, mit den Unterdrückten in einer Front zu kämpfen, von vielen, die mir bis dahin vertraut gewesen waren, als Feind behandelt zu werden, beharrlich, kaltblütig, verschwiegen zu sein, zu lernen und das Erlernte weiterzugeben, Prüfungen verschiedener Art zu ertragen, den Sinn höher zu stellen als das Wort.
Oft habe ich mich später fragen müssen, aus welchem Grunde ich an dieser Unterschrift auf einem unansehnlichen Zettel festhielt, als ich um mich so viele sah, die ihre Unterschrift widerrufen oder einfach vergessen hatten. Auch ich lernte Augenblicke kennen, in denen eine Stimme, die sich wie die Stimme der Vernunft anhörte, mir zuredete, könne denn diese Unterschrift noch gelten, in der ein später so oft enttäuschter guter Wille gelegen habe, sei ich, könne ich überhaupt noch derselbe sein, der damals unterschrieben hatte. Aber eine andere Stimme erhob sich hartnäckig gegen die erste: Der Kampf der Unterdrückten sei der Kampf der Unterdrückten, auch wenn neuerlich Hoffart und Dünkel, Verachtung und Beharren im Irrtum sichtbar würden, der Kampf führe zu neuen Bedrückungen, selbst zu Untaten, er dauere ewig, aber er trage auch das edle Siegel des Strebens nach Menschlichkeit, nach Freiheit und Gleichheit für alle. Gleichzeitig empfand ich, daß ich das Beste in mir aufgeben mußte, wenn ich je meine Unterschrift, die ich um die Mittagszeit eines beliebigen Tages in einer beliebigen Berliner Straße geleistet hatte, als nicht mehr gültig betrachten würde.