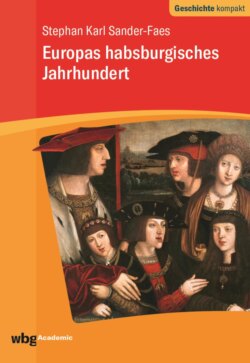Читать книгу Europas habsburgisches Jahrhundert - Stephan Karl Sander-Faes - Страница 12
3. Forschungstraditionen
ОглавлениеDiese mehrfache dynastische, konzeptionelle, rechtliche und territoriale Fragmentierung findet sich auch in den jeweiligen historiografischen Traditionen. Allgemein orientieren sich die meisten Darstellungen entweder an diversen „Geburtsstunden“ oder Entstehungszeiträumen: Für die spanische Historiografie etwa ist die Vereinigung Kastiliens und Aragóns (1469) oftmals bestimmend, für die österreichische Geschichtsforschung ist der entscheidende Moment die Herrschaftsübernahme Ferdinands I. in den österreichischen Ländern (1521/22) und für die Niederlande der Unabhängigkeitskampf nach deren Übergabe an Philipp II. (1527–1598). Diese grobe Dreiteilung verdeutlicht die gesamte Problematik einer umfassenderen Darstellung, doch findet sich dadurch auch der Vorteil des Zuschnitts auf das „habsburgische Jahrhundert“ unterstrichen: Einheit und Vielfalt, Gemeinsamkeiten und Trennendes kennzeichnen die gesamte Epoche, die sowohl davor als auch danach weitaus deutlicher ersichtliche Züge trägt und die sich auch aufgrund dieser drei Forschungstraditionen klarer nachvollziehen lässt.
Spanische Geschichtsforschung
Spanische Habsburger
Grundsätzlich gilt, dass der Eheverbindung der Katholischen Könige, Isabella von Kastilien (1451–1504) beziehungsweise Ferdinand II. von Aragón (1452–1516), große Bedeutung für die Periodisierung zukommt. Da die Iberische Halbinsel nach deren Heirat (1469) großteils vereint war, kommt den wiederholten dynastischen Brüchen, die mit dem Übergang der Kronen auf die Habsburger um 1500 beziehungsweise die Bourbonen um 1700 verbunden sind, eine deutlich untergeordnete Rolle zu. Da der Fokus beider Herrscherfamilien aber vorrangig auf „Spanien“ und dessen Ambitionen – vor allem gegeneinander – ruhte, waren die übrigen binnen- und außereuropäischen Verflechtungen bis weit in das 20. Jahrhundert hinein ebenso wenig zentral für die Forschung. Zwar erlangten die imperialen Dimensionen der Herrschaftszeit Karls V., vorangetrieben durch die Thesen von Ramón Menédez Pidal (1869–1968), größere Bedeutung, jedoch wurde der Habsburger dadurch gleichzeitig auch vermehrt zum „Spanier“ gemacht. Doch waren es diese Wege, die die dynastischen Ambitionen der Habsburger in den Mainstream der spanischen Geschichtstradition brachten. Mit dem Ende der Diktatur Francisco Francos (1892–1975) und der beginnenden europäischen Integration Spaniens ab der Mitte der 1970er Jahren setzte sich hingegen die vor allem mit dem Werk Manuel Fernández Álvarez’ (1921–2010) verbundene Interpretation Karls V. als „Europäer“ durch. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts findet sich diese Deutung einerseits durch ausgewogenere, die regionalen Spezifika betonende Zugriffe sowie die Fokussierung höfischer Dynamiken in manchen Belangen relativiert. Für die vorliegende Darstellung von Relevanz sind hingegen die in den letzten Jahren aufgekommene Deutung des Kaisertums Karls V. als partikulare und unzeitgemäße Institution, für die vor allem die Forschungen von José Martínez Milláns (geb. 1953) verantwortlich zeichnen, sowie die vielen Hinweise Emilia Salvador Estebans (geb. 1938) zentral, die auf die wechselvollen Charakteristika imperialer Herrschaft zwischen Anspruch und Realität verweist.
Kaisertum und Altes Reich
Kaiser und Reich
Das Kaisertum Karls V. (reg. 1519–1556/58) stellt in der deutschsprachigen Forschung eine seit den Tagen Leopold von Rankes (1795–1886) heiß umfehdete Angelegenheit dar. Vielfach wurden die katholischen Habsburger (neben den italienischen Ambitionen der noch mittelalterlichen Kaiser) seitens der borussisch dominierten kleindeutschen Historiografie als „Verhinderer“ eines deutschen Nationalstaates nach englisch-britischem oder französischem Vorbild angesehen. Auch in der habsburgisch-österreichischen Geschichtsforschung, wiewohl an die historiografischen Entwicklungen im benachbarten Preußen-Deutschland angelehnt, spielte das neuzeitliche Kaisertum Karls V. – jedoch aus anderen Gründen – eine ambivalente Rolle: Einerseits, da die Dynastie die Klammer war, die die vielen und überwiegend nichtdeutschsprachigen Nationalitäten zusammengehalten hatte, und andererseits aufgrund der „Orientierungslosigkeit“ der Republik Österreich nach dem Ersten Weltkrieg. Universalistische und vor allem zivilisatorische Überlegenheit in einem eindeutig deutsch konnotierten Mitteleuropa schwang zwar mit, doch war die Einstellung gegenüber dem ehemaligen Herrscherhaus weitaus ambivalenter geworden. Und während Austrofaschismus und Nationalsozialismus beziehungsweise der Zweite Weltkrieg in Hinblick auf das deutsch/österreichische Selbstverständnis Klarheit schufen, dauerte es bis in die 1960er Jahre, bis eine vor allem mit Peter Moraw (1935–2013), Karl Otmar von Aretin (1923–2014) und Volker Press (1939–1993) verbundene und auch zunehmend positive Neubewertung des Heiligen Römischen Reiches wenigstens in der alten Bundesrepublik einsetzte. Das schwierige Verhältnis zwischen der zentraleuropäischen Monarchie des Hauses Habsburg und dem Reich allerdings vermochte auch diese Entwicklung bis heute kaum zu entwirren, wie auch deren nach wie vor zu großen Teilen separaten Interpretationen bezeugen. Die universalistischen Dimensionen des habsburgischen Jahrhunderts, insbesondere ersichtlich in den Arbeiten von Karl Brandi (1868–1946) oder Heinrich Lutz (1922–1986), finden sich, von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, weder im Mainstream der jüngeren deutschen oder österreichischen Forschung wieder, die in den letzten Jahrzehnten vermehrt „Räume“, Höfe und Stände fokussiert, noch in deren weitaus traditionelleren biografischen Zugriffen wieder.
Österreichische Geschichtsforschung
Österreichische Habsburger
Diese Tendenzen sind auch in der Forschung in der Ersten Republik, insbesondere während des Austrofaschismus (1933–1938) und nach dem „Anschluss“ an das nationalsozialistische Deutschland ersichtlich: Während die Dollfuß- und Schuschnigg-Regierungen „Altösterreich“ – allerdings ohne das Herrscherhaus – für die eigene Legitimation einsetzte, strebte das NS-Regime danach, die Vergangenheit der nunmehrigen „Ostmark“ gänzlich auszumerzen.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde auch ein historiografischer Neuanfang notwendig, der in der weitgehenden Abgrenzung der Zweiten Republik von „den Deutschen“ gipfelte. Der hierzu konstruierte „Opfermythos“ und die mit Alphons Lhotsky (1903–1968) verbundene Projektion spätmittelalterlicher Gegebenheiten – der räumliche Umfang der habsburgischen Länder vor Maximilians Übernahme Burgunds (1477) – markierten die weitgehende Abkehr der österreichischen Forschung von regional übergreifenden Bezügen und Themen. Diese Deutung vermochte allerdings weder das Ende des Kalten Krieges noch die zuvor lediglich leidlich unterdrückte Rolle der Österreicherinnen und Österreicher zwischen 1938 und 1945 zu kaschieren. Während in der alten Bundesrepublik der Historikerstreit über die Bedeutung des „Dritten Reiches“ tobte, löste die Kandidatur Kurt Waldheims (1918–2007) für das Amt des Bundespräsidenten (1986) die bis heute währende Aufarbeitung der eigenen nationalsozialistischen Vergangenheit aus. Hinsichtlich der überregionalen Horizonte habsburgisch-österreichischer Geschichte bedeutete dies zwar eine Abkehr von den zuvor sehr eng umfassten räumlichen Bezügen, doch existieren weiterhin keine einheitlichen Begriffs- und Raumvorstellungen über den Umfang österreichischer Geschichte. Symptomatisch für die nach dem Fall des Eisernen Vorhangs erfolgte „Rückkehr“ der (zentral)europäischen Dimensionen habsburgischer Geschichte ist zwar, dass die jüngst vorgelegten Studien dieser Jahrzehnte die so nah und doch unerreichbar gewesenen Räume erneut einbeziehen, doch die wechselvollen Beziehungen der Habsburger mit dem Alten Reich beziehungsweise die spezifischen, mit dem Umfang der vorliegenden Darstellung verbundenen universalistischen Ambitionen bleiben weiterhin weitgehend außen vor.