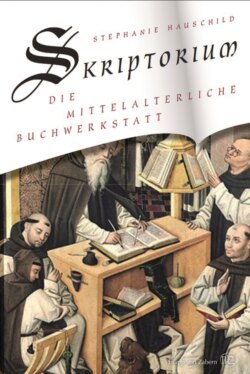Читать книгу Skriptorium - Stephanie Hauschild - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Viele Fragen
ОглавлениеSo, oder doch zumindest ganz ähnlich kann man sich vielleicht Herstellung und Verwendung eines Buches im Mittelalter vorstellen. Produziert wurden die Manuskripte im sogenannten Skriptorium. Betrachtet man Bilder und historische Fakten aber etwas genauer, so wird deutlich, dass der Begriff Skriptorium viel mehr umfasst als die bloße Bezeichnung für die Schreibstube eines Klosters. So kann der Begriff verschiedene Orte meinen, wie den Kreuzgang oder ein zum Schreiben und Malen ausgestattetes Zimmer im Konvent, aber auch die nach kommerziellen Gesichtspunkten betriebene Werkstatt in einer Stadt oder das Privathaus einer Autorin, denn an all diesen Orten wurden Bücher geschrieben. Ebenso lassen sich unter Skriptorium alle Arbeitsvorgänge der Buchproduktion zusammenfassen. Zum Begriff Skriptorium gehören zudem die am Arbeitsprozess beteiligten Personen, die nicht notwendigerweise am selben Ort arbeiteten oder gar ein festes Team bilden mussten. So spricht man etwa vom Skriptorium von Echternach oder vom Skriptorium des Klosters Seeon, wenn es darum geht, Handschriften nach ihrer Herkunft und stilistischen Kriterien zu ordnen.
Mittelalterliches Gebetbuch und mathematische Abhandlung. Aufgeschlagene Doppelseite des von Johannes Myronas geschriebenen Euchologion, Archimedes Palimpsest, 10. und 13. Jahrhundert, Privatbesitz
Doch wie sah solch ein Skriptorium eigentlich aus? Wo befanden sich die Werkstatträume? Welche Arbeiten wurden überhaupt im Skriptorium verrichtet? Welche Materialien und Werkzeuge brauchte man, um ein Buch im Mittelalter herzustellen? Haben Schreiber wie Myronas alles selbst gemacht, oder waren noch andere Personen beteiligt? Wer malte die Initialen aus? Wer entwarf das Layout? Farben, Pergament, Einbände – wo kamen die Rohmaterialien her und wer verarbeitete sie? Schrieben und malten auch Nonnen Bücher? Wo wurden mittelalterliche Bücher außerhalb des Klosters hergestellt? Dies sind einige der Fragen, die in diesem Buch beantwortet werden sollen. Im Mittelpunkt steht die Herstellung bemalter oder „illuminierter“ Handschriften im mittelalterlichen Europa.
Weil Handschriften zumeist nicht ständig dem Publikum ausgesetzt waren, haben sie die Jahrhunderte im Unterschied zu vielen Altarbildern oder Textilien aus derselben Epoche häufig besser überstanden. Licht, neugierige Hände, Staub und Schmutz setzten ihnen weniger zu. Um diesen Zustand zu erhalten, holt man Handschriften heute meist nur für kurze Zeit für Sonderausstellungen aus der Bibliothek oder aus dem Tresor. In der Ausstellung sind sie dann für einige Wochen bei gedimmtem Licht und hinter Glas zu bestaunen. Hat man Glück, wird im Verlauf der Ausstellung umgeblättert, sodass man mehr als nur zwei aufgeschlagene Seiten betrachten kann. Aber nur in seltenen Fällen hat man die Möglichkeit, das gesamte Buch mit seinem Einband zu studieren. Ist der ursprüngliche Buchdeckel noch erhalten und dazu noch mit Gold, Edelsteinen und Elfenbein verziert, werden Deckel und Handschrift im Museum häufig in verschiedenen Abteilungen gehütet und gezeigt, wenn sie nicht sogar in verschiedenen Museen aufbewahrt werden. Dann findet man das Manuskript im Graphischen Kabinett oder in der Bibliothek und den geschmückten Buchdeckel in der Sammlung mit der mittelalterlichen Schatzkunst. So ist es nicht ganz einfach, sich das ganze Buch mit all seinen Eigenheiten zu vergegenwärtigen. Im Museum werden die Handschriften selbstverständlich auf besonders schönen Seiten aufgeschlagen. Die Bücher werden dort wie Bilder präsentiert, weil man die Seiten so am besten betrachten kann und die Bücher auf diese Weise am wenigsten beschädigt werden. Dass die Handschriften auch ganz praktische Funktionen erfüllten und viel genutzte Gegenstände gewesen sind, kann bei dieser Präsentation, die ganz auf die Schauwerte der Objekte ausgerichtet ist, meist nicht herausgestellt werden.
Tatsächlich aber haben die allermeisten mittelalterlichen Handschriften nur eine oder zwei Zierseiten oder besonders schöne Initialen. Manchmal wechselt die Handschrift des Textes, was darauf hinweisen kann, dass mehrere Schreiber an einem Buch gearbeitet haben oder später noch Kapitel hinzugefügt wurden. Gelegentlich wurden sogar mehrere verschiedene Manuskripte zu einem Buch zusammengebunden. Nicht alle Miniaturen (Buchmalereien) wurden auch fertiggestellt, einige Seiten sind vielleicht sogar ganz leer geblieben. Häufig nimmt gegen Ende die künstlerische und handwerkliche Sorgfalt ab. Ganz am Schluss sind manchmal noch Kritzeleien und handschriftliche Vermerke zu entdecken. Solche Details verraten den Forschern viel über die Hersteller der Bücher, über ihre Verwendung und ihre Leser und sie erzählen einiges über das Alltags- und Handwerkerleben im Mittelalter. Doch für eine Ausstellung sind solche Details meist nicht attraktiv genug. Diese Seiten werden daher in der Regel nicht präsentiert.
In den letzten Jahren wurden in Ausstellungen neben den berühmten Handschriften auch weniger bekannte Stücke einem großen Publikum zugänglich gemacht. Von vielen bekannten Büchern gibt es inzwischen hervorragende Reproduktionen, sogenannte Faksimiles. Auch die fortschreitende Digitalisierung und die Bereitstellung der Abbildungen und Forschungsergebnisse im Internet tragen dazu bei, die verborgenen Schätze der mittelalterlichen Buchkunst vielen Menschen näherzubringen. Die Schönheit der Bücher und die selbst für Betrachter ohne spezielles Fachwissen deutlich zutage tretende Kunstfertigkeit der Maler, Schreiber und Buchbinder ermöglicht einen faszinierenden Einblick in die fremde Kultur des Mittelalters. So ist der Zugang zur mittelalterlichen Buchkunst über Abbildungen und Reproduktionen praktisch und angenehm, um die Handschriften in Ruhe anzuschauen und zu vergleichen, die ja sonst weit verstreut an entlegenen Orten aufbewahrt werden und – im Unterschied zu vielen berühmten Gemälden – nur selten ständig für die breite öffentlichkeit zugänglich sind. Um besonders kostbare Originale in den Bibliotheken zu schonen, werden inzwischen selbst Wissenschaftler zunächst auf die Reproduktionen verwiesen.
Doch eine Reproduktion kann die Betrachtung der Originale nicht ersetzen, sondern nur unterstützen. Wohl lässt sich im Ausstellungsraum immer nur ein kleiner Teil des Buches betrachten. Das Licht ist gedämpft, eine Glasscheibe hält den Betrachter auf Distanz und behindert ein intensives Studium der Details, vor allem wenn es sich um kleine Bücher handelt. Andere Besucher möchten die ausgestellten Handschriften natürlich ebenfalls anschauen, sodass nicht immer ein ausgiebiges und ungestörtes Schwelgen möglich ist. Doch ganz unabhängig davon, wie gut Reproduktionen der Handschriften auch gemacht sind, so können sie doch immer nur einen unvollständigen Eindruck des Originals geben. Das hat weniger mit der vermeintlichen Aura des Kunstwerks zu tun als vielmehr mit der Tatsache, dass sich einige Fragen nur am Kunstwerk selbst beantworten lassen. Die Frage „Wie wurden die Bücher gemacht?“ gehört auf jeden Fall dazu. Da man die Hersteller ja nicht mehr fragen kann, muss das Objekt „sprechen“: Größe, Farben, Form, Gestaltung der Oberfläche, das Zusammenspiel der verwendeten Materialien, Spuren von Herstellern und Benutzern geben Hinweise auf Herstellung und Gebrauch. Die Möglichkeit, die Handschrift von allen Seiten anzuschauen und die Details zu erforschen, bietet nur das Original. Keine Abbildung, keine Beschreibung, kein noch so gut gemachtes Vollfaksimile kann dies alles leisten oder gar das Original ersetzen. Ähnlich einem Kriminalisten, der die Begleitumstände einer rätselhaften Tat erforscht und darauf angewiesen ist, den Tatort und die dort gefundenen Objekte selbst in Augenschein zu nehmen, zu untersuchen und miteinander zu vergleichen, ist auch für Betrachter der mittelalterlichen Handschriften der Kontakt mit den Originalen wichtig. Möglich ist die Begegnung nur im Museum, in der Bibliothek oder im Ausstellungsraum.
Das vorliegende Buch soll den an mittelalterlichen Handschriften interessierten Lesern eine kleine Hilfestellung an die Hand geben, solche Bücher in der Ausstellung besser zu verstehen und zu einem eigenen Urteil zu finden. Denn es trägt sehr zum Verständnis jeder Art von Kunst und damit auch von mittelalterlichen Handschriften bei, wenn man sich einmal klar macht, auf welche Weise und aus welchen Materialien die Kunstwerke hergestellt wurden. Denn sie gleichen ja nur auf den ersten Blick unseren heutigen zu Hunderttausenden reproduzierten gleichförmigen Büchern aus Pappe, Papier, Druckerfarbe, Textilien und Kunststoff. Bücher im Mittelalter bestanden aus völlig anderen Ausgangsstoffen, fühlen sich anders an und riechen sogar anders. Zumindest in der ersten Hälfte des Mittelalters wurden sie auch anders aufbewahrt, benutzt und behandelt, als wir das mit unseren heutigen Büchern tun.
Am Beispiel von einigen berühmten und einigen weniger bekannten Handschriften werden im Folgenden mittelalterliche Bücher im Hinblick auf ihre Herstellung und Benutzung untersucht und besprochen. Ausgangspunkt ist die Frage: Was kann man überhaupt sehen, wenn man eine mittelalterliche Handschrift vor sich hat, und was ist wichtig, um eine Handschrift genauer zu verstehen? Denn häufig bleibt der Blick bei der Betrachtung eines Kunstwerks an der Oberfläche, weil man nicht recht weiß, wohin man schauen soll und wie das Gesehene einzuordnen ist. Der Ansatz, der in diesem Buch vermittelt werden soll, beschäftigt sich daher mit denjenigen Merkmalen, die beim Betrachten einer Handschrift sofort ins Auges springen, etwa Format und Größe, das Pergament, Gold und das wunderschöne Blau, das so viele Miniaturen auszeichnet, oder die beinahe unsichtbaren Linien für die Schriftzeilen. Dieses Buch soll dazu beitragen, die viele Hundert Jahre alten Kunstwerke in Ausstellungen und Museen mit neugierigen Augen zu betrachten und den Blick zu schärfen für die Besonderheiten eines typisch mittelalterlichen Gebrauchsgegenstandes, der manchmal auch ein Kunstwerk sein kann.
Doch was verstehen Historiker eigentlich unter dem Begriff Mittelalter?