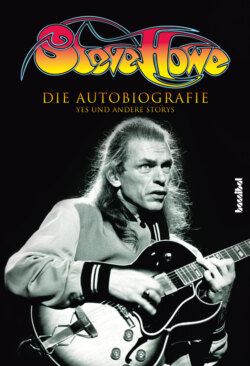Читать книгу Steve Howe - Die Autobiografie - Steve Howe - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 4
Stets voran
Mein Freund Dave betrieb einen Gitarrenladen namens Lewison Guitars in der Charing Cross Road. Er legte ein gutes Wort für mich ein, als er hörte, dass für eine Band ein Gitarrist gesucht wurde.
Die Band hieß The In Crowd. Ich traf mich mit Sänger Keith West in einem nahegelegenen italienischen Restaurant. Die Gruppe hatte erst unlängst mit dem Cover eines Songs von Otis Redding, „That’s How Strong My Love Is“, den Einstieg in die Charts geschafft. Keith hatte mich mit den Syndicats auf Eel Pie Island, einer Themse-Insel, gesehen und hielt mich für einen passablen Musiker. So wurde ich eines Nachmittags zum Vorspielen im Club Noreik in Tottenham eingeladen. Ein peinliches Detail: Ihr ursprünglicher Gitarrist Les Jones kreuzte ebenfalls auf! Der Rest der Band waren John „Junior“ Woods, der Rhythmusgitarre spielte und Harmonien sang, Simon „Boots“ Alcott am Bass und Ken Laurence am Schlagzeug. Ihre Inspiration bezogen sie primär aus dem Soul.
Das Vorspiel verlief tadellos, und nur wenige Tage später spielte ich mit ihnen einen Playback-Auftritt in einer Fernsehsendung namens Thank Your Lucky Stars, um ihre neue Single zu promoten. Ich lernte alle ihre Songs und wurde immer besser. The In Crowd enterten die Hitparade, weshalb ich mich nun auf kreischende Girls und ein generell größeres Spektakel bei ihren Live-Auftritten einstellen musste. Da ging es schon turbulenter zu als noch bei den Syndicats. Es machte jedenfalls Spaß und war auch profitabel.
Die Gruppe unterschrieb dann einen Vertrag bei der EMI mit Produzent Roy Pitt. Meine erste Aufnahmesession fand in den De Lane Lea Studios in Holborn statt, wo wir einen Soul-Song namens „Stop! Wait A Minute“ einspielten, der im September 1965 erschien. Ich erinnere mich noch einigermaßen gut an diesen Studiotermin. Mein Lautstärken- und Klangfarben-Pedal kam auf der B-Seite „You’re On Your Own“ zum Einsatz. Mit The In Crowd aufzunehmen stellte einen deutlichen Fortschritt hinsichtlich geordneten Vorgehens und Professionalität dar. Es fühlte sich kontrolliert an, aber eben auch frei jenes schmuddeligen Feelings, das im RGM geherrscht hatte. Beide Songs enthielten Solos meinerseits, bei denen ich mithilfe einer Fuzz Box den Sound der Gitarre aufbrach – eine Verzerrung, die sich durch ein paar Regler variieren ließ.
Roy Pitt wurde zu einem guten Freund, und wir entspannten uns des Öfteren mal bei ihm zu Hause. Wir tranken und rauchten – eine vergleichsweise harmlose Einführung in die wilderen Seiten des Rock’n’Roll. Es wurde zur Norm, ein bisschen neben sich zu stehen – oder sogar völlig neben sich! Die Musik schien durch den Konsum dieser Substanzen noch besser zu werden. Die Vorstellung, sich „Love Is Strange“ von den Everly Brothers oder Bob Dylans „Positively 4th Street“ bei maximaler Lautstärke anzuhören, erschien einem dann unwiderstehlich. Dylans Song handelte von Haltung. Es ging darum, wo man sich gegenüber einer anderen Person positionierte – wie man in einer Beziehung aufrichtig bleiben konnte, wenn nicht sogar ein wenig grausam. Dylan war zur offenkundigen Stimme unseres Gewissens avanciert. Seine Live-Versionen von „Just Like Tom Thumb’s Blues“ auf der B-Seite von „I Want You“ glich einer Hymne.
Die Bandmitglieder schien ihre Liebe zur Musik zu verbinden, doch es waren auch noch andere Kräfte im Spiel. Eines der größten Probleme manifestierte sich in der Person von John „Boots“ Alcott. Er war ein cleverer, raffinierter, möglicherweise etwas zwielichtiger Bursche. Obwohl er aus Kilburn stammte, wirkte er sehr vornehm. Mit ihm konnte man immer viel Spaß haben. Er trug seinen Bass unterm Kinn, wie das damals eben Mode war. Außerdem mochten ihn die Frauen sehr. Immerhin wusste er sich gut zu kleiden. Eines Tages wurde er in einem Club in Soho um 50 Pfund geprellt, weshalb er den Laden gleich abfackelte. Tragischerweise kam dabei jemand ums Leben. Wir besuchten ihn daraufhin im Pentonville Prison. Das war ein höllischer Ort. Es war ja so traurig, ihn dort zu sehen! Anstatt uns einen neuen Bassisten zu suchen, wechselte unser Rhythmusgitarrist Junior einfach zur Bassgitarre.
Als Nächstes stürzte unser Drummer Ken in einer Kurve aus dem Bandbus. Daraufhin benötigten wir einen neuen Schlagzeuger. Twink von den Pretty Things, der mit bürgerlichem Namen John Alder hieß, schloss sich der Band an. Das brachte die Chemie innerhalb der Gruppe auf eine ganz neue Stufe. Wir spielten nun präziser zusammen und fühlten uns in unserem Glauben an die Band bestärkt. Wir hielten uns für die Besten weit und breit und machten uns sogar ernsthaft Gedanken darüber, uns völlig neu zu erfinden.
Man bot uns dann an, in einem Film namens Smashing Time mit Rita Tushingham als Band namens The Snarks mitzuspielen. In einer Szene, die auf einem Set gedreht wurde, das dem Post Office Tower im Londoner Stadtzentrum ähneln sollte, fand eine Party statt, die schließlich in einer großen Tortenschlacht kulminierte. Ich bekam eine kurze Textzeile zugeteilt. „Auf geht’s!“ oder so ähnlich. Die Dreharbeiten fanden im Studio in South Hampstead statt. Im Anschluss daran ging ich zu Fuß via Belsize Park Road nach Hause. Ich war bedeckt mit Creme und musste ein Bad nehmen, um alles wieder aus den Haaren zu bekommen. Als der Film schließlich in die Kinos kam, hatten wir uns bereits in Tomorrow umbenannt.
Viele Leute innerhalb der Branche schluckten bei Gelegenheit Pillen, die einem einen ordentlichen Push verliehen. Als ich das erste Mal eine einwarf, fühlte ich mich jedoch ziemlich jämmerlich. Nach dem Mittagessen probierte ich eine von den blauen Pillen, die in weiterer Folge meine Zunge lockerte. Ich trank eine Cola nach der anderen und rauchte wie ein Schlot. Nicht sehr empfehlenswert. Speed war nichts für mich. Romilar auch nicht. Dabei handelte es sich um eine gewöhnliche Hustenmedizin, die einen, wenn man sie überdosierte, in einen Rauschzustand versetzte und die subjektive Tiefenwahrnehmung in Mitleidenschaft zog. Die Bandmitglieder entwickelten sich außerdem zu „Gewohnheitsrauchern“. Das war gemütlicher und passte besser zum Musikmachen.
Eines Abends spielten wir in Brighton, als die Polizei eine Drogenrazzia durchführte. Wir wurden vorab gewarnt, dass wir in unserer Garderobe Besuch erhalten würden. Also packten wir unsere Rauchutensilien in eine Tüte und ließen sie aus dem Fenster baumeln. Die Polizisten glaubten, sie hätten uns auf frischer Tat ertappt und durchsuchten den Raum. Allerdings warf keiner von ihnen einen Blick aus dem Fenster …
Wir durften nun die Welt bereisen. So buchte unser Management, die Bryan Morrison Agency, bald ein zweiwöchiges Gastspiel in einem neu eröffneten Club in Mailand. Ich verließ somit zum ersten Mal in meinem Leben britischen Boden. Unsere Manager bei der Agentur hießen Tony Howard und Steve O’Rourke, der eine Weile mit meiner Schwester Stella ging. Außerdem kümmerte sich auch ihre Rezeptionistin Gita Maslen (Rennick) um uns. Obwohl Pink Floyd ihr wichtigster Act waren, wurde uns vom Team immer eine besondere Wertschätzung entgegengebracht. Bevor sie anfingen, Engagements für uns an Land zu ziehen, lud uns Bryan ein, den Vertrag zu unterzeichnen – und kredenzte uns eine Flasche Champagner! Wir hatten das Papier nicht durchgelesen. Aber wie Musiker nun einmal sind, schlugen wir sämtliche Bedenken in den Wind und setzten einfach unsere Unterschriften darunter. Für die Band brach nun eine fantastische Zeit an.
Um nach Mailand zu gelangen, nahmen wir die Fähre über den Ärmelkanal und fuhren weiter durch Frankreich hindurch. Der Schweizer Bergpass, den wir überqueren wollten, war aber leider geschlossen! Nach einer zweitägigen Reise schafften wir es jedoch nach Mailand. Ganz kurz vor unserer Ankunft im Hotel brach dann noch die Antriebswelle unseres Vans. Und als ob das nicht gereicht hätte, beschloss der Besitzer des Clubs, dass ihm unsere Musik nicht zusagte. Er bestand darauf, dass wir gewöhnliche Popsongs anstelle unserer Kombination aus Soul und improvisierten Stücken spielen sollten.
Bereits am Ende der ersten Woche betrug unsere Hotelrechnung so viel wie die gesamte Gage, die wir für zwei Wochen bekommen würden. Das muss wohl an der ganzen Butter gelegen haben, die wir konsumierten. Butter kostete im Jahr 1966 nämlich viel Geld. Vor allem in Italien. Und dann war da noch der Wein, der in Strömen floss. Wie wir überlebt haben, weiß ich nicht mehr. Allerdings kann ich mich noch daran erinnern, dass uns überall die Leute angestarrt und ausgelacht haben. Sie sprachen Italienisch und zeigten missbilligend mit dem Finger auf uns. Warum? Nun, wir kleideten uns im modischen London-Look, doch der hatte sich noch nicht nach Mailand herumgesprochen: blumige Hemden, lange Haare und Sterne oder Glitzer auf unseren Gesichtern. Das alles wirkte auf die Einheimischen eher tuntig. Wir fielen auf wie bunte Hunde – in sehr engen Hosen!
Trotz allem amüsierten wir uns prächtig in Mailand, genossen den Lifestyle und die lautstarken Diskussionen auf der Piazza del Duomo, während wir gleichzeitig den Spott ausblendeten. Wir ließen unseren Wagen reparieren, und nach Beendigung unseres Gastspiels fuhren wir damit wieder nach Hause. In beide Richtungen betrug die Wegstrecke jeweils 1.500 Kilometer. Wir transportierten unsere ganze Ausrüstung mitsamt komplettem Schlagzeug, meiner 175er-Gitarre und dem Vox AC-50, einer Bassgitarre mit Amp und Reisegepäck und Roadie. Die gute alte Zeit war vielleicht gar nicht so gut.
Nach unserer Rückkehr schien mir der richtige Zeitpunkt gekommen, einen Schlussstrich unter alles zu ziehen, was ich zurückgelassen hatte. Dazu gehörte zu Hause bei meinen Eltern zu wohnen ebenso wie die Beziehung zu meiner damaligen Freundin und die Sauferei. Als Nächstes verbrachte ich sechs Monate zusammen mit einem amerikanischen Girl, die in einer gemütlichen Kellerwohnung in Belsize Park wohnte. Mein Bruder Philip wohnte weiterhin bei Mum und Dad, wo er im Dunkeln Miles Davis’ bahnbrechendes Album Sketches Of Spain lauschte, auf dem sich auch Gil Evans’ Arrangement von Joaquín Rodrigos „Concerto De Aranjuez“ befand. Ich liebte die originalgetreue Version von John Williams und Julian Breams, doch dies hier war ein gutes Beispiel dafür, wie Musik in einem unterschiedlichen Stil interpretiert werden kann. Verschiedene Arten von Musik zu adaptieren übte eine gewisse Faszination auf mich aus.
Mein Spiel wurde immer besser. Meine Sounds brachten die Leute dazu, Dinge zu sagen, die zwar sehr schmeichelhaft waren, mir aber letztendlich schnuppe waren. Klar, es war gut für mein Selbstvertrauen, aber ich ließ mich dadurch nicht dazu verleiten zu glauben, dass meine Aufgabe hier bereits erledigt wäre. Tatsächlich glaubte ich, dass ich noch nicht einmal die Oberfläche des Möglichen angekratzt hätte. Eigentlich befehligte die Gitarre eher mich als umgekehrt. Echo und Fuzz, Wah-Wah und Phaser waren die prägenden Gitarreneffekte jener wegweisenden Zeit. Solche Gadgets verliehen dem allgemeinen „Radau“, der aus den Verstärkern dröhnte, noch den besonderen Pfiff – ein spezielles Zischeln, das wir mit dem Sound von siedendem Frittenfett verglichen. Natürlich ist die Arbeit mit Gitarreneffekten aufgrund diverser digitaler Möglichkeiten wie etwa Verstärker-Simulationen heute noch viel faszinierender als früher.
Mir die besten Gitarristen der Welt anzuhören half mir dabei, unterschiedliche Stile zu entwickeln. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, woher ich die Idee hatte, zwei Gitarren auf einmal zu spielen. Allerdings tat ich das schon drei oder vier Jahre, bevor ich zum ersten Mal eine Gitarre mithilfe eines kleinen Ständers abstützte. Ich hängte mir einfach eine kleine Gibson Melody Maker (einfacher Cutaway, einzelner Tonabnehmer) über die Gibson 175, stöpselte sie in den zweiten Kanal meines Amps und spielte langgehaltene Akkorde in weiter Lage auf ihr, wohingegen ich die 175 für Melodielinien einsetzte. Ein wenig später griff ich während ausgedehnter Jam-Passagen für tiefe Haltetöne darauf zurück.
Mein Schaffen mit The In Crowd war sehr aufregend, aber wir durchliefen bald schon einen großen Neuausrichtungsprozess – eine Phase der Rekonstruktion, wenn man so will. Oder in unserem Fall vielleicht D-Konstruktion, da D für uns jene zentrale Tonart war, in der wir viele unserer ungestümen, experimentellen Nummern spielten.
Eines Tages wurden wir ins Hyde Park Hotel eingeladen, um uns mit dem berühmten italienischen Regisseur Michelangelo Antonioni zu treffen, da dieser auf der Suche nach einer Band für seinen nächsten Streifen Blow Up war, der heute als Kultfilm gilt. Wir diskutierten verschiedene Ideen. Etwa, dass ich einen billigen Nachbau meiner Gitarre für die Kamera zerdeppern sollte. Ich hätte mir eher ein Bein brechen lassen, als dass ich eine meiner eigenen schönen Gitarren beschädigt hätte! Der destruktive Umgang mit ihren Instrumenten hatte einige Bands dieser Tage ziemlich berühmt gemacht, doch war das schlichtweg nicht mein Stil! Wir absolvierten dann genau einen Drehtag, bevor wir erfuhren, dass die Yardbirds uns fortan ersetzen würden. Ihre damalige Besetzung umfasste Jeff Beck und Jimmy Page, und sie waren garantiert prominenter als wir. Im fertigen Film sieht man, wie Beck eine Gitarre zerstört, die ursprünglich gebaut worden war, um meiner zu ähneln. Keith hatte für den Film sogar schon einen Song geschrieben, der logischerweise „Blow Up“ hieß. Wir nahmen ihn auf und spielten diesen geradlinigen Rock-Track Antonioni vor. Allerdings schaffte er es nicht in den Film. Dafür bekommt man ihn als einen der In-Crowd-Songs auf Anthology 2 – Groups And Collaborations zu hören.
Zu unseren Gigs zählten auch Debütantenbälle, die wie so viele unserer Shows von unserem guten Freund Lord Antony Rufus Isaacs organisiert wurden. Diese Feiern machten großen Spaß. Zunächst wurden wir gut verköstigt und dann auf die Bühne geschickt. Oft spielten wir in Festzelten kurz vor Mitternacht, um die Feierlichkeiten ordentlich aufzulockern. Das war schon sehr witzig. Tony ergatterte für uns auch einen Gig bei einer Modenschau samt Laufsteg in Knokke Le Zoute an der belgischen Küste. (Lustigerweise sollte ich mich mit Yes 1970 ebendort zu ein paar Songs von Time And A Word vor der Filmkamera in Pose werfen.) Die Reaktion auf unsere Show ließ schwer zu wünschen übrig. Im Anschluss ließen wir uns ordentlich volllaufen. Wie die letzten Deppen schleuderten wir Teller aus dem Fenster unseres Apartments im vierten Stock, in dem wir untergebracht worden waren. Die belgische Polizei rückte aus und konfiszierte unsere Reisepässe. Wir mussten uns nun die ganze Nacht lang wie brave Jungs benehmen, bevor wir unsere Dokumente am folgenden Morgen wieder ausgehändigt bekamen.
Eines Abends spielten wir vor Cream in einem Club in Portsmouth namens Birdcage, in dem wir schon ein paar Mal aufgetreten waren. Wir fanden es sehr eigenartig, dass sie nach ihrer intensiven Show in die Garderobe kamen und sich mit völlig niedergeschlagenen Minen niedersetzten und vor sich hin schwiegen. Wir waren an eine gewisse Kameraderie zwischen den Bands gewohnt und gingen davon aus, dass sie völlig verpeilt gewesen sein mussten, da sie so gar keine Freude auszustrahlen schienen. Heute verstehe ich jenen Druck, unter dem sie wahrscheinlich standen, etwas besser. Man pushte sich selbst jeden Abend ans Limit, und das Leben auf Achse vermochte einem auch ganz schön an die Substanz zu gehen. Die Nerven können dann schon mal blank liegen – vor allem, wenn auch noch „hedonistische Hilfsmittel“ im Spiel sind. Die meisten von uns kratzen rechtzeitig noch die Kurve, andere wiederum nicht.
Unsere letzte Aufnahme als The In Crowd hieß „Why Must They Criticise“ und erschien im September 1965 als Single. Dabei handelte es sich um eine Art Protestsong. Die B-Seite schmückte mit „I Don’t Mind“ ein Song von James Brown. Protest war allerdings nicht gerade unser angestammtes Metier. Auch wenn wir uns dafür stark von unserer liebsten amerikanischen Band, den Byrds, hatten beeinflussen lassen, reichte es nicht aus, um den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Singles sollen in erster Linie kommerziell erfolgreich sein. Damit schien nun das Ende einer Ära eingeläutet worden zu sein.
Keith und ich teilten uns wenig später ein Hotelzimmer über dem Blaises, einem Club in South Kensington, wo wir ein längeres Gastspiel absolvierten. Wir wohnten somit unweit von Chelsea, nahe dem Victoria & Albert Museum und dem Hyde Park. Im Blaises spielte etwa auch Jimi Hendrix seinen ersten Gig in England, und wir waren ebenfalls vor Ort, als er die Bühne betrat. Er führte bereits sein Trio mit Mitch Mitchell und Noel Redding an. Jedem fiel sofort auf, wie besonders Jimi doch war. Nach seinem aufregenden Auftritt setzte er sich zu uns an den Tisch und erwies sich als perfekter Gentleman. Wir grüßten einander oft, wenn wir uns bei gemeinsamen Auftritten über den Weg liefen.
The In Crowd spielten zwei Mal pro Woche im Blaises. Dort ließen wir uns auch ein neues allabendliches Ritual einfallen. Bevor wir auf die Bühne stiegen, präparierten wir nämlich eine Shisha mit Tabak und Haschisch. Während unserer Auftritte waren wir voll stoned, aber fühlten uns auch auf eine seltsame Weise miteinander verbunden und erkundeten gemeinsam die Grenzgebiete unserer Musik. So hielten wir es dann den ganzen Sommer der Liebe lang – und auch weit darüber hinaus.
Wir spielten auch regelmäßig im Speakeasy, einem Club nahe der U-Bahn-Haltestelle Oxford Circus, wo Musiker gern die Nacht zum Tag machten. Es war ein beliebter Treffpunkt, an dem getrunken und auch Essen serviert wurde. Dort gingen viele schöne Frauen ein und aus – so etwa auch meine zukünftige Gemahlin Jan. Wir hingen dort auch dann ab, wenn wir gar nicht spielten. An einem solchen Abend gab Joni Mitchell, die damals in Großbritannien noch eine Unbekannte war, ein spontanes Konzert. Sie fesselte mich förmlich, und fortan war ich ein großer Fan ihrer Songs, ihres Spiels und ihres Gesangs. Sie war schon damals hinreißend, obwohl sie noch ganz am Anfang stand. Alle lauschten wir ihren wunderschönen Alben – damals wie heute. Sie ist eine absolut umwerfende Künstlerin.
Keith brachte dann ein paar neue Songs, die wie maßgeschneidert für die Band waren. Offenbar bewegten wir uns in eine neue Richtung. Wir standen im Einklang mit der generellen Stimmung, die sich 1967 immer mehr zu verbreiten schien. Wir probten in einem kalten, düsteren Keller und nahmen schrittweise Anpassungen an unserem Sound vor, dehnten etwa die Soli in die Länge. Das hing ganz vom Gefühl ab. Wenn es sich aus irgendeinem Grund nicht richtig anfühlte, hielten wir die Soli kürzer. Wenn der Flow aber passte, zogen wir sie in die Länge. Bei unseren Shows gelang es uns nun, vermehrt musikalisch aufeinander einzugehen. Wir waren diszipliniert, was uns größere Kontrolle über unsere Konzerte verlieh.
Wir verwandelten uns kontinuierlich in eine andere Band, deren Ideen ganz dem Zeitgeist entsprachen. Es war die Ära von Flower Power, von Liebe und Friede. So benannten wir uns schließlich in Tomorrow um – als ob uns die Gegenwart, das Heute, nicht gereicht hätte. Wir waren ziemlich originell, was auch durch Juniors Performance noch einmal unterstrichen wurde. Spärlich bekleidet tanzte er wie wildgeworden herum. Tatsächlich trug er einen Lendenschurz, der nur das Nötigste bedeckte, und auch sein Gesicht hatte er sich vorab bemalt. Eine Zeit lang hatten wir auch eine eigene Tänzerin auf der Bühne, die Suzy Creamcheese – eigentlich Suzy Zeiger – hieß. Sie war Amerikanerin, mit Frank Zappa befreundet und konnte richtig gut tanzen. Suzy und Junior gaben sich provokant-frivol, während ihre sinnlichen Bewegungen durch den Wirbel des pulsierenden Beats und der improvisierten Gitarrenläufe noch verstärkt wurden. Meine ausgedehnten Soli umfassten dabei oft eine dröhnende Quarte oder D-Saite. Ich erhöhte außerdem die Anzahl der einzelnen Pole Pieces an den Tonabnehmern meiner Gitarre, damit die D-Saite schneller rückkoppelte und somit deutlich lauter wurde. Vor diesem klanglichen Hintergrund jagte ich dann mit meinen Fingern über die drei darüberliegenden Saiten. Obwohl das D oft dröhnte, war es nicht unbedingt der Grundton meiner damals bevorzugten Tonart. Das einzige Album, das diesen explorativen Sound beinahe zu fassen imstande war, war Tomorrow von 1968, das auch eine Coverversion von „Why“ von den Byrds enthielt. Ich fügte diese Aufnahmen auch dem zweiten Teil meiner Anthology hinzu.
Damals fühlte es sich geradezu berauschend an, die eigene Leidenschaft mit ähnlich denkenden Menschen zu teilen, die ebenfalls nach einer neuen Art Freiheit strebten, sich selbst sein wollten – oder zumindest diejenigen, die sie dachten, dass sie sie wären. Chelsea galt damals als angesagtester Ort – für Spaziergänge, eine Shoppingtour oder um etwas zu essen. Das Epizentrum bildeten hier die Shops, Cafés und Wohnungen unserer Freunde auf der King’s Road. Der Laden Granny Takes A Trip verkaufte heiße Klamotten und verfügte über eine eigene Stammkundschaft. Tatsächlich besitze ich auch heute noch jene Jacke, die ich bei Granny gekauft hatte und auf den Fotos von Tomorrow trage. Die Auswahl an Drogen in dieser Gegend wurde nur durch die eigene Vernunft beschränkt. LSD wurde kaum konsumiert und wenn, dann nur mit gebotener Vorsicht. Hasch und Gras wurden brüderlich geteilt, solange der Vorrat reichte. Speed galt mittlerweile als uncool. Harte Drogen standen im Ruf, total destruktiv zu sein. Zumindest traf das auf unseren eigenen Bekanntenkreis zu. Immerhin hatte ich mit eigenen Augen die fatalen Folgen dieser Rauschmittel gesehen, weshalb ich mich nie darauf einließ. Mir wurde schon relativ früh eingebläut, die Finger von dem Zeug zu lassen – und zwar von jemandem, der sich auskannte.
Der benebelte Impuls, der unsere Leben damals kurzfristig zu bestimmen schien, dauerte nur 1967 an. Der Spaß schien keine Grenzen zu kennen, und wir fühlten uns auf telepathische Weise mit Menschen verbunden, die wir gar nicht persönlich kannten. Unser Ziel hieß Frieden – und Liebe war die bevorzugte Methode. Eines Tages saßen wir alle in einem Londoner Taxi und fuhren die Kensington High Street hinunter. Wir waren durch ein geschlossenes Fenster vom Fahrer getrennt. Hinten rauchten wir gerade, als plötzlich ein Polizeiwagen auf sich aufmerksam machte. Er überholte und stoppte direkt vor uns. Ich nahm an, dass wir nun gleich festgenommen würden, weshalb ich ein weißes Kistchen samt anderen „Raucher-Paraphernalien“ aus dem Fenster bugsierte. Was wir bis dahin geschmaucht hatten, flog gleich hinterher. Die Polizisten näherten sich dem Fahrer und erklärten ihm, dass er verbotenerweise rechts abgebogen sei. Wir aber sprangen flott aus dem Taxi und betonten, dass wir nicht länger warten könnten. Schnell liefen wir die Straße zurück, um das weiße Kistchen sicherzustellen. Ach, so typisch 1967!
Unsere Musik ertönte in den populärsten Schuppen Londons – etwa im UFO an der Tottenham Court Road, im Middle Earth in Covent Garden und im Roadhouse in Chalk Farm. Tomorrow machten oft den Anheizer für Pink Floyd, und eines Abends, als wir gar nicht selbst spielen sollten, wurde ich eilenden Schrittes ins UFO befohlen, um für Syd Barrett einzuspringen, von dem die Jungs von Pink Floyd vermuteten, dass er sie versetzen würde. Ich hatte mich bereits darauf eingestellt und sollte einfach improvisieren, da wir ja keine Zeit gehabt hatten, miteinander etwas einzustudieren. Aber dann kam Syd (leider!) doch noch auf den letzten Drücker zur Tür hereingeschneit. Allerdings sah er schon ein wenig angeschlagen aus, der Gute.
Wir spielten Unmengen Konzerte, gingen mit anderen Gruppen auf Tour und traten einmal ein Wochenende lang mit Donovan und Tom Jones in einer Küstenstadt auf. Keine Ahnung, wie diese Touren, die wir mit anderen Bands absolvierten, nur funktionieren konnten. So begaben wir uns etwa mit Traffic und Vanilla Fudge auf Achse. Am ersten Abend traten wir im Astoria in Finsbury Park auf, aus dem später das Rainbow wurde. An diesem Abend kam es noch vor ihrem Auftritt zu einem Mordsstreit zwischen den Jungs von Traffic. Kurze Zeit später stiegen sie aus der Tour aus.
Ein weiterer überaus denkwürdiger Abend fand am 28. April im UFO statt. Während einer unserer Improvisationen stellte Junior seinen Bass zur Seite und ergötzte das Publikum mit einer spontanen Tanzeinlage. Das verstand Jimi Hendrix als Einladung, auf die Bühne zu kommen und sich Juniors Bass zu schnappen. Die Musik ging weiter, nun mit Jimis Unterstützung. Er wirkte konzentriert – fest entschlossen, mit uns einen heißen Jam hinzulegen. Diese Solo-Passagen konnten schon einmal 10 bis 15 Minuten anhalten. An diesem Abend dehnten wir diese Sequenz sogar noch länger aus. Wenn damals nur irgendjemand unser Set aufgenommen hätte! Unser Freund Joe Boyd, der auch im Publikum stand, meinte, er hätte jemanden mit einer Kamera filmen gesehen. Aber wir fanden nie irgendwelche Aufnahmen davon. Joe war ein großer Fan von Tomorrow und half uns oft dabei, unseren Karren entlang der holprigen Straße zum Starruhm – oder zumindest in die Nähe dessen – auf Kurs zu halten. Wir waren ganz fest davon überzeugt, dass es unsere Musik verdient hatte, sich in der absoluten Elite zu etablieren. Am Tag nach unserem Jam mit Jimi Hendrix, dem 29. April 1967, spielten wir beim „Fourteen-Hour Technicolour Dream“, einem Konzert im Nordlondoner Alexandra Palace. Ebenfalls auf dem Programm standen viele der größten Bands der Psychedelic-Ära. Das war ein sehr denkwürdiger Gig in einem riesigen Konzertsaal, der perfekt ausstaffiert war für ein tolles Freakout-Happening.
Wir performten auch in der allerersten Show von John Peel auf BBC Radio 1, die in Kooperation mit den Maida Vale Studios aufgezeichnet wurde. Es hatte sich ein neuer Radio-Stil entwickelt. Dabei war es nun möglich, längere Tracks und Live-Sessions von neuen Gruppen wie uns auszustrahlen. John war ein Fan von uns.
Ich spielte ein paar Sessions für Mark Wirtz, den ersten Produzenten, der mich als Gitarrist für ein paar Overdubs buchte. Als ich eintraf, wunderte ich mich, wo denn die anderen Musiker steckten. „Ach, ich habe nur dich herbestellt“, meinte Mark. Ich kam daraufhin schon bald in die Gänge und spielte ein paar Parts für „Theme From A Teenage Opera“ ein. Es war das erste Mal, dass ich meine Gitarre doppelte. Das machte alles einen Riesenspaß, da ich die ungeteilte Aufmerksamkeit des Produzenten genoss. So erfuhr ich all die Akribie, die einzelnen Gitarren-Sounds zuteilwurde.
Mark betreute fortan Tomorrow als Produzent, was zum Teil daran lag, dass er mich für Sessions buchte – zunächst als Rhythmus-, dann als Leadgitarrist, nachdem er mich und Big Jim Sullivan gegeneinander ausgetauscht hatte. Allerdings lag es wohl auch daran, dass er mich gefragt hatte, ob ich einen Sänger kennen würde, der seine eigenen Texte schreibe. Und auf Keith traf diese Beschreibung zu. So arbeiteten die beiden schließlich an der Hit-Single „Grocer Jack – Excerpt From A Teenage Opera“. Zu diesem Track steuerte ich übrigens ebenfalls Overdubs bei. Hier spielte ich wie auf einer Mandoline, wobei die Spur verlangsamt ablief. Marks Oper blieb indes unvollendet. Die Single allein hatte schon so viel Geld gekostet, dass EMI Mark das Budget kürzte und er seine extravaganten Projekte nicht mehr auf demselben Level fortsetzen konnte. Doch nun kannte er schon die halbe Band, und wir wollten ein Album aufnehmen, weshalb uns Mark einen Deal mit EMI organisierte.
Dazu muss man aber anmerken, dass diese Deals in den Sechzigerjahren richtig beschissen waren. Die EMI ließ sich nie auf Verhandlungen ein. Bis heute bekommen wir nur zwei Prozent, die wir untereinander aufteilen müssen. Das bedeutet, dass 98 Prozent aller von uns generierten Einnahmen an die EMI fließen – und den vier Bandmitgliedern bleiben jeweils 0,5 Prozent. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen! Wie viel Unrecht muss erst geschehen, bis irgendwann der Gerechtigkeit Genüge getan wird?
Als wir in den Abbey Road Studios aufnahmen, schauten auch die Beatles manchmal bei uns im Studio 2 vorbei. Na ja, zumindest Paul und Ringo. Das war schon sehr cool und ließ uns die Sessions gleich noch mehr genießen. Wir probierten freakige Ideen aus, die manchmal die tatkräftige Unterstützung der Hausmeister erforderte – weil sie etwas reparieren oder ein neues Spielzeug hereinschleppen mussten. Diese Typen in ihren weißen Overalls erinnerten mich ein bisschen an den „Fahrrad-Reparier-Mann“ bei Monty Python’s Flying Circus! Mittlerweile war „Rückwärtsgitarre“ in Mode gekommen. So haben wir unseren Song „My White Bicycle“ mit rückwärts abgespielter Leadgitarre und Hi-Hat aufgenommen. Das Ende wurde an den Anfang gestellt, und der Anfang – ja, richtig geraten – landete am Ende. Wir luden sogar einen richtigen Polizisten ins Studio ein. Nachdem wir vorab gewisse Dinge weggeräumt hatten, baten wir ihn, in seine Pfeife zu blasen, sobald Keith sang: „They’ll find some charge, but it’s not thieving.“ Dabei war „Charge“ ein anderes Wort für, nun ja, Rauchwaren. Er blies also feste in sein Pfeifchen, damit es auch so authentisch wie möglich klang. Wir spielten diesen Song oft zu Beginn und am Ende unserer Konzerte. Außerdem veröffentlichten wir ihn im Mai 1967 als Single. „My White Bicycle“ mauserte sich noch vor der endgültigen Fertigstellung des Albums zu einer Art Hymne.
Die meisten Tracks betreute niemand Geringerer als Geoff Emerick als Toningenieur. Er hatte sich auch um etliche Beatles-Aufnahmen gekümmert. Wir verfügten aber nur über begrenzt Material, weshalb wir wohl oder übel auf einige seltsame Pop-Nummern zurückgreifen mussten. Unsere zweite Single namens „Revolution“, die Keith und ich gemeinsam geschrieben hatten, entstand noch vor dem gleichnamigen Beatles-Song, soll sie aber zu dem Titel inspiriert haben. Die verschiedenen Elemente dieses Songs waren alle wunderbar aufgenommen, doch liefen sie nicht alle im selben Tempo ab. Mark tat sein Bestes, um dies mithilfe von eingefügten Lücken und Echo-Effekten zu kaschieren. Wir hatten bereits ein Demo dieser Nummer aufgenommen, die 1998 als Teil einer CD mit dem Titel 50 Minute Technicolor Dream erscheinen sollte. Diese Version hatte dasselbe Intro und dasselbe Ende, aber litt unter einer Überdosis Phasing. Wir nahmen den Song schließlich mit einigen die Stimmung verändernden Elementen auf. Dazu gehörten etwa ein paar Streichinstrumente.
Es machte einen Heidenspaß, bei „A Real Live Permanent Dream“ die Sitar zu spielen. In erster Linie spielte ich aber meine 175. Meine andere Gitarre, die winzige Antoria LG50, die mit etlichen bunten Karton-Schnipseln beklebt war, kam für mehrere kleine Overdubs zum Einsatz. So etwa bei „Strawberry Fields“, wo ich sie für das Bending von G zu A verwendete. Das Arrangement dieses Songs war vielleicht von Vanilla Fudge beeinflusst.
Ich hätte auch beinahe mit Ella Fitzgerald gespielt. Ian Ralfini, ein A&R-Mann, hatte mich für diese Session gebucht. Ich kam gerade rechtzeitig bei den Olympic Studios in Barnes an, um dann jedoch mitzukriegen, wie diese Grande Dame gerade von zwei Muskelprotzen hinausbegleitet wurde. Womöglich hatte ihr irgendetwas nicht ganz in den Kram gepasst. Schade, ich hätte nur allzu gern mit ihr gespielt. Es kreuzten verschiedene Musiker auf, scheinbar aus dem Nirgendwo, und verschwanden wieder. Jim Capaldi saß hinterm Schlagzeug, Mick Jagger stand im Regieraum. Das ist alles, woran ich mich noch erinnern kann. Irgendetwas wurde auch aufgenommen, aber ich glaube nicht, dass es jemals veröffentlicht wurde.
Eines Abends verließ ich den UFO-Club ein wenig benommen. Da realisierte ich, dass mir wohl jemand etwas in meinen Drink gekippt hatte. Ich erinnere mich noch vage daran, dass ich mit einem Bus zum Whitestone Pond in Hampstead fuhr. Anschließend spazierte ich durch den nahegelegenen Park Hampstead Heath. Dann reißt meine Erinnerung ab. Am nächsten Morgen erwachte ich auf einer Bank vor dem Kenwood House. Dieses wunderbare Gebäude mitsamt eigener Parkanlage hatte da bereits seine Pforten für Besucher geöffnet.
Die Auswirkungen von LSD jagten mir eine Heidenangst ein. Wir hatten uns gelegentlich einen halben Trip eingeworfen, aber auch nur, wenn Zeit und Ort dies zuließen, im Kreis von Freunden in sicherer Umgebung. So bestimmten wir zumindest selbst über unser Schicksal. Manchmal musste ich so heftig lachen, dass ich Seitenstechen davon bekam. Die Musik fühlte sich immer sehr intensiv an, während die Zeit langsamer zu vergehen schien. Liebe schien uns alle auf telepathischem Wege zu verbinden.
Mark Wirtz wollte ebenfalls LSD ausprobieren. Also fanden wir uns eines Abends bei ihm in seiner Wohnung in einem Hochhaus neben dem GPO Tower ein, um genau das zu tun. Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band – die wichtigste Platte von 1967 und von hohem Stellenwert für unser Leben – lief in Endlosschleife. So richtig laut! Zunächst tauchte Mark noch gut ins Feeling ein, doch dann öffnete er die Balkontüre und verkündete: „Ich glaube, ich kann fliegen!“ Keith und ich zerrten ihn wieder zurück in die Wohnung und schlossen die Tür. Er beruhigte sich langsam wieder, aber wir mussten ein paar Stunden lang ein Auge auf ihn haben.
Ein anderes Mal auf LSD saß ich in meinem Zimmer und spielte Gitarre. Die ganze Nacht lang! Leute unterhielten sich daneben, und ich begleitete sie auf meinem Instrument, wie es mir angemessen erschien. Es passierten aber auch oft verrückte Sachen, und Menschen kamen dabei zu Schaden. Manche nur vorübergehend, wohingegen andere nicht so viel Glück hatten. Mit der Zeit kam es aus der Mode, sich LSD einzuwerfen. Es kam vor, dass sich Leute eine Auszeit nehmen mussten, um sich von den Folgen zu erholen. Bei manchen wirkten die Effekte von LSD auch noch jahrelang nach.
Mit Tomorrow trafen wir schließlich auch einen unserer ganz großen Helden, nämlich den großartigen Songwriter und Gitarristen Frank Zappa. Twink brachte ihn mit in seine Wohnung nach Eden Grove, wo Keith und ich geduldig auf sein Eintreffen warteten. Er versicherte mir, dass er mein Gitarrensolo bei „Claremount Lake“ – der B-Seite von „My White Bicycle“ – für eines der besten Solos überhaupt hielt. Ich war völlig geplättet! Wir unterhielten uns über seine Band und darüber, wie sehr wir alle auf Absolutely Free, das erste Album der Mothers of Invention, sowie seine Spieltechnik und sein Songwriting abfahren würden. Er war sehr einflussreich und vertrat seine Haltung. Auch wusste er, das Wah-Wah-Pedal sehr clever einzusetzen – wie ein Lockgeräusch, wenn man auf der Pirsch lag, bevor er wirklich Gas gab. Es war eine schräge Mischung aus rhythmischer Hexerei, die sich erst zu entfalten vermochte, wenn er zu performen begann.
Gegen Ende 1967 spendierte Keith uns beiden einen Urlaub auf Jamaika. Der Erfolg unserer Hit-Single machte es möglich. Wir flogen in einer VC10, fläzten uns in große Lehnsessel ohne Sicherheitsgurte und rauchten – nicht, dass ich das heute auch nur im Geringsten vermissen würde. Wir nahmen zwei Gibson-Archtop-Gitarren mit, damit wir komponieren konnten. Seine Cromwell, die zwar von Gibson gebaut, aber unter einem anderen Namen verkauft wurde, kam ganz unbeschadet an. Meine Gibson, das ein ähnliches Modell war, jedoch exklusiv über den britischen Laden Francis, Day & Hunter verkauft wurde, überstand die Reise hingegen nicht. Die British Airways Overseas Corporation zahlte letztendlich für die Reparatur.
Wir schrieben nicht wahnsinnig viele Songs dort, lagen stattdessen in der Sonne herum und sinnierten darüber nach, ob es nicht möglich wäre, für immer dort zu bleiben. Auch fragten wir uns, ob das Leben in London oder doch unser Leben hier auf Jamaika das „echte“ sei. Wir fuhren mit dem Taxi nach Montego Bay, um lokale Erzeugnisse zu erstehen. Damals war das eine Barackenstadt. Wir schlenderten über einen Marktplatz. An den Ständen wurden in erster Linie Schuhe feilgeboten. Unser Fahrer steckte unser Geld einem Typen zu, der auf der einen Seite des Marktes herumlungerte. Dann fuhren wir auf die andere Seite, wo uns ein Päckchen auf die Rückbank geworfen wurde. Wir waren nun im Besitz des berüchtigten „Ganja“. Bob Marley wäre sicher stolz auf uns gewesen.
Wenn wir dieses Zeug rauchten, waren wir oft wie gelähmt. Manchmal lachten wir aber auch Tränen. Eines Abends, so erinnere ich mich, sagte ein Kellner mit verschmitztem Lächeln zu mir: „Wenn Sie mir bitte folgen wollen, Madam.“ Da prusteten wir los und konnten uns kaum mehr einkriegen. Wir waren es so gar nicht gewohnt, puren Stoff aus einer Pfeife zu rauchen. Das war schon ziemlich brutal. Bei Gelegenheit zeigte uns ein Typ, der die hoteleigenen Chalets dekorierte, wie man mit Zeitungspapier Joints drehen konnte. Offenbar machten das die Einheimischen so. Wir zeigten uns aber nur wenig beeindruckt davon und vermissten weiterhin unsere angestammten Papierchen von Rizla.
Die beiden Wochen vergingen wie im Fluge. Es war eine willkommene Abwechslung, die uns neue Sichtweisen eröffnete. Bevor wir uns aber versahen, bestiegen wir erneut eine VC10 und reisten zurück nach London. Wir spürten, dass sich die psychedelische Party von 1967 dem Ende zuneigte. Nun war schon der Januar 1968 angebrochen, und wir fühlten uns nur mäßig auf das vor uns liegende Jahr vorbereitet. Die Stimmung sollte schon bald kippen. Die Gigs wurden immer weniger, und die Band spaltete sich in zwei Lager auf. Junior und Twink vertraten jeweils einen gemeinsamen Standpunkt, wohingegen Keith und ich auf der anderen Seite standen. Es zog uns in unterschiedliche Richtungen.
Keith und ich freuten uns über die charmante Gesellschaft unserer Freunde, mit denen wir ein herrliches Loft in Cromwell Gardens unweit der Cromwell Road teilten. Wir verbrachten unsere Nächte in einem wunderbaren Nebel aus Musikmachen, Essen, Trinken und Rauchen. Gespräche ergaben sich zwanglos und verebbten, sobald der herannahende Morgen seine ersten Vorboten aussandte.
Unser Album Tomorrow erschien erst im Februar 1968. Doch da war der geeignete Zeitpunkt, um großen Eindruck zu hinterlassen, bereits verstrichen. Zur Jahresmitte 1968 spielten wir beim Festival im Donington Park. Es sollte eines unserer letzten Konzerte sein. Keith erfreute sich in der Welt der Popmusik immer größer werdender Berühmtheit, was sowohl positive als auch negative Konsequenzen mit sich brachte. Manchmal wurden wir als „Tomorrow featuring Keith West“ oder „Keith West & Tomorrow“ angekündigt. Doch in seiner Einstellung blieb er sehr wohl ein Teamspieler. Immerhin opferte er seine Solokarriere dafür, bei uns zu bleiben. Er wollte nicht bloß ein Popstar sein, nein, vielmehr wollte er der Sänger in einer Band sein. In Irland erwarteten sich die Fans aber „Keith West & Tomorrow“, und die Shows liefen alle ein bisschen aus dem Ruder. Sie wünschten sich die Art Song, die ihn berühmt gemacht hatte – nicht irgendwelchen abgefahrenen Psychedelic Rock. Das führte dazu, dass uns das Publikum mit Münzen bewarf. So spielten wir ein neues Arrangement von „Grocer Jack“, das so gar keinen Anklang fand. Jedenfalls wollten sie uns nicht mehr buchen.
Tomorrow verfügten über enormes Potenzial, aber mittlerweile wirkte die Band wie ein Zusammenschluss individueller Talente und nicht wie ein starkes Kollektiv. Mark Wirtz produzierte mehrere als Solo-Veröffentlichungen vorgesehene Songs, die Keiths Erfolg mit „Grocer Jack“ wiederholen sollten. So nahm ich etwa eine Nummer mit dem Titel „Moth Balls“ auf, die dann aber nicht erschien. Junior und Twink veröffentlichten unter der Aufsicht Marks als The Aquarian Age den Track „Ten Thousand Words in A Cardboard Box“. Gleichzeitig fabrizierten Keith und Mark noch die Nachfolge-Single zu „Grocer Jack“, die den Titel „Sam“ trug, aber hinter den Erwartungen zurückblieb.