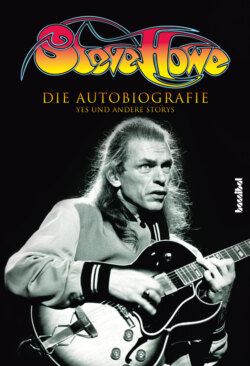Читать книгу Steve Howe - Die Autobiografie - Steve Howe - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 5
Unten am Fluss
Keith und mich verschlug es als Nächstes ins Grenzgebiet zwischen Highgate und Muswell Hill, wo mein Bruder Philip die beiden oberen Stockwerke eines Hauses bewohnte, von dem aus man auf Alexandra Palace hinabsehen konnte.
Im Dachboden dieser Bude begann ich, viel klassische Musik zu hören. Mithilfe der Schönheit eines ganzen Orchesters bekam ich so richtig den Kopf frei. Den Klängen von Vivaldi, Mozart, Villa-Lobos und Bach zu lauschen, schien meinen Sinnen neues Leben einzuhauchen. Damals wurde mir klar, dass wir niemals die Fähigkeiten und Power jener Musiker unterschätzen sollten, die die Werke dieser Komponisten zum Leben erweckten. Etwa Leute wie Ashkenazy, J.-P. Rampal, André Previn und John Williams. Auch verspürte ich die unbestrittene Genialität vieler großer Komponisten, die ihre Werke direkt auf Notenblättern zu ersinnen und zu orchestrieren verstanden. Sie konnten die komplizierten harmonischen Modulationen förmlich hören. In ihren Köpfen. Von Vivaldis Flötenkonzerten, von J.-P. Rampal gespielt, bis hin zu Rodrigos Concierto De Aranjuez, gespielt von John Williams, besaß diese Musik immenses Drama und Spannung. Ein solch subtiles Loslassen, welch entspannte Sanftheit! Das fesselte mich, damals wie heute. Dieses großartige musikalische Vermächtnis wird an passionierte Musiker weitergereicht, um es neu zu interpretieren und zu verfeinern. Ihr Verständnis revitalisiert die Lebenskraft dieser auf Papier festgehaltenen Musik und holt sie in die Gegenwart.
Wenn man noch weiter zurückgeht, etwa bis ins Mittelalter, wird offensichtlich, dass Musik seit jeher darauf abzielte, die Stimmung und Gefühle ihrer jeweiligen Epoche widerzuspiegeln. Julian Bream spielte nicht nur die Gitarre des 20. Jahrhunderts meisterhaft, sondern rückte auch die Laute erneut in den Mittelpunkt des Interesses, indem er die Musik und Lieder John Dowlands aus dem 16. Jahrhundert in sein Repertoire aufnahm. Sein Spiel strotzte nur so vor Emotion und Ausdruck. Er fühlte jede einzelne Note, die er spielte. A Life In Music ist eine wunderbare DVD-Dokumentation, die zeigt, dass Julian sogar Jazz gespielt hat. In den Siebzigerjahren besuchten Jan und ich viele seiner Aufritte in London. Nach einem Konzert, das er mit John Williams als Duo gespielt hatte, stellte uns dieser einander vor. (Wie schon Segovia gesagt hat, ist das Einzige, was noch besser ist als eine Gitarre, eben zwei Gitarren!) Julian wirkte, als wollte er gerade die Garderobe verlassen, und erinnerte uns mit seinem breitkrempigen Hut und seinem Mantel ein bisschen an Zorro. Zum Glück willigte er ein, John in seiner Wohnung in Hampstead zu besuchen, wo ich dann ein wenig ausführlicher mit ihm quatschen konnte. Er fragte mich, ob ich dieser Gitarrist sei, der mit drei Wagenladungen voll Ausrüstung durch die Lande ziehe. Ich musste bejahen – genau dieser Gitarrist war ich nämlich.
Rund um den Oktober 1968 begann Keith, Solo-Tracks für die EMI aufzunehmen, auf denen ich ihn begleitete. Bei manchen dieser Songs spielte Ronnie Wood Bassgitarre, und bei allen saß Aynsley Dunbar hinterm Schlagzeug. Bei „On A Saturday“ spielte ich Spanische Gitarre, und auf der B-Seite, „The Kid Was A Killer“, übernahm ich sowohl Bassgitarre als auch E-Gitarre. Auch auf seiner nächsten Single, dem Song „She“, war ich vertreten. Mark engagierte mich weiterhin für alle möglichen Sessions. Ich spielte auf einigen Tracks mit Caroline Munro und vielen deutschen Versionen von Popsongs, die ich aber nie wieder zu hören bekam.
Sessions zu spielen war in Ordnung. Dort traf ich viele Leute und keiner war irgendwie für den anderen verantwortlich. Drei Stunden später war dann alles vorbei, und es ging weiter zum nächsten Termin. In gewisser Hinsicht ähnelte es einer klassischen Tretmühle. Womöglich sah ich auch deshalb in den Sessions keinen bewusst gesetzten Karriereschritt. Ich lieferte ab und wurde bezahlt. (Ich hatte Glück und jemanden, der diese Sessions für mich buchte.) Allerdings erhielt ich keine Tantiemen und verließ mich stattdessen auf meine Gage, die die PPL (Phonographic Performance Limited) für mich eintrieb. Falls sich ein Song in großer Stückzahl verkaufte und/oder im Fernsehen oder Radio lief, bekam ich über die PPL einen geringen Betrag vermittelt. Mit Bands kannte ich mich am besten aus, und so beschloss ich, mich weiterhin darauf zu fokussieren.
Fürs Erste hielt ich mich weiter mit Sessions über Wasser, wodurch ich irgendwann an das Management von Deep Purple geriet. Sie sahen sich gerade nach einem Gitarristen um, um die Besetzung einer neuen Band, die sie zusammenstellten, zu komplettieren. Ich traf mich also mit Dave Curtis – seinerseits Sänger, Songwriter und Bassist – und seinem Drummer und Freund Bobby Woodman (Clarke), der zuvor für Johnny Hallyday getrommelt hatte. Wir nannten uns zunächst Canto und nahmen zusammen ein paar Demos auf, so etwa „The Spanish Song“, das man sich auf Anthology 2 anhören kann. Nachdem wir die Besetzung um einen jungen Typen namens Clive Skinner (Maldoon) erweitert hatten, benannten wir uns bald in Bodast um: Bobby-Dave-Steve. Nicht unbedingt ein Geniestreich, vor allem, weil dieses Konstrukt keinerlei Bezug auf Clive nahm.
Wir wohnten zusammen in einem Mietshaus in West Finchley und erhielten wöchentlich einen geringen Sold ausbezahlt. Dort schrieben wir unsere Songs und hofften, für Gigs gebucht zu werden. Das war eine in meinem Leben einmalige Situation. Wir waren hinsichtlich Management und Verlagsrechte vertraglich gebunden. Unser wöchentliches Einkommen entsprach einem Vorschuss – es konnte zurückgefordert werden, sobald tatsächlich mal Geld hereinkäme. So schrieben und probten wir unablässig neue Songs. Das war um die Zeit, als die Beatles ihr gefeiertes White Album veröffentlichten. Es ging nur zäh voran, aber zumindest lebte ich immer noch meinen Traum und konnte komponieren und spielen, was immer ich wollte. Außerdem klangen wir ziemlich gut.
Am Freitagabend erhielten wir regelmäßig Besuch eines Freundes samt interessantem Aktenköfferchen. Klick-klack! Vor uns breitete sich eine bunte Auswahl marokkanischen, afghanischen und indischen Haschs aus. Außerdem noch Kief, Thai-Sticks und afrikanisches Gras. Eine Unze Hasch kostete ungefähr acht Pfund. Viele sehr angesehene Leute konsumierten diese beruhigenden Substanzen. Offenbar waren sie schon fast allgegenwärtig, was so weit ging, dass sogar Polizisten Gefallen an ihnen fanden. Aber das alteingesessene britische Establishment setzte sich dennoch zur Wehr. In diesen Kreisen wusste man nicht, dass sich diese Szene nie kontrollieren lassen würde. Es ist weiterhin ein universelles Vergnügen, so wie Wein- oder Biertrinken. Erst seit Kurzem wird es weltweit immer häufiger freigegeben. Die Niederlande nahmen hier die Vorreiterrolle ein. Viele von uns besuchen gern die dortigen Coffeeshops. Mittlerweile haben auch die USA das Schleusentor geöffnet. Ein Bundesstaat nach dem anderem stimmt einer Legalisierung zu, wobei jeder einen eigenen Ansatz samt individueller Gesetzgebung verfolgt. Heute interessiere ich mich nicht mehr für Gras. Ich war hinsichtlich meines Geschmacks immer eher an Europa orientiert.
Bei Bodast überschnitten sich Musik und Lifestyle und die Liebe. Wir spielten letztendlich nur ein paar Gigs. Einer davon fand am 4. Juli 1969 in der Royal Albert Hall statt. Dabei handelte es sich um die einzigen Pop-Proms, von denen ich weiß. Am ersten Abend spielten The Who, und am zweiten trat dann Chuck Berry auf, der von Bodast begleitet wurde. Allerdings ohne mich. Ich erfuhr davon erst am Nachmittag während der Proben. Wir hatten bereits unseren Soundcheck hinter uns, als Chuck eintraf. Er betrat die Bühne und zeigte auf mich: „Dich brauchen wir nicht.“ Offenbar passte ich ihm nicht in den Kram. Unbeirrt zeigte ich ihm später hinter der Bühne meine Gibson 175, da mich interessierte, was er von ihr hielt. Er spielte sie an und meinte: „Yeah, das ist eine verdammt gute Gitarre!“ Nur noch ein einziger weiterer Gitarrist erhielt von mir die Erlaubnis, auf meiner allerbesten Gitarre zu spielen, nämlich der untadelige Martin Taylor, als wir 1998 gemeinsam Masterpiece Guitars aufnahmen.
Chuck Berry spielte bevorzugt halbakustische Gibsons mit schmalen Zargen wie die ES-340 T und später die ES-345 Stereo oder die ES-355. Als Verstärker mietete er sich zwei Fender Showmans oder Fender Twins, die er auf der Bühne zusammenschloss. In meinen Anfangstagen hörte ich Chuck fast auf Endlosschleife. Er war der erste Sänger, Instrumentalist und Songwriter in einem, der in den Fünfzigerjahren seine eigenen Hits feiern konnte. Außerdem war er die Hauptattraktion der ersten Package-Show, die ich jemals sah. Neben ihm standen auch noch Carl Perkins und die Animals auf dem Programm jenes Konzerts, das im Lewisham-Theater in London über die Bühne ging. (1980 sollten auch Yes in der Besetzung unseres Albums Drama dort auftreten.)
Das Jahr 1969 sollte eine völlig neue Phase in meinem Leben einläuten. Immerhin brachte meine erste Frau, Pat Stebbings, unseren Sohn Dylan zur Welt. Das Thema Familie rückte somit ins Zentrum meines Fokus. Ich konnte nicht länger egoistisch oder kurzsichtig an Dinge herangehen. Für meine Familie zu sorgen war fortan mein größter Antrieb. Obwohl unsere Ehe letzten Endes in die Brüche gehen sollte, mangelte es Dylan nie an Liebe oder Aufmerksamkeit. Ab 1971 fiel mir die Verpflichtung zu, ihn großzuziehen. Nicht viele Männer erhalten diese Gelegenheit. Ich wäre auch nie in der Lage gewesen, diese Aufgabe erfolgreich zu meistern, wenn mir nicht Jan Osborne beigestanden wäre, die ich 1975 schließlich heiratete. Sie ermöglichte, dass diese delikate Gratwanderung klappte. Liebe löst sehr viele Dinge auf einmal aus. So verändern sich etwa Perspektiven – und es gibt so viel, das es zu lernen gibt in der Kindererziehung. Ich kann mich noch genau an ein rotes Tretauto erinnern, das wir Dylan 1971 zu seinem zweiten Geburtstag schenkten, nachdem er von einem Urlaub mit Jan und ihrer Familie auf Malta zurückkehrte. Er war ja so begeistert und machte damit den Innenhof unseres Wohnhauses unsicher. Jan brachte später unsere drei gemeinsamen Kinder zur Welt: Virgil 1975 (er verstarb tragischerweise 2017), Georgia 1982 und Stephanie 1986. Von 1971 an war Jan der wichtigste Mensch auf der Welt für mich.
Bodast lebten weiterhin de facto von der Hand in den Mund, obwohl wir bereits ein Album in den Trident Studios mit Toningenieur Ken Scott für eine Plattenfirma namens Tetragrammaton aufgenommen hatten, das Keith West als Produzent betreute. Leider schloss das Label seine britische Niederlassung, und die Platte wurde nie veröffentlicht. Das Gefühl der Zurückweisung, das uns an den Fersen zu haften schien, unterminierte unsere ganze Mission. Die Aufnahmen sollten acht Jahre lang unter Verschluss bleiben, bis unser wunderbarer Sänger Clive Skinner, der außerdem ein guter Songwriter war, 1978 Schlaftabletten zum Opfer fiel. Er hatte vergessen, dass er sie genommen hatte, bevor er zusätzlich dazu noch Alkohol konsumierte. Obwohl er sich vielleicht auch vernachlässigt und nicht ausreichend geschätzt gefühlt hat und deshalb auf die Idee gekommen war, beides zu kombinieren. Als ich von seinem Tod erfuhr, war ich gerade auf US-Tour. Daraufhin war ich motiviert, diese Aufnahmen noch einmal in Stereo abzumischen. Ich bat Gary Lanham, mir dabei als Engineer beizustehen. Wir hatten ein Budget für einen Tag und stellten alle acht Tracks fertig. Cherry Red veröffentlichte das Ergebnis unter dem Titel The Lost Bodast Tapes 1978 auf Vinyl. Später erschienen die Aufnahmen auch noch auf CD, sowohl im Stereo- als auch im ursprünglichen Mono-Mix. 2017 wurde zudem eine neu gemasterte Version namens Towards Utopia aufgelegt, die ich persönlich für die beste Fassung halte.
Wenn ich über all meine Bemühungen in früheren Bands nachsinnierte, empfand ich diese Zeit als eine Art Ausbildungsphase. Mittlerweile wurde jedoch klar, dass unser Auskommen von einer eigenartigen psychologischen Balance abhing. Musikalisch dazu beizusteuern, verlieh dir ein gewisses nicht näher definiertes Ausmaß an Kontrolle. Es trugen noch viele andere Dinge zu dieser Balance bei, aber Kontrolle war ein ganz grundlegendes Thema. Selbstsicherheit musste nicht unbedingt gleichbedeutend sein mit Arroganz. Ich lernte, mit Kritik umzugehen sowie auch die Ideen anderer einfühlsam zu kritisieren, um zur Verbesserung der Band beizutragen. Ich hatte mich an die gegenseitige Abhängigkeit voneinander gewöhnt, die sich daraus ergab, dass wir zusammenlebten. Wie in einer Kommune. Und doch verließen wir Finchley schlussendlich im Unguten. Deep Purples Management feuerte uns nämlich, nachdem ein bescheuerter Toningenieur in den Kingsway Studios behauptet hatte, er habe uns beobachtet, wie wir Heroin konsumiert hätten. Um Himmels willen, auf keinen Fall! Wir versicherten ihnen, dass dies nicht der Wahrheit entspreche. Aber sie setzten uns trotzdem auf die Straße – direkt vor Weihnachten.
Wir zogen daraufhin weiter in ein Haus in der Lots Road in Fulham. Vor uns hatte dort die Band Family gewohnt, die sämtliche Wände schwarz angestrichen hatte. Dort erwarteten mich weitere extreme Aha-Erlebnisse. Ein weiterer Mitbewohner war nämlich niemand Geringerer als dieser komische Kauz und Rock’n’Roll-Pionier Vince Taylor. Er verließ kaum einmal sein Zimmer, und wenn, dann suchte er nur schnell die Küche auf. Wir hatten keine Ahnung, was er sonst so trieb! Die Leute gingen ein und aus, zogen ein und aus, übernachteten und tauchten dann irgendwann mit neugeborenen Kindern auf. Es war eine draufgängerische, gleichzeitig überaus bodenständige Art zu leben, die zu vielen bizarren Vorkommnissen führte. Leute flippten aus und liefen im Drogen- oder Alkoholrausch Amok. Wir aßen Unmengen Reis, Zwiebeln und Tunfisch. So sah unser Speiseplan aus.
Da wir davon ausgingen, dass unsere Aufnahmen für immer auf Eis lägen, verwendete ich die von mir geschriebenen Passagen aus dem Song „The Ghost Of Nether Street“ für die Yes-Nummer „Starship Trooper“, wo ich sie für „Würm“ einsetzte. Ich behielt dafür die Akkorde G, Es und C bei, modifizierte aber den Basslauf ein wenig. Auch den Auftakt des Gitarren-Breaks übernahm ich, nachdem Yes die Struktur immer weiter aufgeschichtet hatten. Riffs aus „South Side Of The Sky“ stammten ursprünglich aus „Tired Towers“, „Close To The Edge“ enthielt einen Part aus „Black Leather Gloves“. Die Strophen des Asia-Songs „One Step Closer“ basierten auf der Schlusspassage von „Come Over Stranger“. Meine Strukturen und Melodien funktionierten offenbar in unterschiedlichen stilistischen Kontexten.
Dann verließ ich Bodast. Doch zuvor erlebte ich noch eine weitere Riesenenttäuschung. Wir wurden von einer amerikanischen Produktionsfirma kontaktiert, wo man glaubte, wir wären wie geschaffen für einen Film über den Aufstieg und Fall einer unbekannten Band. Sie sahen, dass wir uns abmühten, über die Runden zu kommen, aber sie glaubten auch daran, dass wir es schaffen konnten. Und zwar im großen Stil. Deshalb planten sie, uns auf 35-Millimeter-Film zu bannen. Es hieß, sie würden sich innerhalb von drei Wochen bei uns mit einem Vertrag (also mit Kohle) melden. Doch nichts geschah, und sie wiesen unsere Versuche ab, mit ihnen in Kontakt zu treten.
Ich hatte die Nase gestrichen voll. Immerhin hatte ich noch Anfang des Jahres Angebote von funktionierenden Bands, die regelmäßig auftraten, abgelehnt. Dazu zählten etwa The Nice mit Keith Emerson, die man einfach gesehen haben musste. Keiths Spiel war schlichtweg unfassbar. Nachdem Davy O’List ihnen den Rücken kehrte, sahen sie sich nach einem neuen Gitarristen um. Jener Nachmittag, an dem ich bei ihnen vorspielte, ist mir bis heute noch in guter Erinnerung geblieben. Wir versuchten uns an ein paar ihrer Nummern, während Keith und ich uns parallel dazu darüber unterhielten, was wir musikalisch bewerkstelligen könnten, da wir beide die Musik Antonio Vivaldis liebten. Später schrieb ich für mein erstes Soloalbum „The Nature Of The Sea“, das von Vivaldis Flöten-Concerto La Tempesta Di Mare inspiriert war. Es schien vorherbestimmt zu sein, dass wir gemeinsame Sache machen sollten. Ich sagte ihnen also zu, und wir begaben uns in einen Pub, wo ich auch ihren Manager traf. Dieser zog Geld aus seiner Tasche und verteilte es unter den Bandmitgliedern. Das wirkte eine wenig unprofessionell.
Als ich ins Haus in der Nether Street in Finchley zurückkehrte, erklärte ich den Jungs, dass ich aussteigen wolle. Sie zeigten sich wenig erfreut. Die Band würde sich auflösen, wir würden unser Dach über dem Kopf und unser Einkommen verlieren. Bald schon säßen sie alle auf der Straße. Am nächsten Morgen hatte ich meine Meinung wieder geändert, in erster Linie, weil ich den Rest von Bodast nicht im Stich lassen wollte. Außerdem misstraute ich der Vorgehensweise des Managements von The Nice. So traf man keine guten Entscheidungen für seine Karriere. Schließlich muss man ein bisschen nachhaltiger denken.
Ich spielte außerdem noch bei Atomic Rooster vor. Musikalisch kamen wir auf keinen grünen Zweig, und ich war nicht allzu heiß auf den Job. Damals trommelte Carl Palmer bei ihnen. Aber als wir später gemeinsam bei Asia spielten, meinte er, er könne sich gar nicht daran erinnern, dass ich je vorgespielt hätte. Darüber hinaus erhielt ich auch einen Anruf von Jethro Tull, nachdem Mick Abrahams bei ihnen ausgestiegen war. Allerdings bestanden sie darauf, dass ich als Songwriter nichts beisteuern solle. Sie brauchten mich ausschließlich als Gitarristen, was bei mir die Alarmglocken schrillen ließ. Ich benötigte einen Neuanfang mit einer neuen Band und wollte das Wesen des Sounds mitgestalten dürfen.
Nachdem ich eine sehr trostlose Phase durchlebt hatte, bei der nur so wenig für mich herausgeschaut hatte, musste ich also mein Interesse an einer neuen Aufgabe als Gitarrist lancieren. Ende 1969 rief mich dann Jim Morris an, der Ehemann und Manager der Sängerin P. P. Arnold. Er frage, ob ich mir vorstellen könne, Pat zusammen mit dem hervorragenden Trio Ashton, Gardner & Dyke, das für seinen Orgel-Sound bekannt war, auf Tour zu begleiten. Sie sollten mit Delaney & Bonnie (mit Eric Clapton!) auf eine einmonatige Konzertreise durch Europa gehen. Natürlich zeigte ich mich von dieser Idee sehr angetan. Es sollte eine Art Aufwärmprogramm für 1971 werden, in der Yes als Anheizer für Iron Butterfly auf Tournee gingen. Diese Tour stellte einen großen Schritt vorwärts dar und war eine rundum gute Erfahrung.
Wir probten eine Weile mit Pat und begaben uns dann in die Londoner Konzert-Location Lyceum, wo Delaney & Bonnie gemeinsam mit Eric C. ihre finalen Proben absolvierten. Als Delaney & Bonnie loslegten, waren wir alle wie weggeblasen. Der mächtige Sound dieser Besetzung war ein einmaliges Erlebnis: Es war ehrfurchtsgebietend und aufregend. Jimmy Miller hielt diesen Sound auch hervorragend auf einer Platte fest, die eine schöne Erinnerung an diese Tour darstellt. Ich kenne jeden einzelnen Ton, jede Note sämtlicher Songs dieser Live-LP!
Die Tour startete mit einem Abstecher zu George Harrisons Haus. Wir holten ihn mit dem Bus ab, da er sich bereiterklärt hatte, die erste Woche der Tournee mitzuspielen. Dave Mason war auch mit dabei, blieb aber bis ganz zum Schluss. Jeden Abend rockten sie die Konzerthallen! In der Fairfield Hall in Croydon schaffte es der DJ nicht mehr rechtzeitig auf die Bühne, um die Band vorzustellen, weshalb ich für ihn einsprang. Die einleitende Musik verebbte, und ich musste ankündigen, wer nun welches Instrument spielen würde! Das war schon ein bisschen beängstigend, half mir aber auch dabei, mein Selbstvertrauen aufzubauen.
Ich bereue immer noch, die Einladung ausgeschlagen zu haben, mich Delaney & Bonnie samt Eric auf der Bühne anzuschließen. Dafür war ich aber wohl ein wenig zu schüchtern. Ich hatte das Gefühl, dass mit Eric, George, Dave und mir einfach zu viele Gitarristen spielen würden. Eine verpasste Gelegenheit! Eines Tages sagte Eric zu mir im Tourbus, dass wir beide, obwohl im Sternzeichen Widder geboren, uns als Typen sehr stark voneinander unterscheiden würden.
Ich bewunderte so viele Dinge an Eric. Allein schon wegen dieser Tour. Aber auch alles, was er für die Musik geleistet hat, sowie die Hilfe, die er einigen seiner Mitmenschen angedeihen ließ. Er war immer sehr großzügig und bedacht. Vor der Tour besuchte ich ihn einmal in seinem Apartment im Zentrum Londons. Er fragte mich, ob ich „Classical Gas“ von Mason Williams spielen könne. Ich präsentierte es ihm daraufhin, was ihn zu freuen schien. Ein anderes Mal spielte gerade Albert Lee in seiner Begleitband, als wir zufällig im selben Chicagoer Hotel abgestiegen waren. Ich hing mit Albert etwa eine halbe Stunde in Erics Zimmer ab. Wir schoben eine unverbindliche Jamsession ein, bevor wir dafür zu müde waren und dann noch eine abschließende Partie Pool am hoteleigenen Tisch spielten.
Die Tour mit Delaney & Bonnie führte uns auch nach Skandinavien und quer durchs restliche Europa. Das war von Anfang bis Ende eine fabelhafte Erfahrung. Allein schon jeden Abend ihrer wundervollen Musik lauschen zu können! Damals hatte ich bereits „Clap“ geschrieben, und ich bin mir sicher, dass ich es eines Abends während Pats Auftritt anspielte. Die Tour dauerte den ganzen Dezember und war meine erste Berührung mit der Oberliga der Musikwelt. Wann sonst hätte ich jemals George Harrison dabei beobachten können, wie er in der Garderobe auf seiner Akustikgitarre herumzupfte und dazu „Here Comes The Sun“ sang? Einfach unvergesslich! Auch hörte ich, wie George im Foyer eines Hotels in Manchester ein Interview gab. Er sprudelte nahezu über vor lauter Witz. Wie lustig er doch war! Ein echter Charmebolzen. Wir unterhielten uns oft über Gitarren. Er besaß eine Spezialanfertigung von Gibson, die er für nicht ganz gelungen hielt. Sie hatten seine Vorgaben offenbar falsch interpretiert. Solche Spezialanfertigungen von Gibson galten damals als besondere Rarität. In Großbritannien gierte man damals schon längst nach Modellen von hoher Qualität. Wir mussten aber stattdessen mit europäischen Herstellern Vorlieb nehmen. Eine der ersten Abbildungen einer Fender Stratocaster in Großbritannien fand sich auf dem Plattencover von The „Chirping“ Crickets, wo Buddy Holly diese vielleicht bekannteste und am häufigsten gespielte Gitarre der Welt hochhält. Dieses Foto, auf dem eines von Hollys Bandmitgliedern eine Gibson ES-225T präsentiert, ließ damals so manchem Gitarristen das Wasser im Munde zusammenlaufen. Unsere Begeisterung fußte auf dem Verlangen, diese herrlichen US-Gitarren, die dereinst Klassiker sein würden, nicht nur zu sehen, sondern sogar spielen zu dürfen. Ich sammelte etwa Gitarrenkataloge, um einfach nur die verschiedenen Formen und Farben zu begutachten, während ich mir gleichzeitig ausmalte, welch exquisite Klänge sie zu erzeugen imstande wären. Vor allem, wenn sie über ein Copicat-Echogerät von Watkins und einen Vox-Verstärker gespielt würden!
Während die Sechzigerjahre voranschritten, beobachtete ich, wie Gitarristen für gewisse Songs die Gitarren wechselten, oftmals zwischen Fender Telecaster und Gibson ES-335. Ihre jeweiligen Klangfarben weichen stark voneinander ab, womit sie die Musik in jeweils eigene Richtungen lenken. Der schlanke, eisige Ton der Telecaster unterschied sich eklatant vom bauchigen, tieferen Klang der 335. Auch ihre Bauarten standen im klaren Kontrast zueinander.
Oft sage ich, dass ich erst, wenn ich mich auf die Bühne begeben würde, wirklich begriffe, dass ich ein Gitarrist sei. Wenn ich dort stehe, um zu spielen, kann mich nichts mehr bremsen: Es ist dann der Zeitpunkt gekommen, Musik zu machen. Sämtlicher Ballast bleibt hinter der Bühne zurück. Auf ihrer Platte von 1957, Sing A Song Of Basie, singt das Gesangstrio Lambert, Hendricks & Ross eine Vielzahl von Lyrics aus der Feder von Jon Hendricks zu einem Dutzend Songs von Count Basie. Einer davon war Basies „Blues Backstage“. Daran muss ich oft denken. Es handelt von einem Typen, dessen Freundin ihn gerade abserviert hat. Direkt vor dem Konzert! Aber die Show muss weitergehen, nicht wahr? Doch innerlich brodelt es, er muss seine Gefühle verbergen. Auch wenn es manchmal schwerfällt, wenn es einem gerade nicht so gut geht, muss man doch durchhalten und sein Ding durchziehen. Ich habe das nur allzu oft selbst miterlebt. Es war meine Schwester Stella, die mir diese Platte geschenkt hat. Sie steckt voller Dynamik und Schwung. Das lag auch daran, dass man hier klugerweise auf Basies eigene Rhythmuscombo, bestehend aus Nat Piece am Klavier, Freddie Greene an der Gitarre und Eddie Jones am Schlagzeug, zurückgriff. Ein weiterer phänomenaler Song auf dieser Platte heißt „Pony Ride“, der in einen Gesangs-Breakdown mündet, in dem sie scatten: „Get a record that’ll play a week … Good bebop good be … What a wonderful pony ride.“ Sie schufen mehrspurig aufgenommene Harmonien, die jene, welche Les Paul mit Mary Ford produzierte, noch übertrafen.
Ich muss betonen, dass die Stimme das wunderbarste Instrument ist, das wir haben. Jeder hat dazu seine Meinung, aber ihre Erhabenheit ist schlichtweg nicht zu leugnen. Die ersten Geräusche – Gespräche und Gesang – vernehmen wir noch im Bauch der Mutter. Als Neugeborenes, noch bevor wir wirklich sehen können, sind es Geräusche, die uns mit der Welt verbinden. Diese Laute bilden einen Übergang zur Sprache, und das gesprochene Wort orientiert sich an unterschiedlichen Tonlagen – je weiter östlich man auf der Welt geht, desto mehr trifft dies zu. Wenn man sich etwa eine Phrase immer wieder anhört, wird das immer offensichtlicher. Aufsteigende Aussagen treffen auf absteigende Aussagen. Unterbewusst erkennen wir so die Stimmung, in der sich der Sprecher befindet. Akzente bieten innerhalb der Sprache eine herrliche Variation. In Großbritannien können wir die Heimatstadt anhand des Akzents eines Sprechers erkennen. Dieses Phänomen lässt sich jedoch auf der ganzen Welt beobachten. Wir sind in der Lage, nationale und lokale Akzente zu erkennen.
Hoffentlich seid ihr größere Sprachtalente als ich, der nur seine Muttersprache beherrscht. Aber das Singen ist ein Genuss, den jeder Mensch auskosten kann und sollte. Ich lernte in den Siebzigerjahren bei Gigs und Studioterminen so einiges über Gesang. Zuvor hatte ich kaum einmal öffentlich gesungen. Tatsächlich nahm ich aber erst ab 1993 Gesangsunterricht – und zwar bei Tona DeBrett, die viele großartige Sangeskünstler in ihrem Zuhause im Norden Londons unterrichtete. Auf diese Weise bereitete ich mich seinerzeit auf mein viertes Soloalbum vor, das den Titel The Grand Scheme Of Things tragen sollte. Bei Yes sang ich in erster Linie die tiefe Stimme. Was anderes kann ich ja gar nicht, da mein Organ eben eher sonor klingt! Das war aber gut, wenn ich Jon und Chris unterstützen sollte, da sie beide hoch sangen. Dies verlieh uns einen eigenen Sound.
Ende der Sechzigerjahre war es ein weiterer Lernprozess, Ideen für die Gitarre niederzuschreiben und mithilfe verschiedener Tonbandsysteme aufzunehmen. Mein Bruder John besaß ein frühes Aufnahmegerät für zu Hause, einen Mono-Rekorder von Grundig, den er regelmäßig aufbaute, um damit die Radio-Popshow der BBC, den Saturday Club, aufzunehmen. John schnitt mit, als die Shadows „Apache“ aufnahmen, noch bevor ich mir die Single kaufen konnte. Wie lebendig das doch im Vergleich zur offiziellen Veröffentlichung klang!
Zu Hause versuchte ich mich nun an einem zweispurigen Apparat von Telefunken, der eine einigermaßen komplexe Funktionsweise aufwies. So musste das Tonband zwischen den Spulen einen ziemlich umständlichen Weg zurücklegen. Außerdem war das Gerät auf Deutsch beschriftet, was die Sache auch nicht gerade erleichterte. Etwas später kamen die ersten Kassettenabspielgeräte auf den Markt, und schon bald darauf folgten Apparate, die es erlaubten, dieses Medium für eigene Aufnahmen zu nutzen. Letztendlich erschien auch eine tragbare, mit Batterien betriebene Version, die darüber hinaus noch über ein eingebautes Mikrofon verfügte. Ich besaß eine Version, die es mir erlaubte, die Geschwindigkeit des Tonbands zu manipulieren. Das war insofern hilfreich, da Kassettenrekorder praktisch nie die richtige Geschwindigkeit halten konnten. So aber vermochte ich selbst nachzujustieren. Noch lange bevor es digitale Stimmgeräte gab, verwendeten wir Stimmgabeln, um unsere Instrumente zu stimmen. Oder Klaviere und Orgeln – falls diese wiederum gestimmt waren!
Dank dieser Hilfsmittel konnte ich eine Idee festhalten, sie überdenken und eventuell später noch einmal neu arrangieren, wenn mir das gefiel. Da ich Musik nicht auf konventionelle Art und Weise notieren oder lesen konnte, stellte dies die Methode dar, mit der ich mir diesbezüglich zu helfen wusste. Noch heute besitze ich eine enorme Sammlung solcher Kassetten, die ich zu Hause oder auf Tour bespielt habe. Wenn man zusammen mit anderen Leuten komponierte, füllte das etliche Kassettenseiten. In der Regel sind sie mit den Namen der jeweiligen Städte beschriftet, in denen sie entstanden. Oft hört man darauf, wie ich entweder mit Jon Anderson oder allein in irgendeinem Hotelzimmer auf der Gitarre herumklimpere. Später gab es dann noch winzige Mini-Kassetten, mithilfe derer man einfach viel zu viel Musik aufnehmen konnte. Es wurde schlichtweg zu kompliziert, den Überblick zu bewahren. Man konnte die Dinge sogar rückwärts abspielen!
Über viele Jahre hinweg sammelte ich so meine Ideen, wodurch ein Archiv entstand, aus dem ich mich bei Bedarf bedienen kann. Damals war alles noch so primitiv, dass man gar keinen wirklichen Referenzrahmen hatte. Die Dinge konnten nur besser werden. Man könnte ja so viel über die Geschichte und Entwicklung der Aufnahmetechnologie berichten. Sowohl das Guinness-Buch der Rekorde als auch Perfecting Sound Forever von Greg Milner informieren einen gut über die Frühzeit dieser Prozesse. Damals war analoge Technik noch das Maß aller Dinge. Glühende Röhren und Lötverbindungen. Kabel, so weit das Auge reichte. Transformer und zahlreiche andere Boxen, die jeweils eine einzige Aufgabe erfüllten. Dies war die Ära, in der Verzerrung und Summen von vornherein immer da waren – und doch entstanden so viele unfassbar gut Aufnahmen, mithilfe nur weniger Spuren und ein paar Tricksereien seitens des Studiotechnikers.
Der physische Akt, Tonbänder zwischen einzelnen Takes oder der Arbeit eines ganzen Tages zurechtzuschneiden, war eine altehrwürdige Tradition. Der Engineer brauchte dafür Unmengen von Rasierklingen, Tesafilm, Schneidblöcke und Markierstiften. Ein kleiner Fehler konnte verheerende Folgen nach sich ziehen. Heute werden digitale Editiertechniken bei praktisch allem, was wir zu hören bekommen, zum Einsatz gebracht. Heute wollen wir, dass alles genau im Takt und exakt gestimmt ist. Wir sind in der Lage, nach Lust und Laune herumzutüfteln – noch lange, nachdem alles im Kasten ist. Das nennt sich Post-Production. Zum Glück können wir praktisch alles mit unserer Musik bewerkstelligen, was uns gefällt. Die Pro-Tools-Aufnahmetechnologie hat sich zum Standard entwickelt, bei der mithilfe von sogenannten Plug-ins Tonhöhe und Takt extrem präzise angepasst, einzelne Wörter an die passende Stelle verschoben und auch sonst jede vorstellbare Mix-Option eingesetzt werden kann. Wenn man sich etwas nur vorstellen kann, lässt es sich auch bewerkstelligen. Obwohl man sich dabei mitunter auch im Kreis bewegt …
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich gut sechs Jahre damit verbracht, Konzerte in Großbritannien und Europa zu spielen. Außerdem hatte ich zwei Alben aufgenommen, wovon eines auch veröffentlicht worden war. Darüber hinaus wirkte ich bei ziemlich vielen Sessions mit. Nun war ich bereit, weitere Schritte zu unternehmen, um ein berühmter Gitarrist zu werden. Ich hoffte und glaubte daran, dass da noch etwas ginge – immerhin hatte sich während meiner gesamten bisherigen Karriere ein Muster herauskristallisiert: Nachdem ich aus einer Band ausgeschieden war, dauerte es nie länger als ungefähr zwei Monate, bis ich mich einer neuen anschloss. Irgendetwas würde sich schon ergeben, und ich würde schon bald wieder spielen.