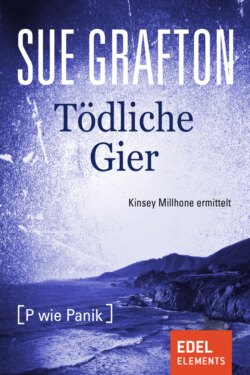Читать книгу Tödliche Gier - Sue Grafton - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеAm Samstagmorgen schlug ich ganz automatisch eine Minute vor sechs die Augen auf. Ich blickte zum Oberlicht hinauf, das mit Regentropfen gesprenkelt war. Über die ganze Plexiglaskuppel verteilten sich winzige Lichtperlen. Die Luft, die zum Schlafzimmerfenster hereinkam, roch nach modrigem Laub, nassen Gehsteigen und den tropfenden Eukalyptusbäumen, die die nächste Straße säumten. Eigentlich ist der Geruch von Eukalyptus vom Geruch von Katzenspray fast nicht zu unterscheiden, aber daran wollte ich nicht denken. Ich stopfte mir das Kissen unter den Kopf und genoss das sichere Wissen, dass ich nicht aus dem Bett steigen und joggen gehen musste. So pflichtbewusst ich auch in puncto Sport bin – es gibt doch nichts Herrlicheres, als auszuschlafen. Ich vergrub mich unter der Decke und ignorierte die Welt, bis ich schließlich um halb neun zum Luftholen herauskam.
Als ich geduscht und mich angezogen hatte, machte ich mir eine Kanne Kaffee und verdrückte eine Schüssel Frühstücksflocken, während ich die Morgenzeitung las. Ich bezog das Bett frisch, steckte eine Ladung Wäsche in die Maschine und räumte die Wohnung ein bisschen auf. Als ich ein Kind war, hatte meine Tante Gin darauf bestanden, dass ich samstags mein Zimmer aufräumte, bevor ich zum Spielen nach draußen ging. Da wir in einem Wohnwagen lebten, war das kein großer Aufwand, doch die Gewohnheit hat sich gehalten. Ich staubte ab, saugte und schrubbte Kloschüsseln – geistlose Arbeiten, bei denen ich gut nachdenken konnte. Abwechselnd malte ich mir in verschiedenen Varianten aus, wie ich die Möbel in meinem neuen Büro stellen könnte, und überlegte, wen ich auf meiner Suche nach Purcell als Nächsten befragen sollte. Da Fionas fünfzehnhundert Dollar nun sicher auf meinem Konto lagen, fühlte ich mich verpflichtet, das Wochenende über weiter zu ermitteln. Ich widerstand der Versuchung, nach erst einem Tag Arbeit schon eine Theorie aufzustellen, aber wenn man mich gezwungen hätte, Wetten abzuschließen, hätte ich mein Geld darauf gesetzt, dass Purcell tot war. Nach allem, was ich von ihm gehört hatte, konnte ich mir nicht vorstellen, dass er sich ohne ein Wort zu seiner Frau oder seinem Söhnchen aus dem Staub machen würde. Das erklärte zwar weder den fehlenden Pass noch die fehlenden dreißigtausend, aber beides konnte ja in nächster Zeit noch auftauchen. Derzeit bestand jedenfalls kein Grund zu der Annahme, dass sie etwas mit seinem Verschwinden zu tun hatten.
Um elf holte ich das Telefonbuch hervor, schlug die Gelben Seiten auf und suchte nach der Spalte mit den Pflegeheimen. Nach meiner Zählung gab es etwa zwanzig. Viele leisteten sich große, gerahmte Anzeigen, in denen die Annehmlichkeiten gepriesen wurden:
UMFASSENDE REHA- UND LANGZEITPFLEGE ...
GROSSZÜGIGE ZIMMER IN RUHIGER UMGEBUNG ...
ELEGANTER BAU MIT GESCHMACKVOLLER EINRICHTUNG
... SCHÖNES, NEUES HAUS MIT GESICHERTER
GARTENANLAGE ...
Zu manchen gehörten gezeichnete Pläne, auf denen Pfeile das großartige Anwesen erläuterten, als wäre es wünschenswert, seinen Verfall in einer der besseren Wohnlagen Santa Teresas zu erleben. Die meisten Häuser hatten Namen, die vermuten ließen, dass ihre Bewohner sich weiß Gott wo sahen, aber jedenfalls nicht dort, wo sie tatsächlich waren: Cedar Creek Estates, Green Briar Villas, Horizon View, Rolling Hills, The Gardens. Sicher hielt niemand für möglich, dass man in so poetisch benannten Häusern schwach und ängstlich, verlassen, behindert, einsam, krank oder inkontinent sein könnte.
Pacific Meadows, das Pflegeheim, das Dow Purcell leitete, bot qualifizierte Pflege rund um die Uhr und konnte mit einer Kapelle und seelsorgerischem Beistand direkt auf dem Gelände aufwarten, was sicher recht hilfreich war. Außerdem war es von Medicare und Medicaid anerkannt, womit es einen entscheidenden Vorteil gegenüber manchen seiner privat abrechnenden Konkurrenten besaß. Ich beschloss, mir das Haus selbst einmal anzusehen. Das reguläre Personal würde am Wochenende vermutlich nicht da sein, was sich als günstig erweisen könnte. Vielleicht waren all die von der kleinlichen, übereifrigen Sorte zu Hause und machten genau wie ich die Wäsche.
Ich steckte ein frisches Päckchen Karteikarten in die Handtasche, schlüpfte in ein Paar Stiefel und schnappte mir meinen gelben Regenmantel und einen Schirm. Dann sperrte ich hinter mir die Tür ab und huschte zwischen den Pfützen hindurch zu meinem am Straßenrand geparkten Auto. Ich stieg an der Fahrerseite ein und erschauerte unwillkürlich vor Kälte. Der Regen hatte nach der frühmorgendlichen Pause stark zugenommen und prasselte jetzt mit dem Stakkatogeklapper fallender Nägel auf mein Wagendach. Ich ließ den Motor an und fuhr langsam los, während die Scheibenwischer majestätisch winkten.
Als ich auf den Parkplatz von Pacific Meadows fuhr, war der Himmel dunkel von Wolken, und die erleuchteten Fenster ließen das Haus heimelig und warm erscheinen. Ich wählte eine Lücke in der Nähe des Eingangs, die einem Angestellten zugeordnet gewesen war, dessen Namen man durchgestrichen hatte; schwarz auf schwarz und unmöglich zu entziffern. Ich machte den Motor aus und wartete, bis der Regenschauer nachließ, bevor ich ausstieg. Aber trotzdem musste ich auf dem halb unter Wasser stehenden Asphalt aufpassen, dass ich nicht mitten in einer Pfütze landete. Im Schutz des Haupteingangs schüttelte ich meinen Schirm aus und klopfte kurz den Regenmantel ab, bevor ich durch die Tür trat. Tropfende Regenmäntel und breitkrempige wasserdichte Hüte hingen von einer Reihe Haken. Ich hängte meinen Mantel dazu und lehnte den Schirm in die Ecke, während ich mich orientierte.
In dem breiten Flur vor mir saßen sechs ältere Leute in Rollstühlen, wie schlaffe Topfpflanzen an der Wand aufgestellt. Manche schliefen fest, während andere infolge sensorischer Deprivation dahinzudämmern schienen. Zwei waren angegurtet. Ihre Haltung war von Osteoporose gezeichnet, die ihre Knochen von innen zermürbte. Eine sehr magere Frau mit langen weißen Gliedern ließ gequält ein knochiges Bein über den Arm des Rollstuhls baumeln und bewegte sich hektisch, wie von Schmerzen getrieben.
Am anderen Ende des Flurs stapelten zwei Frauen in grünen Uniformen Bettlaken auf einen Wäschewagen, der bereits voller Schmutzwäsche war. Es roch merkwürdig – nicht direkt »schlecht«, sondern irgendwie fremdartig, eine Mischung aus gelösten Aromen – grüne Bohnen aus der Dose, Klebefilm, heißes Metall, Äthanol, Waschmittel. Keines der einzelnen Elemente war an sich ekelhaft, aber die Kombination wirkte verdorben – Parfum des Lebens, das sauer geworden war.
Zu meiner Rechten standen Gehhilfen aus Aluminium ineinander verkeilt wie Einkaufswagen vor einem Supermarkt. Das Tagesmenü hing hinter Glas an der Wand wie ein ausgestelltes Gemälde. Das samstägliche Mittagessen bestand aus Hühnchenfrikadelle, Sahnemais, Kopfsalat mit Tomate, Früchtebecher und einem Haferkeks. In meiner Welt hätten der Kopfsalat und die Tomate als Garnitur gegolten, ein dekoratives Element, das der Essende ignorierte und auf dem Teller zurückließ, damit es in den Müll geworfen wurde. Hier erhielten Salat und Tomate so viel Bedeutung, als gehörten sie zu einer üppigen und nahrhaften Schlemmerei. Ich dachte an Pommes und einen Hamburger Royal und wäre fast aus dem Heim geflüchtet.
Glastüren führten in den Speisesaal, wo ich die Bewohner beim Essen sitzen sehen konnte. Schon beim ersten kurzen Blick fiel mir auf, dass es dreimal so viele Frauen wie Männer waren. Manche trugen Straßenkleidung, aber die meisten steckten doch in Bademänteln und Hausschuhen. Sie waren nicht direkt bettlägerig, aber infolge ihres Gesundheitszustands eingeschränkt. Viele wandten sich um, um mich anzustarren, nicht unhöflich, sondern mit einem rührenden Anflug von Erwartung. War ich zu einem Besuch gekommen? War ich gekommen, um sie nach Hause zu holen? War ich die schon lange überfällige Tochter oder Nichte von einem von ihnen, die einen Ausflug in die saubere, frische Luft vorschlagen würde? Ich ertappte mich dabei, wie ich den Blick abwandte, peinlich berührt, weil ich keinerlei persönlichen Kontakt anzubieten hatte. Verlegen sah ich wieder hin, hob eine Hand und winkte. Ein zögerlicher Reigen von Händen hob sich und erwiderte meinen Gruß. Das Lächeln der alten Leute war so lieb und nachsichtig, dass mich ein Gefühl von Dankbarkeit schmerzte.
Ich entfernte mich vom Speisesaal und durchquerte die Halle. Eine zweite Tür stand offen und gewährte Einblick in einen Aufenthaltsraum, der momentan menschenleer und mit nicht zusammenpassenden Sofas, Polstersesseln, einem Klavier, zwei Fernsehern und mehreren Beistelltischen möbliert war. Die Böden waren mit glänzendem beigefarbenem Linoleum belegt und die Wände in einem beruhigenden, blassen Blaugrün gestrichen. Die fertig gekauften Vorhänge wiesen ein abstrakt florales Muster in Gelb, Blau und Grün auf. Unzählige mit Petit point oder Kreuzstichen bestickte, gesteppte und gehäkelte Kissen lagen herum. Vielleicht hatte ein Häuflein Kirchendamen einen Handarbeitsanfall bekommen. Auf ein Kissen war quer über die Vorderseite ein Sinnspruch gestickt worden »DU BIST NUR so ALT, WIE DU DICH FÜHLST« –, ein entmutigender Gedanke, wenn ich an einige der Bewohner dachte, die ich gesehen hatte. Metallene Klappstühle standen an die Wand gelehnt, bereit, rasch aufgestellt zu werden. Alles war sauber, doch die »Dekoration« war unpersönlich, von Sparzwängen bestimmt und blieb hinter wirklich gutem Geschmack zurück.
Ich ging am Empfangstresen vorbei, der in einer kleinen Nische lag, und schlenderte den Korridor entlang, geleitet von Schildern, die auf die Dienste einer Ernährungsberaterin, die Pflegedienstleitung und eine Reihe von Beschäftigungs-, Logo-und Physiotherapeuten hinwiesen. Alle drei Türen standen offen, doch die Büros waren leer und die Lichter gedämpft. Gegenüber sah ich ein Schild mit der Aufschrift »Aufnahme«. Diese Tür war geschlossen, und ein beiläufiger Griff nach dem Knauf verriet mir, dass sie auch abgesperrt war. Nebenan lag die Patientenregistratur, die sich die Räume offenbar mit der Verwaltung teilte. Ich beschloss, hier anzufangen.
Die Deckenbeleuchtung war an, und ich trat durch die Tür. Es war niemand zu sehen. Ich wartete am Tresen und musterte beiläufig den Drahtkorb mit der eingegangenen Post. Geruhsam studierte ich meine Umgebung. Zwei Schreibtische standen Rücken an Rücken, einer davon mit einem Computer, der andere mit einer elektrischen Schreibmaschine, die leise brummte. Es gab mehrere rollbare Aktenwagen, einen Kopierer und metallene Aktenschränke an der Wand gegenüber. An einer weiteren Wand hing eine große Uhr mit einem tickenden Sekundenzeiger, den ich aus fünf Metern Entfernung hören konnte. Immer noch kein Mensch weit und breit. Ich stützte einen Ellbogen auf den Tresen und ließ die Finger in der Nähe des Postkörbchens baumeln. Indem ich die Ecken aufblätterte und den Kopf schief legte, konnte ich die meisten Absenderadressen lesen. Ganz alltägliche Rechnungen für Strom und Gas sowie einen Rasenmäh- und Gärtnerdienst und zwei braune Umschläge vom Santa Teresa Hospital, besser bekannt als St. Terry’s.
»Kann ich Ihnen helfen?«
Erschrocken richtete ich mich auf und sagte: »Hallo. Guten Tag.«
Die junge Frau war aus der Tür gekommen, die die Verwaltung mit der Patientenregistratur verband. Sie trug eine Brille mit rotem Plastikgestell. Ihr Teint war rein, doch sie sah aus, als würden ihr beim geringsten Anlass Pickel in rauen Mengen ausbrechen. Ihr Haar war mittelbraun und in verschiedenen unregelmäßigen Längen geschnitten – ein Stufenschnitt, der herausgewachsen war und nun dringend nachgeschnitten werden musste. Unter ihrem grünen Kittel trug sie eine braune Polyesterhose. Der Name »Merry« sowie »Pacific Meadows« waren maschinell auf die Brusttasche über ihrem Herzen gestickt.
Sie trat an den Tresen, indem sie durch eine Schwingtür schritt, und nahm ihren Platz auf der gegenüberliegenden Seite ein. Auf den ersten Blick hätte ich sie auf Anfang dreißig geschätzt, doch ich korrigierte dies rasch um gut zehn Jahre nach unten. Sie trug eine metallene Zahnspange, in deren Drähten noch Reste ihres Mittagessens hingen. Ihr Atem roch nach Anspannung und Unzufriedenheit. Ihre Miene blieb spöttisch, doch ihre Stimme hatte einen scharfen Unterton. »Darf ich fragen, was Sie da gerade gemacht haben?«
Ich zwinkerte ihr mit einem Auge zu. »Ich habe eine Kontaktlinse verloren. Womöglich ist sie auch schon im Auto herausgefallen; ich hab’s nur jetzt erst gemerkt. Ich dachte, sie wäre vielleicht in das Körbchen gefallen, aber sie ist nirgends zu sehen.«
»Soll ich Ihnen suchen helfen?«
»Machen Sie sich deswegen keine Umstände. Ich habe eine ganze Schachtel davon zu Hause.«
»Möchten Sie jemanden besuchen?«
»Ich bin beruflich hier«, erwiderte ich. Ich nahm meine Brieftasche aus der Umhängetasche, klappte sie auf und zeigte auf meine Lizenz als Privatdetektivin. »Ich bin engagiert worden, um das Verschwinden von Dr. Purcell zu untersuchen.«
Merry warf einen kurzen Blick auf meine Lizenz und hielt das briefmarkengroße Foto in die Höhe, um es mit meinem gesichtsgroßen Gesicht zu vergleichen.
»Sind Sie die Büroleiterin?«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich helfe hier nur stundenweise an den Wochenenden aus, solange die andere Kollegin im Mutterschutz ist. Von Montag bis Freitag bin ich Mrs. Steglers Assistentin.«
»Aha. Ist ja toll. Und was gehört da alles dazu?«
»Na ja, Tippen und Ablegen. Ich nehme Anrufe entgegen und verteile die Post an alle Bewohner – was eben so anfällt.«
»Sollte ich also lieber mit Mrs. Stegler sprechen?«
»Ich glaube schon. Sie ist kommissarische Leiterin der Verwaltung. Leider ist sie erst am Montag wieder hier. Könnten Sie da noch mal kommen?«
»Wie steht’s mit Mr. Glazer oder Mr. Broadus?«
»Die haben ein Büro in der Innenstadt.«
»Mann, das ist aber schade. Ich war gerade hier in der Gegend und dachte, ich schaue mal vorbei. Na ja. Da kann man wohl nichts machen.«
Ich sah, wie ihr Blick zu ihrem Computer wanderte. »Könnten Sie mich einen Moment entschuldigen?«
»Nur zu.«
Sie trat an ihren Zwölf-Zoll-Monitor mit seiner dunkelgelben Schrift auf schwarzem Hintergrund. Vermutlich erledigte sie ihre private Korrespondenz während der Arbeit. Sie drückte Tasten, bis sie das Dokument geschlossen hatte, und kehrte dann mit unsicherem Lächeln wieder an den Tresen zurück. »Haben Sie eine Visitenkarte? Dann kann ich Mrs. Stegler ausrichten, dass sie Sie anrufen soll, sobald sie kommt.«
»Das wäre prima.« Ich ließ mir Zeit, während ich in meiner Tasche nach einer Visitenkarte kramte. »Wie lange arbeiten Sie schon hier?«
»Am ersten Dezember werden es drei Monate. Ich bin noch in der Probezeit.«
Ich legte meine Karte auf den Tresen. »Gefällt Ihnen die Arbeit?«
»Es geht so einigermaßen. Sie wissen schon, es ist langweilig, aber ganz erträglich. Mrs. S. arbeitet schon seit einer Ewigkeit hier, und sie hat genau wie ich angefangen. Nicht dass ich vorhätte, so lange zu bleiben wie sie. Mir fehlen nur noch zwei Semester für meinen College-Abschluss.«
»Welches Fach?«
»Grundschullehrerin. Mein Dad sagt, man soll nicht ständig die Stelle wechseln, weil sich das im Lebenslauf schlecht macht. Als wäre man unzuverlässig, was ich noch nie war.«
»Ja, gut, aber wenn Sie sich fürs Unterrichten interessieren, hat es doch auch keinen Sinn, einen Job zu behalten, der Ihnen nicht entspricht.«
»Das habe ich auch gesagt. Außerdem ist Mrs. S. ganz schön launisch und geht mir auf die Nerven. Am einen Tag ist sie zuckersüß, als könnte sie kein Wässerchen trüben, und dann auf einmal schwenkt sie um und wird total griesgrämig. Ich meine, was hat sie denn für Probleme?«
»Was vermuten Sie?«
»Keine Ahnung. Sie suchen immer noch nach jemandem, der die Stelle übernehmen kann. Das stinkt ihr, aber okay. Sie findet, sie sollte befördert und nicht nur benutzt werden – so hat sie es jedenfalls ausgedrückt.«
»Wenn sie befördert würde, an wessen Stelle würde sie dann treten?«
»An die von Mrs. Delacorte. Das ist diejenige, die rausgeworfen wurde.«
Ich wahrte eine neutrale Miene. Sie langweilte sich nicht nur, sondern sie hatte auch die Grundregeln noch nicht gelernt, deren wichtigste besagt, dass man Leuten meines Schlages nie und nimmer Firmengeheimnisse anvertraut. »Ach herrje, das ist aber schade«, sagte ich. »Warum wurde sie denn rausgeworfen? Hat irgendjemand was gesagt?« Meine Lügen und Maskeraden werden meist von Floskeln wie »Ach herrje« und »Ach du liebe Zeit« begleitet.
»Sie wurde nicht direkt rausgeworfen, sondern ihr Arbeitsvertrag wurde aufgehoben.«
»Ach so. Und wann war das?«
»Zur gleichen Zeit wie bei Mrs. Bart. Die war seit Urzeiten Buchhalterin. Die Einstellungsgespräche für ihre Nachfolgerin fanden zur selben Zeit statt, als ich mich für diesen Job beworben habe.«
»Wie das?«
»Wie was?«
»Ich frage mich, wie es dazu kam, dass die Leiterin der Verwaltung und die Buchhalterin zur gleichen Zeit gekündigt wurden. War das Zufall?«
»Ganz und gar nicht«, antwortete sie. »Mrs. Bart wurde entlassen, und darüber hat sich Mrs. Delacorte aufgeregt und Stunk gemacht. Mr. Harrington hat dann gemeint, dass sie sich vielleicht auch lieber woanders eine Stelle suchen möchte, und das hat sie dann gemacht. Aber das habe ich alles nur gehört.« Sie unterbrach ihre Ausführungen, und ihre Augen hinter dem roten Plastikgestell schienen sich zu weiten. »Sie machen sich doch keine Notizen? Ich soll nämlich nicht tratschen. Da kennt Mrs. S. keine Gnade.«
Ich hielt die Hände in die Höhe. »Ich mache nur Konversation, bis der Regen nachlässt.«
Sie klopfte sich auf die Brust. »Puh! Einen Moment lang wurde ich schon ganz nervös. Ich möchte nämlich nicht, dass Sie einen falschen Eindruck bekommen. Ich meine, es ist, wie ich ihr versichert habe – ich würde nie die Privatangelegenheiten von irgendwem ausplaudern. Das ist nicht meine Art.«
»Ihre nicht und meine auch nicht«, sagte ich. »Und wer ist Mr. Harrington? Ich habe nie von ihm gehört.«
»Er arbeitet für die Betreiberfirma in Santa Maria.«
»Und er hat Sie eingestellt?«
»Sozusagen. Er hat das Gespräch mit mir am Telefon geführt, aber erst nachdem Mrs. S. meine Bewerbung bereits gebilligt hatte. So läuft es eben hier. Man muss die Männer glauben lassen, dass sie das Sagen haben, während in Wirklichkeit wir die Fäden in der Hand halten.«
»Ich dachte, Dr. Purcell hätte sämtliche Einstellungen und Entlassungen unter sich gehabt.«
»Darüber weiß ich nichts. Ich war noch keine zwei Wochen hier, als er, Sie wissen schon, abgehauen ist oder was auch immer. Ich glaube, deshalb war ja Mr. Harrington zum Einschreiten gezwungen.«
»Wo arbeitet Mrs. Delacorte jetzt? Hat das irgendjemand erwähnt?«
»Drüben im St. Terry’s. Das weiß ich, weil sie letzte Woche vorbeigekommen ist, um Mrs. S. zu besuchen. Sie hat sogar einen Superjob dort gekriegt, also kann sie echt von Glück sagen. Gekündigt zu werden kann ein wahrer Segen sein, obwohl sie sagt, dass es ihr damals nicht so vorkam.«
»Wie steht’s mit Mrs. Bart?«
»Wo die jetzt arbeitet, weiß ich nicht.«
»Kannten Sie Dr. Purcell?«
»Ich weiß, wer er war, aber weiter nichts. Das da drüben ist sein Büro. Er ist einfach irgendwie verschwunden. Da läuft’s mir eiskalt über den Rücken.«
»Echt unheimlich. Ich frage mich, was mit ihm passiert ist.«
»Kann man nicht wissen. Das ganze Personal ist fassungslos. Und die Patienten haben ihn vergöttert. Er hat dafür gesorgt, dass jeder an seinem Geburtstag eine Karte kriegt und solche Sachen. Er hat aus seiner eigenen Tasche dafür bezahlt, nur damit diese bedauernswerten alten Leute das Gefühl haben, dass jemand an sie denkt.«
»Hat irgendjemand eine Vermutung geäußert, was ihm zugestoßen sein könnte?«
»Am Anfang haben sie von nichts anderem geredet. Also, ich natürlich weniger, weil ich ihn kaum kannte.«
»Was könnte denn ...«
Ich merkte Merry an, dass sie mit ihrem Gewissen rang, und es dauerte gut sieben Sekunden, bevor Sie-die-niemals-tratscht sich zu mir herüberbeugte. »Versprechen Sie mir, dass Sie das nicht weitersagen ...«
»Keinem einzigen Menschen.«
Sie senkte die Stimme. »Mrs. S. glaubt, er hat das Land verlassen.«
Ich senkte auch die Stimme. »Wegen ...«
»Medicare.«
»Ach ja, klar. Das hat schon mal jemand erwähnt, aber ich konnte nicht näher nachfragen. Was bedeutet das?«
»B-E-T-R-U-G. Letzten Winter hat die OIG –«
»OIG?«
»Ach, das ist das Office of Inspector General, das Aufsichtsamt. Es gehört zum Gesundheits- und Sozialministerium. Jedenfalls hat uns das OIG diese Liste gefaxt, auf der die Tabellen und Rechnungsaufstellungen stehen, die sie einsehen wollten. Mrs. S. meinte, dass sich Dr. Purcell zuerst überhaupt nichts dabei gedacht hat. Manchmal machen sie das, nur um einen auf Trab zu halten. Aber dann haben sie nochmal nachgehakt, und da wurde ihm klar, wie ernst es war. Immer wieder ist er die Daten durchgegangen, um festzustellen, wie es auf sie wirken würde. Nicht gut. Bis Oberkante Unterlippe in der Kacke, um ihre Formulierung zu gebrauchen.«
»Hat er deshalb die letzten beiden Monate ständig Überstunden gemacht?«
»Ja, schon.«
»Dann wird das Haus hier also einer Rechnungsprüfung unterzogen?«
»Allerdings. Angefangen hat es mit einer Kassenrevision. Sie wollten einen Haufen Zeug sehen, das die letzten zwei Jahre betrifft. Da hat Dr. P. als medizinischer Direktor angefangen. Ich meine, er ist medizinischer Direktor und Verwaltungsleiter, mit einem Schrägstrich dazwischen. Laut Mrs. S. muss Pacific Meadows schließen, wenn das Haus seine Finanzierung verliert. Ganz zu schweigen von den ganzen Strafen, wissen Sie, Bußgelder und Rückerstattungen. Sie meint, vielleicht setzt es sogar Haftstrafen und dazu noch die öffentliche Bloßstellung. Die Purcells sind ja so großkotzige, affige Partygänger, also können Sie sich die Schande vorstellen. Dr. P. war derjenige, an dem dabei am meisten hängen geblieben wäre. Er saß ganz schön in der Scheiße. Das sind ihre Worte, nicht meine.«
»Und was ist mit seinen Arbeitgebern?«
»Ach, die beiden haben nichts mit der praktischen Seite zu tun. Die sind ständig in ganz Kalifornien unterwegs und kümmern sich um andere Geschäfte.«
»Tja, das klingt aber beängstigend für Dr. Purcell.«
»Ich an seiner Stelle wäre gestorben.«
»Das kann ich mir denken«, sagte ich. »Wann ist das überhaupt ans Licht gekommen?«
»Ich glaube, letzten Januar, lange vor meiner Zeit. Dann sind im März diese zwei Typen vom MFCU – das ist die Kontrollstelle für Betrug an Krankenversicherungen – unangemeldet aufgetaucht. Sie hatten Unmengen von Fragen und eine Liste mit sämtlichen Patientenakten, die sie einsehen wollten. Alle haben sich ein Bein ausgerissen, sind nach ihrer Pfeife getanzt und haben sich praktisch in die Hosen gemacht. Dr. P. wurde von Unmengen von Verstößen informiert. Da geht’s echt um Tausende von Dollar. Mindestens eine halbe Million, und das schon, wenn man nur an der Oberfläche kratzt. Womöglich entpuppt er sich als Riesenbetrüger.«
»Es wundert mich, dass das nicht in die Zeitungen gekommen ist.«
»Mrs. S. meint, sie halten es unter Verschluss, bis sie genau wissen, was sie in der Hand haben. Bis dahin sitzen sie ihm auf der Pelle, und zwar ohne Rücksicht auf Verluste.«
»Sie glaubt also, er hätte sich aus dem Staub gemacht, um einer Bestrafung zu entgehen?«
»Also, ich hätte das an seiner Stelle auf jeden Fall getan.«
»Woher wollen Sie wissen, dass er es war? Es müssen doch auch noch andere Leute Zugang zu Rechnungsunterlagen gehabt haben. Vielleicht wurde die Buchhalterin deshalb entlassen«, sagte ich.
Sie senkte den Blick und lehnte sich vor. »Sie sagen das nicht weiter, schwören Sie? Hand aufs Herz.«
Ich legte eine Hand auf mein Herz und hielt die andere in die Höhe.
»Mrs. Dorner – das ist die Chefin der Personalabteilung. Sie glaubt, Dr. P. hätte auch entführt worden sein können. Auf dem Parkplatz abgefangen, um ihn daran zu hindern, dass er den Mund aufmacht.«
Ich sagte »Wow« und setzte eine skeptische Miene auf. »Dummerweise sagt die Polizei, dass im Grunde nichts darauf hinweist.«
»Dazu gehört nicht viel. Ihm Isolierband auf den Mund klatschen, ihn in den Kofferraum werfen und losfahren«, meinte sie. »Sie hätten sein eigenes Auto benutzen können – deshalb ist es ja auch nicht gefunden worden.«
»Das klingt ziemlich plausibel«, sagte ich. Merry wandte sich ab und begann auf einmal, hektisch an der Post herumzufummeln.
Ich sah nach hinten. Eine Schwester in weißer Uniform stand in der Tür. Sie fixierte uns mit einem Blick, der schlau und einschüchternd zugleich war. Ich räusperte mich und sagte: »Also, Merry. Ich sause jetzt lieber los und halte Sie nicht länger von der Arbeit ab. Ich komme am Montag noch einmal vorbei und spreche mit Mrs. Stegler.«
»Ich richte ihr aus, dass Sie da waren.«
Die Schwester drehte sich um und sah mich an, als ich nur wenige Zentimeter von ihr entfernt durch die Tür ging. Ich unterdrückte den Drang, mich vor Widerwillen zu schütteln, nachdem ich mich umgewandt hatte, und fragte mich, wie viel sie wohl mitbekommen hatte.
Am Eingang holte ich Regenmantel und Schirm und kleidete mich wieder wetterfest ein. Als ich aus dem Pflegeheim trat, hatte der Regen bis auf ein Nieseln nachgelassen, und zarter Nebel waberte wie Rauch über den Asphalt. Von den Dachrinnen tropfte immer noch in unregelmäßigen Abständen Wasser. Ich wich einer Pfütze aus und überquerte den Parkplatz, bis ich dort anlangte, wo mein VW stand. Jetzt, mit geschärftem Blick, konnte ich erkennen, dass der frisch übermalte Name am Ende der Parklücke »P. Delacorte« lautete.
Als ich im Auto saß, riss ich das Päckchen Karteikarten auf und machte mir Notizen – ein Fakt pro Karte –, bis mein Hirn restlos alles ausgespuckt hatte.