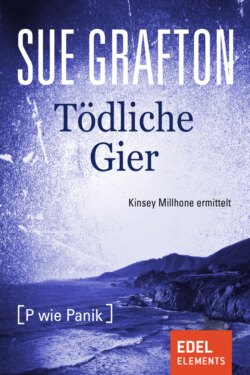Читать книгу Tödliche Gier - Sue Grafton - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеBevor ich Fionas Haus verließ, gab sie mir Melanies Privatadresse in San Francisco sowie deren private und geschäftliche Telefonnummer. Allerdings konnte ich mir keinen Grund denken, weshalb ich Fiona dort oben anrufen sollte. Außerdem nannte sie mir Crystals Adresse und Telefonnummer in Horton Ravine. Detective Odessa, den Fiona beiläufig erwähnt hatte, hatte ich zwar nie kennen gelernt, aber ein Gespräch mit ihm stand ganz oben auf meiner Liste. Auf der Rückfahrt in die Stadt merkte ich, wie mein Magen vor Beklommenheit zu grollen begann. Ich versuchte meine Bedenken zu ergründen, indem ich sie nacheinander durchging, allerdings nicht unbedingt in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit.
1 Ich mochte Fiona weder besonders, noch traute ich ihr. Sie war zu den Cops nicht ganz aufrichtig gewesen, und ich glaubte auch nicht, dass sie es mir gegenüber war. Unter diesen Umständen hätte ich es vermutlich ablehnen sollen, den Auftrag anzunehmen. Schon jetzt bereute ich, dass ich so überstürzt eingewilligt hatte.
2 Ich war mir nicht sicher, ob ich in diesem Fall Ergebnisse erzielen könnte. Zu Beginn von Ermittlungen bin ich häufig unsicher, vor allem bei derartigen Fällen. Neun Wochen waren vergangen, seit man Dr. Purcell zuletzt gesehen hatte. Egal, welche Umstände zum Verschwinden eines Menschen geführt haben mögen, das Verstreichen längerer Zeitspannen wirkt sich selten günstig aus. Zeugen schmücken ihre Aussagen aus. Sie erfinden Dinge. Die Erinnerung wird nebulös. Im Zuge der Wiederholung verblasst die Wahrheit mehr und mehr, und Einzelheiten verändern sich, um den verschiedensten persönlichen Interpretationen zu genügen. Die Leute wollen hilfreich sein, was bedeutet, dass sie im Lauf der Zeit ihre Geschichten verbrämen und Ereignisse ihren eigenen Vorlieben entsprechend einfärben. Wenn man so spät in einen Fall einsteigt, ist es nahezu ausgeschlossen, dass man noch eine entscheidende Entdeckung macht. Fiona hatte natürlich damit Recht, dass ein neuer Gesichtspunkt manchmal die Richtung von Ermittlungen völlig verändern kann. Trotzdem sagte mir meine Intuition, dass jeder Durchbruch in diesem Fall die Folge eines glücklichen Zufalls wäre, was nichts anderes hieß als reiner Dusel.
3 Das blöde Getue um den Vorschuss passte mir nicht.
Ich hielt an einem McDonald’s und kaufte mir Kaffee und zwei Egg McMuffins. Ich brauchte den Trost von Junk Food ebenso wie die Nährstoffe, wenn man sie denn so nennen will. Ich aß beim Fahren und mampfte dermaßen gierig, dass ich mir in den Zeigefinger biss.
Vielleicht ist dies der geeignete Moment, um mich vorzustellen. Mein Name ist Kinsey Millhone. Ich bin amtlich zugelassene Privatdetektivin in Santa Teresa, Kalifornien, einem hundertfünfzig Kilometer nördlich von Los Angeles gelegenen Ort. Ich bin sechsunddreißig Jahre alt, zweimal geschieden, kinderlos und auch sonst ohne Anhang. Abgesehen von meinem Auto besitze ich nicht viel. Mein Büro, Millhone Investigations, besteht aus mir allein. Mit Anfang zwanzig war ich zwei Jahre lang Polizistin gewesen, und aufgrund persönlicher Schwierigkeiten, die jetzt zu mühsam zu erklären wären, wurde mir klar, dass der Polizeidienst nichts für mich war. Ich war viel zu aufsässig und stur, um mich den Dienstvorschriften mit all ihren moralischen Bestimmungen zu unterwerfen, und muss zugeben, dass ich die Regeln sehr locker ausgelegt habe. Davon abgesehen wirkte in der Uniform mit dem Gürtel mein Hintern zu breit.
Nachdem ich den einträglichen Posten bei der Stadt aufgegeben hatte, ging ich in einem Büro, das zwei Privatdetektive betrieben, in die Lehre und leistete dort die erforderliche Stundenzahl ab, um meine Zulassung beantragen zu können. Mittlerweile arbeite ich seit gut zehn Jahren allein und bin zugelassen, vereidigt und hoch versichert. Einen großen Teil des vergangenen Jahrzehnts habe ich damit verbracht, Forderungen wegen Brandstiftung und fahrlässiger Tötung gegen die California Fidelity Insurance zu bearbeiten, zuerst als reguläre Angestellte, dann als freie Mitarbeiterin. Vor drei Jahren, im Oktober 1983, trennten sich unsere Wege, und ich mietete Räume bei der Anwaltskanzlei Kingman und Ives – eine Regelung, die sich nun dem Ende zuzuneigen schien.
Schon ein Jahr lang klagte Lonnie Kingman über Platzmangel. Er hatte bereits einmal erweitert und den gesamten zweiten Stock eines Gebäudes übernommen, das ihm komplett gehörte. Nun hatte er ein zweites Haus gekauft, das in der unteren State Street lag und in das er umziehen wollte, sobald der Kaufvertrag unter Dach und Fach war. Er hatte einen Nachmieter für unsere derzeitigen Räume gefunden, und nun stellte sich nur noch die Frage, ob ich mit ihm umziehen oder mir ein eigenes Büro suchen würde. Ich bin von Natur aus Einzelgängerin, und obwohl ich Lonnie mag, ging es mir langsam auf die Nerven, in nächster Nähe zu anderen Leuten zu arbeiten. Ich ertappte mich dabei, wie ich abends und an den Wochenenden ins Büro ging und halbe Tage zu Hause arbeitete – alles nur, um ein Gefühl von Raum und Ungestörtheit zu erzeugen. Ich hatte mit einem Immobilienmakler über monatsweise mietbare Räume gesprochen und auf mehrere Kleinanzeigen geschrieben, aber bis jetzt noch nichts gesehen, das mir zugesagt hätte. Meine Ansprüche waren bescheiden: Platz für meinen Schreibtisch, einen Drehstuhl, einige Aktenschränke und ein paar künstliche Pflanzen. Zusätzlich wünschte ich mir eine kleine, aber geschmackvolle Cheftoilette. Das Problem war nur, dass alles, was mir gefiel, entweder zu groß oder zu teuer war, und alles, was meinem Budget entsprach, zu beengt, zu schäbig oder zu weit von der Innenstadt entfernt war. Ich habe häufig im Einwohneramt zu tun und lege Wert darauf, Gerichtsgebäude, Polizeirevier und Stadtbibliothek zu Fuß erreichen zu können. Überdies war Lonnies Kanzlei ein regelrechtes Refugium, und er tritt auch als mein Anwalt auf, wenn es hart auf hart kommt, was häufig der Fall ist.
Sobald ich den Block mit den Zweihunderter-Nummern östlich vom Capillo erreicht hatte, in dem Lonnies Kanzlei lag, begann ich mit der gewohnten Such- und Schnappaktion auf der Jagd nach einem Parkplatz. Ein Nachteil des derzeitigen Gebäudes war der winzige dazugehörige Parkplatz, auf den nur zwölf Autos passten. Lonnie und sein Partner hatten jeder einen Platz, genau wie die beiden Sekretärinnen Ida Ruth Kenner und Jill Stahl. Die restlichen acht Stellflächen verteilten sich auf die sonstigen Mieter des Hauses, und so war ich gezwungen, mir woanders eine Parklücke zu suchen. Heute zwängte ich mich in ein Fleckchen am Randstein, das zwischen zwei Geschäftseinfahrten lag. Ich hätte schwören können, dass es ein fast legaler Parkplatz war, und merkte erst zu spät, dass ich doch einen Strafzettel bekommen hatte.
Ich ging die fünf Blocks zum Büro zu Fuß, stieg die zwei Treppen hinauf und betrat die Kanzlei durch eine unbeschriftete Seitentür. Dann marschierte ich den Flur entlang bis zu meinem Zimmer, schloss auf und ging hinein, wobei ich darauf achtete, Ida Ruth und Jill nicht auf mich aufmerksam zu machen, die ein Stückchen weiter weg ins Gespräch vertieft waren. Mir war klar, dass ihr Thema dasselbe sein würde, das sie seit zwei Monaten unentwegt debattierten: Lonnies Partner John Ives hatte darauf gedrungen, dass die Kanzlei seine Nichte Jeniffer als Empfangsdame einstellte, als die Stelle frei wurde. Jeniffer war achtzehn Jahre alt und hatte gerade ihren High-School-Abschluss gemacht. Es war ihr erster Job, und obwohl man ihr eine ausführliche, schriftliche Stellenbeschreibung gegeben hatte, schien ihr völlig schleierhaft zu sein, was von ihr erwartet wurde. Sie kam in T-Shirt und Minirock zur Arbeit, das lange blonde Haar offen über den Rücken fallend, mit nackten Beinen und die Füße in hölzernen Clogs. Ihre Telefonstimme war quietschvergnügt, ihre Rechtschreibung katastrophal, und sie schaffte es einfach nicht, pünktlich zu kommen. Außerdem nahm sie sich immer wieder zwei bis vier Tage frei, wenn ihre arbeitslosen Freunde loszogen und Party machten. Ida Ruth und Jill waren restlos entnervt, weil sie ihre Arbeit dann mit übernehmen mussten. Beide jammerten mir die Ohren voll, da sie offenbar Hemmungen hatten, sich bei Lonnie oder John zu beschweren. Bürotratsch hat mir nie besonders behagt, und so war dies ein weiterer Grund dafür, dass ich gute Lust hatte, mir neue Räume zu suchen. Hatte mir früher die familiäre Atmosphäre gefallen, die in der Kanzlei herrschte, so sah ich jetzt nur noch die eskalierenden Psychodramen. Jeniffer war eine Art Aschenputtel mit verkümmertem IQ. Ida Ruth und Jill verhielten sich wie die boshaften Stiefschwestern und troffen ihr gegenüber vor Freundlichkeit, nahmen aber jede Gelegenheit wahr, hinter ihrem Rücken über sie zu lästern. Ich weiß nicht genau, welche Rolle ich dabei spielte, aber ich bemühte mich, mich nicht in die Sache hineinziehen zu lassen, indem ich mich in meinem Zimmer verbarrikadierte. Zweifellos war ich auch nicht geschickter im Lösen von Konflikten als alle anderen.
Um eine Fluchtmöglichkeit zu haben, rief ich beim Polizeirevier von Santa Teresa an und fragte, ob ich Detective Odessa sprechen könne. Er war in einer Besprechung, doch die Frau, die meinen Anruf entgegennahm, sagte mir, dass er bald fertig wäre. Ich vereinbarte einen Termin für halb elf. Dann füllte ich einen vorgedruckten Vertrag aus, schob ihn in einen Express-Mail-Umschlag, den ich an Fiona unter Melanies Privatanschrift in San Francisco adressierte. Das Ganze steckte ich in meine Handtasche und setzte mich dann an den Schreibtisch, wo ich zwischen mehreren Runden Patience tiefgründige Krakel auf meine Unterlage malte. Nicht, dass ich nicht tonnenweise andere Arbeit gehabt hätte, aber ich merkte, dass mich die Daten ablenkten, die mir ständig durch den Kopf gingen. Schließlich zog ich einen Aktendeckel und einen großen Schreibblock hervor und begann mir Notizen zu machen.
Um fünf vor halb elf schloss ich meine Tür zu und ging erst zum Postamt gegenüber und dann weiter zum Polizeirevier, das vier Blocks entfernt lag. Die Morgenluft war kühl, und das blasse Sonnenlicht von vorher hatte nachgelassen, während sich der Himmel zuzog und baldigen Regen ankündigte. Die Regensaison in Santa Teresa ist unberechenbar: Früher begannen die stoßweisen Phasen massiver Niederschläge Mitte Januar und hielten mehr oder weniger bis Anfang März an. Neuerdings haben extreme Wetterbedingungen in anderen Gegenden der Welt zu sprunghaften Abweichungen geführt. Von Ende Mai bis Oktober kann man die Regenmenge zwar immer noch in Millimetern messen, aber die Wintermonate sind nun wechselhaft, und dieser November wollte offenbar einer der nassesten seit Jahren werden. Eine Kaltfront näherte sich von Alaska und kündigte sich durch einen schneidenden Wind an. Die Äste der Bäume bewegten sich ruhelos, bogen sich und knackten, während ausgetrocknete Palmwedel abbrachen und wie Besen über die Gehsteige fegten.
Die Eingangshalle des Polizeireviers wirkte im Vergleich dazu gemütlich. Zu meiner Linken saß ein kleiner Junge wartend auf einer hölzernen Bank, während sein Vater mit einem Beamten in Zivil einen Unfallbericht besprach. Ich trat an den L-förmigen Tresen, wo ein uniformierter Beamter den Kundenverkehr abwickelte, und sagte ihm, dass ich einen Termin hätte, was er telefonisch an Detective Odessas Platz weitergab. »Er kommt gleich«, versicherte er mir.
Ich wartete an Ort und Stelle und sah beiläufig zum Einwohneramt hinüber. Meine Freundin Emerald war vorzeitig in den Ruhestand gegangen, und nun hatte ich keine Verbündete mehr, die mir unter der Hand Informationen zuschob. Sie hatte zwar nie direkt gegen ihre Dienstvorschriften verstoßen, aber ein paar Mal war sie haarscharf daran vorbeigeschrammt.
Detective Odessa zog die Tür auf und steckte den Kopf herein. »Ms. Millhone?«
»Das bin ich.«
»Vince Odessa«, stellte er sich vor, und wir schüttelten uns die Hände. »Kommen Sie doch mit nach hinten.«
»Gerne.«
Er trug ein blaues Anzughemd, eine dunkle Krawatte, eine leichte Freizeithose, dunkle Socken und glänzend polierte schwarze Schuhe. Er hatte dunkle Haare, und sein Hinterkopf war so flach, als hätte er seine gesamte Säuglingszeit auf dem Rücken gelegen. Er war größer als ich, schätzungsweise einsfünfundsiebzig gegenüber meinen einsachtundsechzig. Er hielt mir die Tür auf und ließ mich vor ihm den Flur betreten. Ich blieb stehen, damit er vorangehen konnte. Er marschierte den Flur entlang und trat links durch eine Tür mit der Aufschrift ERMITTLUNGEN. Ich folgte ihm durch ein Gewirr kleiner Büros. Über die Schulter sagte er: »Shelly meinte, es ginge um Dr. Purcell.«
»Stimmt. Seine Exfrau hat mich engagiert, damit ich Nachforschungen wegen seines Verschwindens anstelle.«
Odessa sprach in neutralem Ton weiter. »Ich hatte schon das Gefühl, dass so etwas kommt. Sie war letzte Woche hier.«
»Was halten Sie von ihr?« »Da muss ich mich auf mein Aussageverweigerungsrecht berufen. Werden Sie nach Stunden bezahlt?«
»Ich habe ihren Scheck noch nicht eingelöst. Ich hielt es für klug, erst mit Ihnen zu sprechen.«
Sein »Büro« war in einer Standardkabine untergebracht: schulterhohe graue Wände, die mit fester, synthetischer Schlingenware bezogen waren. Er setzte sich an den Schreibtisch und bot mir den einzigen anderen Stuhl innerhalb des engen Raums an. Gerahmte Fotos seiner Familie standen vor ihm: Frau, drei Töchter und ein Sohn. In einem kleinen metallenen Bücherregal hinter mir standen ordentlich aufgereiht Diensthandbücher, Lehrwerke und mehrere Gesetzesbände. Er war sauber rasiert, abgesehen von einem Streifen Stoppelhaare, die er ausgelassen haben musste, als der Rasierer über die Kerbe in seinem Kinn hüpfte. Über seine dunkelblauen Augen zogen sich energische Brauen. »Also, womit kann ich Ihnen helfen?«
»Das weiß ich nicht genau. Ich würde gern hören, was Sie wissen, falls Sie bereit sind, Ihr Wissen mit mir zu teilen.«
»Damit habe ich kein Problem«, sagte er. Er beugte sich vor und sah einen Stapel dicker Akten durch, die auf einer Seite seines Schreibtischs lagen. Dann zog er ein Ringbuch unten aus dem Stapel und legte es vor sich hin. »Hier herrscht das totale Durcheinander. Ständig heißt es, in den nächsten sechs, acht Monaten würde alles auf Computer umgestellt. Das papierlose Büro. Glauben Sie daran?«
»Es wäre schön, aber ich bezweifle es.«
»Ich auch«, sagte er. Er blätterte mehrere Seiten vor, bis er zur ursprünglichen Meldung des Vorfalls kam. »Ich bin gerade befördert worden. Da ich der Jüngste im Team bin, ist diese Sache in den Augen der anderen ein Lehrgang für mich. Schauen wir mal, was wir da haben.« Sein Blick wanderte im Zickzackkurs über die Seite. »Crystal Purcell hat am Dienstag, dem 16. September, eine Vermisstenmeldung aufgegeben, dreieinhalb Tage nachdem der Doktor abends nicht wie erwartet nach Hause gekommen ist. Ihre Angaben wurden zu Protokoll genommen. An diesem Wochenende hat es mehrere Einbrüche in Wohnhäuser gegeben, daher bin ich der Meldung erst mittags am Donnerstag, dem 18. September nachgegangen. Soweit wir feststellen konnten, war Purcell nicht in Gefahr, und sein Verschwinden hatte nichts Verdächtiges an sich.« Er hielt inne und sah mich an. »Ehrlich gesagt haben wir vermutet, er sei aus freien Stücken abgehauen. Sie wissen ja, wie es ist. In der Hälfte der Fälle taucht der Typ hinterher mit eingekniffenem Schwanz wieder auf. Dann stellt sich heraus, dass er eine Freundin hat oder mit seinen Kumpeln auf Sauftour war. Es gibt ein halbes Dutzend Erklärungen, die allesamt harmlos sind. Natürlich ist es hart für die Ehefrau, aber nichts Bedrohliches.«
Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. »Eine halbe bis eine ganze Million Leute laufen jedes Jahr davon. Es ist schlimm für Familie und Freunde. Wahrscheinlich haben Sie es ja selbst schon miterlebt. Zuerst verdrängen sie. Können nicht glauben, dass ihnen jemand eine solche Schweinerei antut. Später werden sie wütend. Jedenfalls habe ich die jetzige Mrs. Purcell angerufen und einen Termin für Freitagnachmittag ausgemacht. Das war der 19. September. Offen gestanden habe ich Zeit geschunden, da ich annahm, sie würde bis dahin etwas hören.«
»Was nicht der Fall war?«
»Weder damals noch irgendwann seither. Ihrer Aussage zufolge litt er an keinerlei Krankheiten, die zu Besorgnis Anlass gegeben hätten. Weder Herzbeschwerden noch Diabetes noch irgendwelche psychischen Probleme in der Vergangenheit. Sie sagte, sie hätte ihn im Büro angerufen und mit ihm geredet – und zwar am 12. September, kurz nach dem Mittagessen. Purcell hat ihr gesagt, dass es später würde, aber es war nicht die Rede davon, dass er überhaupt nicht nach Hause käme. Am Samstagmorgen war sie völlig außer sich und hat jeden angerufen, den sie kannte – Freunde, Verwandte, seine Kollegen, Krankenhäuser, die Highway Patrol, das Leichenschauhaus – was man sich denken kann. Doch nirgends eine Spur von ihm.
Ich habe über eine Stunde lang bei ihr gesessen, in dem Haus in Horton Ravine. Sie hat noch ein zweites am Strand, wo sie die meisten Wochenenden verbringt. Ich habe die ganze Latte abgearbeitet – nach Gewohnheiten, Hobbys, Beruf und Mitgliedschaften in Country Clubs gefragt; ich habe mir sein Schlafzimmer angesehen, seine Kommode durchsucht, seine Telefonrechnungen und Kreditkartenabrechnungen studiert. Ich habe auch seine Kreditkartenkonten nach jüngsten Bewegungen abgeklopft, sein Adressbuch und seinen Kalender durchgelesen – einfach alles abgedeckt.«
»Und es hat sich nichts ergeben?«
Er hielt einen Finger in die Höhe. »Darauf komme ich gleich. Im Lauf der folgenden zwei Wochen haben wir die Post bei ihm zu Hause und im Pflegeheim durchgesehen, dafür gesorgt, dass seine eingehende Post abgefangen wird, mit seinen Arbeitgebern gesprochen, ihn in die Vermisstendatei eingegeben und sein Autokennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben. Sie verstehen doch, dass es hier nach dem Stand der Dinge nicht um ein Verbrechen geht, also ist das alles eine reine Gefälligkeit der zuständigen Stellen. Wir tun, was wir können, aber es gibt keinerlei Indizien dafür, dass wir es mit einem Problem zu tun haben.«
»Fiona sagt, sein Pass sei verschwunden.«
Odessa lächelte mitleidig. »Das ist meiner auch – so gesehen. Nur weil seine Frau ihn nicht findet, heißt das nicht, dass er verschwunden ist. Wir haben einen aktuellen Auszug für ein Sparkonto bei der Mid-City Bank gefunden. Und der hat uns stutzig gemacht. Es hat nämlich den Anschein, als hätte er im Lauf der letzten zwei Jahre eine Reihe von Barabhebungen vorgenommen – alles in allem dreißigtausend Dollar. Der Kontostand ist allein in den letzten zehn Monaten von dreizehntausend auf dreitausend gesunken. Der letzte Umsatz auf dem Konto fiel am 29. August an. Seine Frau scheint nichts davon zu wissen.«
»Sie glauben, er hat seine Abreise vorbereitet?«
»Tja, es sieht jedenfalls schwer danach aus. Sicher, mit dreißigtausend kommt man heutzutage nicht besonders weit, aber es ist ein Anfang. Vielleicht hat er ja noch andere Konten angezapft, die wir bis jetzt nicht entdeckt haben. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Typ ein Spieler ist und das seine Einsätze sind. Sie behauptet zwar, er sei keiner, aber womöglich hat er sie ja darüber im Dunkeln gelassen.«
»Könnten wir nochmal auf den Pass zurückkommen? Wenn Purcell das Land verlassen hat, müsste dann nicht der Zoll einen Eintrag darüber haben?«
»Sollte man meinen. Vorausgesetzt, er hat seinen eigenen Pass benutzt. Vielleicht hat er aber seine Papiere – Führerschein, Geburtsurkunde und Pass – auch gegen einen Satz gefälschter Dokumente eingetauscht, was bedeutet, dass er unter einem anderen Namen nach Europa oder Südamerika geflogen sein könnte. Oder er ist nach Kanada gefahren, hat einen Flug gebucht und ist von dort aus weitergereist.«
»Oder er hält sich irgendwo verborgen«, sagte ich.
»Gut möglich.«
»Hätte dann nicht irgendwer sein Auto sehen müssen?«
»Nicht unbedingt. Er hätte es über eine Steilküste stürzen lassen oder damit nach Mexiko fahren und es einem Hehler verkaufen können. Parken Sie so einen Wagen mal in South Central, und Sie werden staunen, wie schnell er weg ist.«
»Was für einen Wagen?«
»Eine viertürige Mercedes-Limousine. Silberfarben. Mit persönlichen Schildern, auf denen DOCTOR P steht.«
»Die Polizei glaubt also nicht an einen unnatürlichen Tod.«
»Dazu besteht kein Grund. Schließlich haben wir auf dem Parkplatz vor dem Pflegeheim keine Blutflecken gefunden. Keine Anzeichen für einen Kampf, keine Indizien für einen Überfall und keinen Anlass zu der Vermutung, dass er gegen seinen Willen verschleppt wurde. Wir haben die Gegend abgegrast und in jedem Haus in Reichweite nachgefragt. Kein Mensch hat an diesem Abend irgendetwas gesehen oder gehört.«
»Fiona glaubt, er könnte aus freien Stücken verschwunden sein. Sind Sie derselben Meinung?«
»Mir persönlich behagt die ganze Geschichte nicht. Neun Wochen ohne einen Mucks. Man muss fast annehmen, dass irgendetwas anderes dahinter steckt. Wir gehen jetzt alles erneut durch und suchen nach etwas, das uns beim ersten Mal entgangen ist.«
»Hat Fionas Geschichte die Ermittlungen beeinflusst?«
»Inwiefern?«
»Mit ihrem ganzen Gerede davon, dass er früher schon mehrmals verschwunden ist«, sagte ich.
Odessa winkte ab. »Nichts als Gelaber. Sie behauptet, er sei früher schon abgehauen. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich bin mir über ihre Motive nicht ganz im Klaren.«
»Laut eigener Aussage will sie Resultate sehen.«
»Sicher, aber wer will das nicht? Wir sind Cops, keine Zauberkünstler. Wir bewirken keine Wunder.«
»Haben Sie die Geschichte geglaubt, die sie erzählt hat?«
»Ich glaube, dass er sie verlassen hat. Ob er tatsächlich Probleme mit der jetzigen Mrs. P. hatte, ist nicht bewiesen.« Er hielt inne. »Haben Sie Crystal schon kennen gelernt?«
Ich schüttelte den Kopf.
Odessa zog die Brauen hoch und schüttelte eine Hand, als hätte er sich verbrannt. »Sie ist eine schöne Frau. Kaum vorstellbar, dass ein Mann sie verlässt.«
»Haben Sie eine Theorie?«
»Ich doch nicht. Aus unserer Perspektive ist die Sache noch immer kein Kriminalfall. Ohne Verbrechen braucht man weder jemanden auf seine Rechte aufmerksam zu machen, noch braucht man Durchsuchungsbefehle, und das macht unsere Arbeit wesentlich einfacher. Wir sind doch nur ein paar brave Jungs, die den Angehörigen einen Gefallen tun wollen. Ich persönlich bin zwar der Ansicht, dass die Sache übel aussieht, aber das sage ich zu niemandem sonst, Sie eingeschlossen.«
Ich zeigte auf die Akte. »Darf ich mal einen Blick hineinwerfen?«
»Von mir aus gern, aber das ist Paglias Fall, und er pocht auf Geheimhaltung. Allerdings hat er nichts dagegen, wenn wir an passender Stelle den Kern der Geschichte skizzieren. In erster Linie geht es darum, den Mann zu finden, was heißt, dass wir kooperieren, wenn wir können.«
»Es stört ihn also nicht, wenn ich ein paar dieser Leute aufsuche und mit ihnen rede?«
»Sie können tun, was Sie wollen.«
Als er mich hinausbegleitete, sagte er: »Falls Sie ihn finden, sagen Sie uns Bescheid. Er kann verschwunden bleiben, wenn er will, aber es würde mir stinken, wenn ich weiter an der Sache arbeite, während er mit einer Nase voller Koks in Vegas sitzt.«
»Das glauben Sie aber nicht.«
»Nein. Und Sie auch nicht«, sagte er.
Auf dem Rückweg ins Büro machte ich einen Umweg von zwei Blocks und ging an der Bank vorbei. Ich füllte ein Einzahlungsformular aus, girierte Fionas Scheck und wartete, bis ich an der Reihe war. Am Schalter angelangt, wies ich auf die aufgedruckte Kontonummer. »Könnten Sie den Stand dieses Kontos überprüfen? Ich möchte sichergehen, dass der Scheck gedeckt ist, bevor ich ihn einzahle.« Eine weitere Lektion, die ich auf die harte Tour gelernt hatte. Ich fange nicht mit der Arbeit an, bevor ein Scheck sich als gedeckt erwiesen hat.
Barbara, die Bankangestellte, kannte mich schon seit Jahren. Ich sah ihr zu, wie sie die Kontonummer in ihre Computertastatur eintippte und dann den Bildschirm musterte. Sie drückte einmal auf die Eingabetaste. Tipp. Noch einmal. Tipp. Ich sah zu, wie ihr Blick die Zeilen entlangwanderte.
Sie sah noch einmal auf mein Einzahlungsformular und verzog das Gesicht. »Der Scheck ist gedeckt, aber es ist knapp. Wollen Sie es lieber in bar?«
»Nein, eine Gutschrift ist mir recht, aber erledigen wir es lieber, bevor der nächste Scheck kommt und sie pleite ist.«