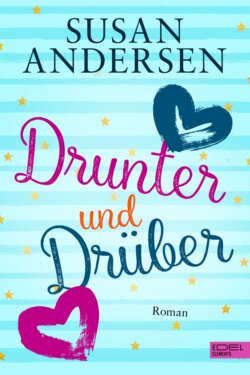Читать книгу Drunter und Drüber - Susan Andersen - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеButch legte den Hörer auf die Gabel, warf sich aufs Sofa, nahm einen Schluck aus der Bierflasche in seiner Hand und legte die Füße vor sich auf den Tisch. Gina wurde, wenn er das tat, immer fuchsteufelswild, aber sie war nicht zu Hause, weshalb also sollte er – verdammt noch mal – nicht einfach tun, was ihm gefiel?
Wo zum Teufel war J.D.? Der Typ, auf den Butch bei dem lächerlichen Überfall am letzten Donnerstag geschossen hatte, war gestern gestorben, und der Mann, der ihm ein Alibi verschaffen sollte, trieb sich einfach irgendwo herum.
Verdammt, wie hatte er so plötzlich in einen solchen Schlamassel geraten können? Schließlich hatte er nicht auf den Typen schießen wollen – die alte Pistole hatte jahrelang begraben unter einem Berg von alten Papierservietten in seinem Handschuhfach gelegen. Sie war die letzte verbleibende Verbindung zu seinen wilden jungen Jahren. Er hatte sie nicht behalten, um sie irgendwann zu benutzen, sondern weil sie ihm ein Gefühl der Sicherheit verlieh.
Ebenso wenig hatte er den Laden wirklich überfallen wollen. Er war es einfach leid gewesen, ständig pleite zu sein und sich Ginas endlose Tiraden darüber anhören zu müssen, was für ein Schlappschwanz er doch war und weshalb er nun, da der Laden von Lankovich, dem Schuft, dicht gemacht worden war, nicht endlich auf die Suche nach einer neuen Arbeit ging. Er hatte einfach aus einem Impuls heraus die Waffe aus dem Handschuhfach genommen, ehe er, um sich ein Six-Pack zu holen, in den Supermarkt gegangen war. Er wollte verdammt sein, wenn er wegen jedes Dollars zu seiner Alten ging.
Er hatte nicht die Absicht gehabt, die Waffe wirklich zu benutzen, aber der Idiot hinter dem Tresen hatte unbedingt den Helden spielen müssen. Verdammt, es war seine eigene Schuld, dass Butch auf ihn geschossen hatte; jeder mit ein bisschen Hirn hätte gewusst, dass man bei einem Überfall einfach die Knete rüberwachsen ließ. Aber nein, stattdessen hatte er mit seinem jämmerlichen Englisch einen Streit vom Zaun gebrochen und dann auch noch unter den Ladentisch gegriffen. Scheiße, woher hätte Butch wissen sollen, dass dort keine Knarre versteckt gewesen war? Das hätte bestimmt jeder in seiner Lage gedacht – und garantiert hätte er sich nicht so einfach von einem Typen mit Handtuch um den Kopf, der gerade mal den Mindestlohn verdiente, über den Haufen schießen lassen.
Trotzdem hatte er echt nicht abdrücken wollen. Aber, Himmel, an dem Nachmittag war einfach alles schief gelaufen, und vor lauter Nervosität hatte der Finger, der am Abzug lag, gezuckt. Und dann war der Kerl rückwärts getaumelt, gegen das hinter ihm stehende Zigarettenregal gekracht und jede Menge leuchtend rotes Blut war in der Gegend rumgespritzt.
Jetzt musste er etwas unternehmen, bevor J.D. von dieser Sache hörte und auf die Idee kam, eine nicht wieder gut zu machende Dummheit zu begehen. Je länger Butch darüber nachdachte, umso klarer wurde ihm, dass, was auch immer er jetzt täte, besser von dauerhafter Wirkung war.
Scheiße. Bereits der Gedanke bereitete ihm Kopfweh. J.D. war ein echter Kumpel. Er hatte ihn wirklich gern. Aber immer schon hatte J.D. diesen unpraktischen Moralfimmel gehabt. Die Schuld dafür gab Butch der alten Hexe, von der er damals aufgenommen worden war. Aber das war eigentlich egal. Das Einzige, was zählte, war, dass J.D. niemals verstünde, was in dem Laden abgelaufen war.
Er wusste genau, was passieren würde. Sobald J.D. vom Tod des Angestellten Wind bekäme, würde er entweder erwarten, dass Butch zugab, mit Kittie zusammengewesen zu sein, damit die Bullen mit ihr sprechen könnten und sein Name ein für alle Male reingewaschen wäre, oder aber er würde die Geschichte persönlich doppelt und dreifach überprüfen. Und Kittie war nicht gerade hell. Wenn J.D. sie hart genug in die Zange nähme, würde sie ihm früher oder später sicherlich verraten, dass Butch sie darum gebeten hatte, zu behaupten, dass er an dem Nachmittag bei ihr gewesen war.
Aber verdammt, die Wahl zwischen einer alten Freundschaft und mindestens zwanzig Jahren hinter Gittern fiel nicht wirklich schwer. Es war schade, aber so liefen die Dinge nun einmal. Und er würde sicher nicht tatenlos hier sitzen, bis die Bullen kämen und ihn holten. Vor allem nach dem Anruf – er wäre beinahe ausgeflippt, als J.D. ihn praktisch für alle hörbar nach dem Supermarktverkäufer gefragt hatte. Er hatte versucht herauszufinden, woher der Anruf gekommen war, aber auch das war misslungen. Gerade als er die entsprechende Tastenfolge hatte drücken wollen, hatte Gina angerufen, um ihm zu sagen, sie würde nach der Arbeit noch mit einer Freundin einen trinken gehen.
Manchmal war das Leben wirklich Scheiße.
Er kannte J.D. einfach zu gut. Der Mann war der reinste Pitbull, wenn er Informationen haben wollte. Besser er machte einen Präventivschlag, als darauf zu warten, dass J.D. von der neuen Entwicklung Wind bekommen und ihn hinter Gitter bringen würde.
Das Problem war, dass er einfach nicht wusste, wo sein alter Kumpel steckte. Der Aushilfsjob, den er bekommen hatte, war beendet. Vielleicht hatte er ja einen neuen Job außerhalb der Stadt gefunden oder hatte sich eine neue Bleibe in einem anderen Stadtteil von Seattle gesucht, so dass er Butch früher oder später unten beim Gewerkschaftsgebäude über den Weg lief.
Aber er würde nicht tatenlos auf ein solches Glück vertrauen. Er rollte sich vom Sofa und steckte seine Autoschlüssel ein. Es war an der Zeit, die Fühler auszustrecken und herauszufinden, wo zum Teufel J.D. abgeblieben war.
Der Gesuchte stand barfuß auf der mit Tau benetzten Veranda seiner Hütte, kratzte die Reste der Crème Brûlée von den Seiten und vom Boden der weiß gemusterten Schüssel, die ihm am Vorabend von Sophie mitgegeben worden war, und leckte anschließend genüsslich seinen Löffel ab. Verdammt, das Zeug war echt gut. Mit einem Blick des Bedauerns auf die leere Schale ging er in die Küche, hielt sie unter fließend Wasser, polierte sie blitzblank, trank den letzten Schluck seines Kaffees und spülte auch die Tasse sorgfältig aus. Dann putzte er sich die Zähne, zog sich fertig an und verließ das Haus.
Heute Morgen herrschte in der Umgebung seiner Hütte nicht annähernd die Stille vom vorherigen Abend. Um ein Haar wäre er mit drei lärmenden Teenies zusammengestoßen, die ihm auf dem Weg zum See entgegengeschossen kamen, und aus Richtung des Wassers drang das laute Juchzen wild planschender Kinder an sein Ohr. Als er das Seeufer erreichte, sah er die Leuchtbojen, von denen Dru gesprochen hatte, gut sichtbar auf dem Wasser wippen. Eins der Ruderboote war innerhalb der Abgrenzung verblieben, eins war fest am Floß vertäut, und die anderen hatte man neben den Motorbooten auf der anderen Seite des Schwimmstegs festgezurrt.
Er ging weiter in Richtung des Lawrenceschen Privatstegs und erklomm den kurzen Weg zu der überdimensionalen Blockhütte oben auf dem Hügel, wo er Sophie in einem der Blumenbeete vor der Veranda knien sah. Sie hatte ihm den Rücken zugewandt, doch der kleine Haufen Unkraut verriet ihm, was sie tat. Momentan jedoch lagen ihre Gartenhandschuhe neben ihr auf dem Boden und sie fächerte sich mit den Enden ihrer aus der Hose gezogenen Bluse heftig frische Luft zu.
Er räusperte sich leise. »Guten Morgen.«
Sie richtete sich fluchend auf, fuhr zu ihm herum und fauchte: »Was sind Sie? Eine verdammte Katze? Schleichen Sie sich gefälligst nicht so von hinten an einen an.«
»Tut mir Leid«, erklärte er mit ruhiger Stimme, während sie den Hemdsaum losließ und sich mit dem Handrücken die puterroten Wangen klopfte.
Dann ließ sie die Hand sinken und erklärte seufzend: »Nein, mir tut es Leid.« Sie rappelte sich hoch, und während er ihr helfend eine Hand bot, gab sie widerstrebend zu: »Diese blöden Hitzewallungen sind schließlich kein Grund, Sie derart anzufahren. In letzter Zeit bin ich so explosiv wie eine Schüssel voll mexikanischer Bohnen und benehme mich oft wie ein boshaftes, durchgedrehtes altes Weib.«
Unweigerlich musste er grinsen. »Das nennen Sie boshaft? Dort, woher ich komme, wird ein solches Benehmen geradezu liebreizend genannt. Sie sollten mal eine Frau namens Gina Dickson kennen lernen. Die ist tatsächlich boshaft.«
Sie blinzelte ihn schweigend an. »Wow«, sagte sie schließlich. »Das sollten Sie häufiger machen.«
»Wie bitte?« Hatte sie, ohne dass es ihm aufgefallen wäre, plötzlich die Frequenz gewechselt?
»Sie sollten öfter fröhlich gucken. Sie haben ein wunderbares Lächeln.«
Er spürte, wie sein Lächeln schwand. Verdammt, er war nicht hierher gekommen, um Vertraulichkeiten auszutauschen. Solange er nicht mehr über diese Leute wusste, wäre das ganz einfach dumm. Er hielt ihr die Puddingschüssel hin. »Hier.«
Sie nahm sie ihm ab, doch als er sich abrupt zum Gehen wandte, fuhr sie ihn an: »Himmel, seien Sie doch nicht so steif. Setzen Sie sich zu mir auf die Veranda und trinken Sie eine Tasse Kaffee. Im Gegensatz zu dem, was Sie anscheinend glauben, sind wir nicht der böse Feind. Und wenn Sie uns wirklich dafür halten, wäre es dann nicht klüger, sich in unser Lager einzuschleichen, um herauszufinden, was für teuflische Pläne wir hinter Ihrem Rücken schmieden?«
Okay, jetzt kam er sich vor wie ein paranoider Idiot. Aber das hieß noch lange nicht, dass sie nicht heimlich irgendetwas gegen ihn im Schilde führten. Trotzdem drehte er sich wieder um und erklärte knurrig: »Dieser Nachtisch war köstlich. Kochen Sie immer solches Zeug?«
»Früher ja. Ich bin ausgebildete Konditormeisterin.« Sie klopfte einladend auf einen alten Schaukelstuhl und lehnte sich, als er endlich Platz genommen hatte, gemütlich in ihrem eigenen Schaukelstuhl zurück. »Ich war hier im Restaurant für die Süßspeisen zuständig, aber letztes Jahr haben Ben und ich beschlossen, ein bisschen kürzer zu treten, um zu gucken, wie uns später mal das Rentnerdasein schmeckt. Also tätigt er inzwischen lediglich die Einkäufe für den Souvenirshop und das Sportgeschäft, und ich backe denen das Brot und kreiere ab und zu ein paar besondere Desserts. Manchmal fehlt mir meine Arbeit und deshalb muss meine Familie bei solchen Attacken als Nachtisch-Opfer herhalten.«
Sie beugte sich nach vorn, nahm eine Tasse von dem auf dem kleinen Korbtisch stehenden Tablett, hielt sie unter die Tülle einer Thermos-Pump-Kanne und reichte ihm den aromatisch duftenden Kaffee. »Haben Sie sich denn schon ein wenig in Ihrer Hütte eingelebt?«
»Ohne jedes Problem.«
»Ich möchte mich bei Ihnen noch für den Zustand des Verandadachs entschuldigen. Wir haben in den letzten Jahren ziemliche Probleme damit, gute Handwerker zu finden. Die besten Leute zieht es früher oder später unweigerlich nach Wenatchee oder Seattle.«
»Das ist schon in Ordnung.« Er zuckte mit den Schultern. »Als ich gestern im Ort war, habe ich die Materialien für die Reparatur bereits besorgt. Ich werde mich an die Arbeit machen, sobald ich weiß, womit ich das Holz zuschneiden kann. Meine Kreissäge habe ich nämlich nicht dabei.«
»Sie wollen das Dach reparieren?« Das Lächeln, mit dem sie ihn bedachte, war von einer solchen Wärme, dass er aufhörte zu schaukeln. »Oh, mein Gott, Sie sind die Antwort auf meine Gebete. Ich bin nicht sicher, was eine Kreissäge ist, aber Ben hat alle möglichen Werkzeuge in seiner Garage. Sie steht immer offen. Und, mein Lieber, vergessen Sie nicht, mir die Quittungen zu geben, damit ich Ihnen das Geld zurückzahlen kann.«
In diesem Augenblick kam Tate, gefolgt von seiner Mutter, den Weg heraufgerannt, und unweigerlich richtete sich J.D. in seinem Sessel auf. In den adretten Shorts, dem gestärkten Polohemd und den blank geputzten Schuhen wirkte sie effizient und vielleicht sogar etwas spröde, er jedoch dachte an das Bild von ihr, mit dem er gestern Abend zu Bett gegangen war: ohne BH und barfuß, mit feuchtem, zerzaustem Haar und zornblitzenden Augen.
Tate kam die Stufen zur Veranda heraufgeschossen. »Hi, J.D.! Wir wussten gar nicht, dass Sie hier sind, nicht wahr, Mom?«
J.D. blieb die Ironie in ihrer Stimme nicht verborgen, als sie am Fuß der Treppe stehen blieb, zu ihnen heraufsah und erklärte: »Nein, ganz sicher nicht.«
Denn andernfalls wärst du ganz sicher nicht gekommen, nicht wahr, Süße?
»Und was bin ich, mein Lieber, dass ich noch nicht mal eines Hallos gewürdigt werde?«, wollte Sophie wissen. »Vielleicht ein Stück alte Leber?«
»Ich wollte dir ja hallo sagen, Oma, aber als ich J.D. gesehen habe, war ich einfach abgelenkt.«
»Du bist für ihn immer die allerfeinste Pastete«, versicherte ihr Dru.
»Oh, Pastete. Dann ist ja alles in Ordnung. Ich hatte schon Angst, ich wäre für ihn das Zeug, aus dem man Katzenfutter macht.«
Die beiden Frauen feixten einander fröhlich an.
»Kann ich ein bisschen fernsehen, Oma?«
»Diese Entscheidung liegt ausschließlich bei deiner Mutter.«
»Mom?«, fragte Tate mit einem gewinnenden Lächeln.
»Meinetwegen. Aber denk daran, dass wir nicht lange bleiben. Und ich will nicht erleben, dass du jammerst, weil du mitten in irgendeiner Sendung abdampfen musst.«
»Okay.« Er rannte ins Haus und warf schwungvoll die Fliegentür hinter sich zu.
Sophie wandte sich wieder an ihre Nichte. »Es überrascht mich, dich um diese Tageszeit zu sehen – auch wenn es mich natürlich freut. Komm rauf. Möchtest du eine Tasse Kaffee?«
»Nein, danke. Ich fürchte, dazu habe ich keine Zeit. Eigentlich bin ich gekommen, weil ich dich um einen Gefallen bitten will.«
»Worum geht’s? Oh, aber ich glaube, du hast J.D. noch gar nicht begrüßt.«
Die Hände in den Hosentaschen, bedachte sie den Neuling mit einem kühlen Blick. »Hallo, J.D.«
»Drucilla«, erwiderte er und durfte mit ansehen, wie sie die Augen zusammenkniff und dadurch viel von ihrer demonstrativen Gelassenheit verlor.
Dann blickte sie erneut auf ihre Tante. »Könnte Tate eventuell für ein paar Stunden bei dir bleiben? Candy hat sich in letzter Minute krank gemeldet, so dass ich die Führung mit den Vertretern des Zahnarztverbandes übernehmen muss.«
»Wann?«
»Jetzt sofort. Sie müssten in zwanzig Minuten hier sein.«
»Oh, Schätzchen, das tut mir wirklich Leid. Ich habe um zehn einen Termin bei Dr. Case, mit dem ich ein paar neue Strategien besprechen möchte, wie ich diese verdammten Stimmungsschwankungen und die Hitzewallungen unter Kontrolle kriegen kann. Und Ben ist beim allmonatlichen Treffen des Jagd- und Angelvereins in Wenatchee und kommt erst morgen früh zurück. Vielleicht ... lass mich überlegen ... o je, wer könnte uns da helfen?« Plötzlich jedoch erhellte ein strahlendes Lächeln ihr Gesicht. »Ich hab’s!« Sie wandte sich an J.D., dessen Magen sich unweigerlich zusammenzog. »Haben Sie nicht gesagt, dass Sie heute Morgen das Dach der Veranda Ihrer Hütte reparieren wollen?«
»Ach tatsächlich?« und »Ja und?«, fragten Dru und er wie aus einem Mund.
»Tja, das ist die Lösung unseres Problems. Tate kann bei Ihnen bleiben und Ihnen dabei helfen. Außerdem wird es sicher nicht länger als zwei Stunden dauern, oder Dru?«
»Nein, aber ...«
»Dann ist ja alles klar«, sagte Sophie in zufriedenem Ton.
J.D.s Schaukelstuhl hielt abrupt im Schaukeln inne. »Ich weiß nicht«, meinte er ablehnend. »Schließlich kennen Sie mich erst seit gestern. Und trotzdem wollen Sie mir einfach einen zehnjährigen Jungen anvertrauen? Verdammt, woher wollen Sie wissen, dass ich kein Mitglied im Landesverband der Pädophilen bin?«
Sophie lachte unbekümmert auf. »Ach, mein Lieber, reden Sie doch keinen Unsinn.«
»Er redet keinen Unsinn«, widersprach ihr Dru. »Schließlich ist er für uns tatsächlich ein Fremder und ich kann nicht sicher sein, ob mein Kind gut bei ihm aufgehoben ist.«
Obgleich dies nur eine Bestätigung seiner eigenen Worte war, machte sie ihn wütend. »Oh, regen Sie sich ab«, raunzte er sie an. »Ich stehe nicht auf kleine Jungs und ich werde Ihrem Kind ganz bestimmt nichts tun. Ich habe nicht gerade viel Erfahrung mit Jungen seines Alters, aber trotzdem werden wir ein paar Stunden miteinander zurechtkommen.«
»Außerdem, was hast du schon für eine Wahl?«, säuselte Sophie mit sanfter Stimme.
»Ich könnte immer noch...« Dru warf einen Blick auf ihre Uhr. »Nein, ich schätze, dazu ist es zu spät.« Und schließlich lag laut polizeilichem Führungszeugnis nichts gegen ihn vor. »Also gut«, erklärte sie mit einem Seufzer, fügte ein widerstrebendes »Vielen Dank« hinzu, erklomm die Stufen zur Veranda und öffnete die Tür. »Tate, ich mache mich wieder an die Arbeit. Du bleibst solange bei J.D.«
»Cool«, kam die abgelenkte Antwort aus dem Wohnzimmer und gleichzeitig wurde die Lautstärke des Fernsehers deutlich hörbar erhöht.
»Er scheint echt beunruhigt zu sein«, erklärte J.D. süffisant und zuckte mit den Schultern. »Aber natürlich war er auch noch nie mit mir allein.«
Drus Augen sprühten blaue Funken. »Lassen Sie diese blöden Witze«, herrschte sie ihn an. »Es kostet mich auch so bereits große Überwindung, meinen Sohn bei jemandem zu lassen, der fast ein Fremder für mich ist. Und ich will verdammt sein, wenn ich mir darüber hinaus noch irgendwelche kranken Bemerkungen anhören muss.«
Da ihr ihre Erregung deutlich anzumerken war und er selber in Tates Alter einen Mord begangen hätte, um eine Mutter zu haben, die auch nur halb so besorgt um ihn gewesen wäre, sagte er mit ruhiger Stimme: »Ja, schon gut. Es tut mir Leid. Gehen Sie ruhig zu Ihrer Führung. Wir kommen schon zurecht.«
»Machen Sie ja keinen Fehler«, drohte sie, machte auf dem Absatz kehrt und marschierte mit langen Schritten über den schmalen Pfad davon.
Muskel für Muskel löste er seine innere Verkrampfung. Nie zuvor in seinem Leben war er jemandem begegnet, von dem er sich derart mühelos aus der Fassung bringen ließ. Er atmete langsam aus, merkte, dass Sophie ihn von der Seite beobachtete, und sagte mit betont lockerer Stimme: »Ich schätze, ich mache besser wirklich keinen Fehler.«
Sie belohnte ihn mit einem breiten Lächeln. »Vielleicht klingt sie ein bisschen fürsorglich...«
Er schnaubte leise. »Sie klingt durch und durch feindselig.«
»Vielleicht. Aber Sie müssen wissen, dass sie über alle Maßen an dem Jungen hängt.«
»Ja, ich müsste ein Idiot sein, um das nicht zu merken.« Er stand auf und blinzelte auf sie herab. »Ich schätze, ich sollte mir den Kleinen schnappen, denn sicher müssen Sie allmählich los.« Er straffte die Schultern und schluckte die leise Angst herunter, die der Gedanke, während der nächsten Stunden die alleinige Verantwortung für das Kind zu haben, in ihm wachrief. Was zum Teufel wusste er schon über zehnjährige Buben? Es war reichlich lange her, seit er selbst in diesem Alter gewesen war.
Als hätte sie seine Gedanken gelesen, erklärte Sophie ihm entschieden: »Ich bin seit beinahe dreißig Jahren im Hotelgewerbe tätig und dank dieser Erfahrung lässt mich meine Menschenkenntnis so gut wie nie im Stich. Mein Lieber, ich bin sicher, dass Sie Ihre Sache prima machen werden.«
J.D. fand Tate lang ausgestreckt auf dem Fußboden vor dem Fernseher vor. »Zeit zu gehen, Kumpel.«
»Noch zehn Minuten, ja? Die Sendung ist sofort vorbei.«
»Habe ich nicht gehört, dass du deiner Mom versprochen hast, diese Entschuldigung nicht anzubringen, wenn sie dich fernsehen lässt?«
Tate blickte grinsend über die Schulter. »Ja, aber das Versprechen habe ich nur ihr gegeben. Zu Ihnen habe ich kein Wort...«
»Schalt die Kiste aus, Kumpel. Wir müssen ein neues Dach für die Veranda vor meiner Hütte bauen.«
»Echt?« Tate drückte auf den Knopf der Fernbedienung und noch ehe der Bildschirm ganz schwarz geworden war, sprang er bereits auf. »Los geht’s!«
Sie gingen in die Garage und J.D. wählte eine Reihe von Werkzeugen aus, darunter eine Säge, bei deren Anblick der Junge ihn begeistert fragte: »Darf ich auch mal etwas sägen?«
Auf dem Weg zurück zur Hütte sprang er wie ein junger Hund um J.D. herum. »Wann müssen wir was schneiden?«
»Später«, sagte J.D. »Erst müssen wir die kaputten Teile von dem Dach entfernen. Und dann bauen wir einen neuen Rahmen.«
Es war ein herrliches Gefühl, endlich wieder zu tun, was er am besten konnte. Er hatte es schon immer als befriedigend empfunden, etwas zu erschaffen, egal, ob er etwas baute oder etwas Altes, Funktionsuntüchtiges nahm und es wieder in alter Schönheit und Funktionalität erstrahlen ließ. Während die Vögel in den Bäumen zwitscherten und die Sonne über der Lichtung vor der Hütte stetig höher stieg, riss er die zerstörten Teile des Daches herunter und warf sie in den Hof. Tate sammelte sie ein, karrte sie zu der ihm von J.D. zugewiesenen Stelle und stapelte sie ordentlich übereinander auf.
Als er sich schließlich wieder vom Dach schwang, war sein T-Shirt unter den Achseln, über der Brust, dem Bauch und am Rücken vollkommen verschwitzt. Er zog es sich über den Kopf, warf es achtlos auf die Seite und verzog den Mund zu einem amüsierten Lächeln, als Tate dem Beispiel folgte und seine schmale, völlig trockene Brust ebenfalls entblößte.
»Du leistest hervorragende Arbeit«, lobte er den Jungen und fuhr sich mit dem Unterarm über die schweißbedeckte Stirn. »Was hältst du von einer Pause?«
Der Kleine ahmte auch diese Geste sofort nach. »Gute Idee.«
Ein paar Minuten später öffnete J.D. den Kühlschrank und wandte sich an Tate. »Wie war’s mit einem Bier?«
Tates Augen begannen zu leuchten und er sah sein großes Vorbild mit dem für ihn typischen strahlenden Lächeln an. »Na klar!«
J.D. griff nach zwei Flaschen Malzbier, reichte eine Tate und stieß fröhlich mit ihm an. »Prost, Kumpel!«
Sie kehrten mit den Getränken zurück in den Hof und setzten sich gemütlich in die Sonne. J.D. nahm einen tiefen Schluck, legte sich rücklings ins Gras, schloss zufrieden seine Augen und stellte die kühle Flasche auf seinen nackten Bauch. Er spürte, dass Tate sofort das Gleiche machte, und konnte nicht verhindern, dass er abermals den Mund zu einem Lächeln verzog.
Eine Zeit lang lagen sie beide schweigend da, dann richtete Tate sich plötzlich auf. »J.D.?«
J.D. spürte, dass das Kind ihn musterte, klappte seine Augen deshalb jedoch nicht auf. »Ja?«
»Sind Sie ein Bastard?«
J.D.s Oberkörper schnellte in die Höhe und er bedachte Tate mit einem kalten Blick. »Hat das deine Mutter über mich gesagt?«
»Nein!« Tate wich so eilig vor ihm zurück, dass er dabei seine Flasche umwarf, deren Inhalt gluckernd auslief. Seine Augen waren schreckgeweitet und seine Lippen bebten, zugleich jedoch reckte er das Kinn auf eine Art nach vorne, die J.D. an seine Mutter denken ließ. »I-ich selber bin ein Bastard, und ich dachte einfach, dass Sie vielleicht, äh, auch ein Bastard sind.«
J.D. wurde starr. Na klasse, Carver, schalt er sich. Du solltest dich bei deinem Geschick mal unten im Schwimmbad blicken lassen. Schließlich gibt es dort jede Menge kleiner Kinder, die du in Angst und Schrecken versetzen kannst.
»Tut mir Leid«, erklärte er mit sanfter Stimme und richtete die umgefallene Flasche wieder auf. Er zuckte zusammen, als Tate erneut vor ihm zurückwich, reichte ihm jedoch freundlich sein Getränk. »Tut mir Leid, Tate. Ich hätte dich nicht derart anfahren sollen.«
»Schon gut.« Nach einem Augenblick erneuter Stille meinte der Junge mit zögerlicher Stimme: »Das war das erste Mal, dass Sie mich mit meinem Namen angeredet haben.«
»Ehrlich?«
Tate setzte sich in den Schneidersitz und nahm einen Schluck von dem übrig gebliebenen Malzbier. Dabei gewann er sichtlich sein gewohntes Selbstvertrauen zurück. »Das war das erste Mal, dass Sie mich Tate genannt haben. Normalerweise nennen Sie mich immer ›Kumpel‹.«
»Ach tatsächlich?«, J.D. fixierte den Jungen. »Weshalb in aller Welt denkst du, du bist ein Bastard?«
»Im Supermarkt unten im Dorf habe ich mal gehört, wie Kathleen Harris das zu Marylou Zeka gesagt hat, und als ich Mom gefragt habe, was das bedeutet, hat sie mir erklärt, das wäre ein unhöfliches Wort, mit dem unwissende Leute mich bezeichnen, weil sie, als ich auf die Welt kam, nicht verheiratet war.« Er legte den Kopf auf die Seite. »Also, sind Sie auch ein Bastard?«
»Ich wurde bereits ziemlich häufig so genannt, obwohl meine Eltern verheiratet gewesen sind.« Der Gedanke, dass Dru ihn nicht als Bastard bezeichnet hatte, brachte ihn ins Schleudern. »Ungefähr fünf Minuten verheiratet«, schränkte er leicht übertrieben ein. »Aber du weißt doch wohl, dass es wesentlich schlimmere Dinge gibt, oder? Deine Mom, deine Oma und dein Opa sind vollkommen verrückt nach dir.«
Tate zuckte mit den Schultern, als wäre die Liebe, die er von diesen Menschen entgegengebracht bekam, das Normalste auf der Welt. »Sicher.«
»Tja, ich hoffe, dass du das zu schätzen weißt, denn das ist sehr viel. Ich hätte ebenso gut ein Bastard sein können, denn mein Vater ist für mich nicht mehr als ein Name, der mehr oder weniger zufällig auf meiner Geburtsurkunde steht. Er und meine Mom waren beide drogenabhängig und er hat uns verlassen, bevor ich auch nur alt genug war, um mich an ihn zu erinnern.«
»Ja, das hat mein Vater auch getan. Er ist abgehauen, als er herausfand, dass meine Mutter mit mir schwanger war. Mom sagt, er war selber noch ein kleiner Junge, und manchmal brechen Kinder bei dem Gedanken, plötzlich eine solche Verantwortung übernehmen zu sollen, in Panik aus.«
Verdammt großmütig von ihr, den Typen zu entschuldigen dafür, dass er sie einfach mit der Verantwortung für den gemeinsamen Nachwuchs allein gelassen hatte.
Tate rutschte unruhig hin und her. »Äh, J.D?«
»Ja?«
»Erzählen Sie Mom nicht, dass ich mit Ihnen darüber geredet habe, ja? Als ich ihr erzählt habe, was Mrs. Harris über mich gesagt hat, hat sie mir zwar erklärt, mein Dad wäre gegangen, weil er Angst hatte und so, aber dabei hat sie ziemlich traurig ausgesehen.«
»Dein Geheimnis ist bei mir sicher, Kumpel.« J.D. stand entschieden auf und zog auch den Jungen auf die Füße. »In der Abstellkammer habe ich einen Altglascontainer gesehen. Lass uns die Flaschen dort reinwerfen. Und was hältst du davon, wenn wir anschließend ein paar Maße nehmen, damit wir endlich anfangen können zu sägen?«