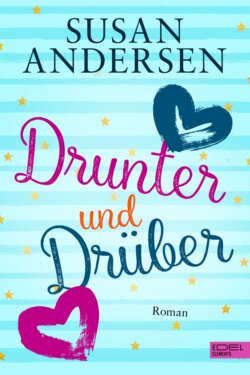Читать книгу Drunter und Drüber - Susan Andersen - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеDru verschränkte ihre Hände im warmen Rücken ihres zehnjährigen Sohnes und sah über seinen Kopf hinweg ihren Onkel an. Er drückte gerade seine Zigarette am Verandapfosten aus. Die Tatsache, dass er vor Tate zum Glimmstängel gegriffen hatte, konnte nur eines bedeuten. »Hat Soph mal wieder einen ihrer schlimmen Momente?« Ihre für gewöhnlich stets gut gelaunte, ausgeglichene Tante war vor ein paar Monaten in die Wechseljahre eingetreten und inzwischen gingen sie ihr alle, wenn sie einen ihrer gefürchteten Stimmungsumschwünge bekam, möglichst aus dem Weg.
»Ihr ist mal wieder total heiß«, erklärte Tate der Mutter. »Und als Opa Ben gesagt hat, sie hätte eine der Spinnweben unter der Decke übersehen, hat sie gefragt, wie es ihm gefallen würde, wenn sie ihn mit diesem Staubwedel den A...«
»Tate!«
»Ich wollte es ja gar nicht sagen.« Obwohl ihm die Vorstellung, das Wort auszusprechen, eindeutig gefiel.
»Ich habe ihn vors Haus gebracht, bevor sie ihren Satz vollenden konnte«, versicherte ihr Ben.
»Aber ich weiß trotzdem, was sie sagen wollte«, meinte Tate mit einem Grinsen, bei dem seine großen Schneidezähne blitzten. »Sie wollte sagen, A...«
»Denk am besten noch nicht einmal daran, mir das Wort dadurch unterzujubeln, dass du es jemand anderem in den Mund legst.«
»Mist.« Mit einem erneuten breiten Grinsen löste er die Beine von den Hüften seiner Mutter, sprang zurück auf die Erde, wandte sich dem Haus zu, entdeckte J.D. und betrachtete ihn mit großen Augen. »Hi. Ich bin Tate. Und wer sind Sie?«
»Tut mir Leid, J.D. Wo bleibt mein Benehmen?« Auch wenn es kaum zu glauben war, hatte Dru den Typen tatsächlich kurzfristig vergessen. »Das ist mein Sohn Tate. Tate, das ist Mr. Carver.«
»J.D.«, verbesserte er sie und reichte dem Jungen eine schwielige Hand. »Wie geht’s, Junge?«
»Super.« Tate ergriff die ihm gebotene Hand und verzog so schmerzlich das Gesicht, dass Dru sofort erkannte, dass er J.D.s Knöchel zu Staub zermahlen wollte. Immer, wenn er Hände schütteln konnte, fühlte er sich wunderbar erwachsen. Nur war ihm nicht klar zu machen, dass ein normal fester Griff genügte, um zu zeigen, dass er ein echter Mann war. In Bezug auf Frauen schien er das Konzept durchaus zu verstehen, doch sobald ein Mann die Hand ausstreckte, erlag er der Versuchung zu beweisen, dass er ein eisenharter Kerl war.
Da J.D. bisher nicht unbedingt der Inbegriff von Freundlichkeit und Kumpanei gewesen war, beeilte sich Dru zu sagen: »Und das hier ist mein Onkel Ben Lawrence. Onkel Ben, J.D. ist einen Tag früher angekommen.«
»Das sehe ich.« Ben kam von der Veranda herunter. »Tate, hör bitte auf zu versuchen, ihm sämtliche Knochen im Handrücken zu brechen – ich habe dir doch schon erklärt, dass das nicht nötig ist. Und jetzt geh bitte ins Haus und sag deiner Oma, dass J.D. hier ist.« Als Tate sich zum Gehen wandte, wuschelte er ihm zärtlich durch das glänzende braune Haar. »Aber sei auf der Hut. Womöglich ist sie ja noch auf dem Kriegspfad.« Sein Blick folgte dem Jungen, der sein Schwert vom Boden aufhob und vorsichtig zur Tür trabte, schließlich wandte er sich an J.D. und reichte ihm die Hand. »Willkommen in der Star Lake Lodge.«
Dru verfolgte, wie die beiden Männer einander musterten. Ihr Onkel war älter und weniger durchtrainiert als der Mann aus Seattle, doch für sein Alter sah er fantastisch aus. Inzwischen ging er in den Hüften ein wenig auseinander und seine Schultern waren nicht mehr ganz so muskulös wie in jungen Jahren, aber sein grau meliertes Haar lag immer noch in dichten Locken um sein freundliches Gesicht und seine braunen Augen wurden infolge häufigen Lächelns von zahllosen Lachfalten gerahmt.
Eine Art von Falten, die J.D. ganz sicher nie bekam. Er erwiderte Bens Händedruck mit der ernsten Reglosigkeit, die Dru schon an ihm kannte, beantwortete höflich seine Fragen, sprach jedoch kein Wort, um die gegenseitige Vorstellung ein wenig zu erleichtern. Es war, als hinge ein großes Zutrittverboten-Schild um seinen Hals, und das brachte Dru aus irgendeinem Grund entsetzlich auf die Palme. Glücklicherweise kamen Tate und Tante Sophie aus der Hütte, ehe sie sich vergaß und etwas unverzeihliches Rüdes zu ihm sagte.
Dru war ehrlich erschüttert, weil sie auch nur versucht war, so etwas zu tun. Was hatte dieser Kerl nur an sich, das sie ihre hart erarbeitete Selbstbeherrschung einfach vergessen ließ? Dieses beinahe übermächtige Verlangen, ihn zu einer Reaktion zu reizen, war sicherlich nicht gut.
»Oma Sophie ist wieder sie selbst«, verkündete Tate mit gut gelaunter Stimme, während er seine Großtante an der Hand in Richtung des kleinen Grüppchens auf die Lichtung zog. »Ich glaube nicht, dass sie Opa Ben noch länger mit dem Staubwedel den A...«
» Tate!«
Unbeeindruckt von der entnervten dreistimmigen Warnung zuckte er gelassen mit den Schultern und bedachte seine Oma ehrenhalber mit einem Blick aus seinen laserblauen Augen. »Das willst du doch nicht mehr, oder?«
»Nein«, stimmte Soph ihm trocken zu. »Ich kann mit Sicherheit sagen, dass der Impuls verflogen ist.« Sie trat neben ihren Gatten, schlang ihm einen ihrer Arme um die Taille, tätschelte ihm mit ihrer freien Hand die Brust und murmelte zerknirscht: »Tut mir Leid, Ben.«
»Ich weiß, Baby.« Er legte einen Arm um ihre Schulter und zog sie eng an sich heran.
Dru war sich der Tatsache bewusst, dass J.D. nach wie vor vollkommen reglos an ihrer Seite stand, und sie versuchte, ihre Tante und ihren Onkel durch seine Augen zu sehen.
Sie lebte schon so lange und so gerne bei den beiden, dass sie sie nicht unvoreingenommen sehen konnte, doch selbst nach all den Jahren rief ihre gegenseitige Nähe warme Freude und gleichzeitig eine gewisse Wehmut in ihr wach. Es gehörte einfach zu ihrer Beziehung, dass sie ständig geradezu magisch voneinander angezogen wurden. Allerdings war es keine Beziehung, die andere ausschloss – ihre natürliche Wärme erstreckte sich auf jeden, der ihnen am Herzen lag.
Drus Eltern hatten als rastlose Menschen sämtliche Erdteile bereist. Eine ihrer frühesten Erinnerungen an die zwei war die, dass sie sie bei Tante und Onkel abgegeben hatten, um sich die Welt ansehen und etwas Neues und Aufregendes ausprobieren zu können. Als sie in die Schule gekommen war, hatte sie stets den Moment gefürchtet, an dem sie mittags aus dem Bus gestiegen war. Sie hatte nie gewusst, ob, und wenn ja, wer sie dort erwartete. Manchmal hatte einer ihrer Eltern dort gestanden, meistens jedoch hatte eine Nachbarin sie netterweise zusammen mit ihren eigenen Kindern mitgenommen oder sie hatte sich alleine auf den Weg gemacht. Bereits lange bevor ihre Eltern, als sie neun gewesen war, in den Anden einen tödlichen Unfall mit einem Heißluftballon erlitten hatten, hatten Sophie, Ben und die Star Lake Lodge für sie Sicherheit und Geborgenheit repräsentiert.
Der vertraute Anblick der an Ben gelehnten Sophie zauberte ein Lächeln auf Drus Gesicht. Ihre einundfünfzigjährige Tante sah aus wie Anfang vierzig. Mit ihrer drallen Figur, ihren schimmernden Haaren und ihrem leuchtenden Teint zog sie noch immer die Augen selbst junger Männer auf sich. Ihre strahlende Erscheinung hätte einem Furcht einflößen können, wäre da nicht gleichzeitig die ständige Bereitschaft zu einem warmen, einladenden Lächeln gewesen.
Auch jetzt trat sie mit einem breiten Lächeln und ausgestreckten Armen auf den Neuankömmling zu. »Willkommen«, sagte sie und umfasste herzlich seine Pranken. »Schade, dass ich bei Ihrer Ankunft nicht im Hotel war, um Sie zu begrüßen. Dru, meine Liebe, hast du ihm schon gezeigt, wie er mit seinem Wagen zum Auspacken bis hierher an die Hütte fahren kann?«
»Nein, aber ich kann es jetzt tun, wenn er möchte.« Druwandte sich an J.D. und zog fragend eine Braue in die Höhe.
Er zuckte mit seinen muskulösen Schultern. »Nicht nötig«, erklärte er ihr brüsk. »Ich habe alles, was ich brauche, bei mir.« Er nickte in Richtung der Leinentasche, die einen Meter neben ihm auf der Erde stand.
Sophie strahlte. »Also gut, dann. Hätten Sie vielleicht gern ein bisschen Zeit für sich, um Ihre Sachen auszupacken und sich einzurichten?«
»Ja, das wäre gut«, antwortete er, fügte jedoch nach kurzem Zögern ein leises »Vielen Dank« hinzu.
»Dann werden wir jetzt gehen. Tate! Komm mit, Schätzchen.«
Der Junge kam fröhlich angerannt. »Kann ich jetzt vielleicht schwimmen gehen? Es ist schon fast drei und dieser Dean aus Zimmer Zweihundertelf hat gesagt, er wäre ab drei unten am See.«
Als Dru hinter Sohn, Tante und Onkel den Weg hinunterlief, sah sie sich noch einmal nach ihrem neuen Partner um. Die Hände in den Hosentaschen, stand J.D. reglos und mit zusammengepressten Lippen mitten auf der Lichtung. Er wirkte ein bisschen einsam, ja beinahe ... verloren.
Mit einem leisen Schnauben drehte sie sich wieder um und folgte Tate, der sich, während er mit seinem Plastikschwert die Luft durchtrennte, vergnügt mit Ben und Sophie unterhielt. Na, sicher.
Einen absurderen Gedanken hatte sie garantiert seit zig Jahren nicht mehr gehabt.
J.D. warf seine Tasche auf das breite Bett und schaute sich um. In der kleinen Hütte gab es ein Schlafzimmer, ein Bad, eine winzige Küche und ein Wohn-Esszimmer, dessen beide Hälften durch eine Bogentür mit eingebauten Buchregalen voneinander getrennt waren. Er hatte alles, was er brauchte, und jemand – wahrscheinlich Sophie Lawrence – hatte sogar eine Vase mit frischen Blumen auf den kleinen Esszimmertisch und eine auf den Tisch im Schlafzimmer gestellt. Etwas an diesem heimeligen Szenario rührte ihn tatsächlich an.
Die Hütte war offensichtlich erbaut worden, ehe vom Holz-Raubbau die Rede gewesen war, und er sah bewundernd auf die kunstvoll ineinandergefügten Wandbretter, die Hartholzböden und die Tür- und Fensterrahmen aus dem Holz einheimischer Föhren. Dann wandte er seine Aufmerksamkeit seiner auf der verblichenen Patchwork-Tagesdecke liegenden Tasche zu und zog einen Stapel weißer T-Shirts, Unterwäsche, Jeans, Rasierzeug und ein paar seiner kostbareren Werkzeuge daraus hervor.
Als Letztes strichen seine Fingerspitzen über den am Boden der Tasche liegenden Stapel alter Briefe. Behutsam nahm er sie heraus und starrte auf den in Edwinas zittriger Handschrift adressierten obersten Umschlag.
Er wusste überhaupt nicht, weshalb er ihre Briefe all die Jahre aufgehoben hatte. Bis auf die ersten hatte er sie bisher nicht einmal geöffnet, denn er ahnte, was in ihnen stand: nämlich, dass Edwina ihm verziehen hatte.
Und zwar ein Verbrechen, das er nicht begangen hatte, was wirklich verdammt großzügig von ihr gewesen war. Abermals erbost über dieses alte, ihm zugefügte Unrecht warf er das mit einem Gummiband zusammengehaltene Bündel in den neben dem Nachttisch stehenden Papierkorb und stürmte aus dem Zimmer.
Eine Minute später jedoch war er zurück und fischte die Briefe wieder heraus. Ihm war zwar nicht klar, warum – er wäre nämlich ein wesentlich glücklicherer Mensch, wenn es ihm endlich gelänge, diesen Teil seines Lebens als den Ballast abzuwerfen, der er schließlich war. Aber irgendwie hing er selbst nach all diesen Jahren noch daran. Also beförderte er die Briefe zurück in die Tasche, verstaute sie im Schrank und schloss nachdrücklich die Tür.
Leider hieß aus den Augen nicht automatisch aus dem Sinn. Er zog die goldene Uhr von Edwinas Vater aus der Tasche, strich vorsichtig mit dem Daumen über den mit einer Gravur verzierten Deckel, drückte auf das winzige Knöpfchen an der Seite, klappte den Deckel auf, betrachtete das Zifferblatt, und vor seinem geistigen Auge tauchten Szenen aus seinem früheren Leben auf. In dem Versuch, die unwillkommenen Erinnerungen endgültig zu verdrängen, klappte er den Deckel schnaubend wieder zu und schob die Uhr zurück in seine Jeans. Das erste Mal hatte er Edward Lawrences Uhr an dem Tag gesehen, als er von Edwina mit heimgenommen worden war. Die Uhr hatte auf einer ledergebundenen Kladde auf einem antiken Schreibtisch im Arbeitszimmer gelegen.
Ein so wunderbares Stück hatte er nie zuvor gesehen. Er hatte gefunden, die Uhr sähe aus, als gehöre sie einem wirklich reichen Menschen, und das hatte ihm gefallen. Noch stärker jedoch war er vom Alter der Uhr angezogen worden – auch wenn er nicht hätte in Worte fassen können, was ihm daran so gefiel.
Erst als Erwachsenem war ihm bewusst geworden, dass es die Beständigkeit gewesen war, die das Stück repräsentierte, die Tatsache, dass es sich über zwei Generationen hinweg im Besitz ein und derselben Familie befunden hatte, von der er derart beeindruckt gewesen war. Er selbst hatte seinen Vater nie gekannt, und für seine Mutter war der Konsum von Drogen weitaus wichtiger gewesen als der eigene Sohn, so dass er allein von der Vorstellung einer Familie, die ihre Kinder nicht nur versorgte, sondern obendrein noch Dinge aus den Leben der einzelnen Personen extra für sie aufhob, regelrecht überwältigt worden war. Vor seinem Einzug bei Edwina hatte er nie auch nur einen einzigen Gegenstand besessen, und schon gar nichts, was ihm von einem seiner Ahnen hinterlassen worden war.
Edwina hatte das geändert und während einiger Monate hatte er das Gefühl gehabt, als lebe er in einem Traum. Sie hatte ihn behandelt, wie man seiner Vorstellung nach eigene Kinder behandelte. Weshalb ihn der Verrat am Ende umso schmerzlicher getroffen hatte, als plötzlich Edwards Uhr verschwunden und er von ihr beinahe des Diebstahls bezichtigt worden war. Das hatte er ihr nicht verziehen, und – so lächerlich es in den Augen anderer vielleicht war – der Geist dieser Empörung lebte wie atomarer Abfall mit einer endlosen Halbwertszeit in seinem Innern fort.
Falls es also eines gab, was er ganz sicher wusste, dann, dass die Lawrences, auch wenn sie sich wie anständige Menschen gaben, ihren Anspruch auf ein wertvolles Besitztum, wie damals die Uhr und jetzt dieses Hotel, ganz sicher nicht so frohen Herzens aufgaben, wie sie ihn glauben machen wollten. Er stapfte aus der Hütte, schlug die Tür hinter sich zu und marschierte über den Pfad zurück in Richtung des Hotels.
Sie führten bestimmt irgendwas im Schilde. Und er hatte die Absicht, herauszufinden, was.
Noch während die Empfangsdame Dru darüber informierte, dass J.D. auf dem Weg zu ihrem Büro war, wurde auch schon die Tür geöffnet und er trat unaufgefordert ein. Sie verfolgte, wie er die Tür hinter sich schloss, und sagte in den Hörer: »Die Nachricht kam ein bisschen spät, aber trotzdem vielen Dank. Da ich Sie aber gerade am Apparat habe, Joy, würden Sie wohl bitte der Hauswirtschafterin sagen, dass ich ihren Bericht schon heute Nachmittag auf dem Tisch haben möchte? Die Kaffeepäckchen werden zu spät in den Zimmern ausgelegt und ich muss wissen, welchen Grund es dafür gibt.« Sie legte den Hörer zurück auf die Gabel und hakte den Posten »Hauswirtschafterin« auf ihrem Zettel ab.
Dann erhob sie sich trotz ihres beschleunigten Herzschlags langsam von ihrem Stuhl und sah ihn höflich lächelnd an. »Hallo, J.D. Sie brauchen sicher irgendetwas für Ihre Hütte, oder?«
»Nein, ich bin der Bücher wegen hier.«
Seine Antwort kam so unerwartet, dass sie ihn mit großen Augen musterte. »Wie bitte?«
»Die Bücher. Sämtliche finanziellen Unterlagen über das Hotel. Ich bin sicher, Sie haben schon mal etwas davon gehört.«
»Ich weiß, was Bücher sind.« Sie schüttelte den Kopf, kam hinter ihrem Schreibtisch hervor und trat vor einen Schrank. »Ich suche sie Ihnen raus.«
»Beide Sätze.«
Sie nahm eine geradezu militärisch straffe Haltung an und fuhr zu ihm herum. »Ich weiß nicht, mit was für Unternehmen Sie es für gewöhnlich zu tun haben, Mr. Carver, aber hier in der Star Lake Lodge gibt es nur einen Satz Bücher, und diese werden tadellos geführt.«
Er machte einen Schritt nach vorn und plötzlich schrumpfte ihr Büro auf eine einzige Wand, die nur aus seinen Schultern und seiner breiten Brust zu bestehen schien. Sie reckte das Kinn, doch gleichzeitig wich sie unwillkürlich vor ihm zurück. Es machte sie wütend, dass es ihm so mühelos gelang, sie einzuschüchtern, und so blieb sie, als er sich prompt noch näher an sie heranschob, wie angewurzelt stehen. »Wollen Sie mich vielleicht quer durch mein Büro verfolgen?«, fragte sie mit kühler Stimme, dann jedoch verlor sie die Beherrschung und sie fauchte: »Wer zum Teufel hat Ihnen eigentlich Manieren beigebracht? Ganz sicher nicht Großtante Edwina.«
In seiner Wange zuckte ein kleiner Muskel. »Nein, das, was ich von Edwina gelernt habe, ist, dass man nichts auf irgendwelches Gerede geben soll, weil nämlich der einzige Mensch, auf den man sich wirklich verlassen kann, immer man selber ist.«
»Ach ja? Sie müssen schon entschuldigen, wenn ich nicht in Tränen ausbreche, weil Sie von ihr derart schlecht behandelt worden sind. Ich habe nämlich den Eindruck, dass Edwina nicht nur geredet hat, denn schließlich sind Sie hier, oder etwa nicht? Und zwar als hälftiger Eigentümer unseres Hotels.«
Er schob sich tatsächlich noch dichter an sie heran. »Und das schmeckt dir gar nicht, Süße, habe ich nicht Recht?«
Sie hielt es für besser, verstünde sie ihn falsch. »Dass Sie schlecht über die Frau reden, von der Ihnen so viel hinterlassen worden ist?« Sie ignorierte ihre Reaktion auf seine Nähe und reckte abermals das Kinn. »Ja, Sie haben Recht, das finde ich geschmacklos.«
Seine Augen blitzten auf, was Dru mit Genugtuung erfüllte, weil es ihr endlich gelungen war, ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen. Das war nur fair, denn schließlich hatte er sie bereits mehr als einmal völlig aus dem Gleichgewicht gebracht.
Sein Blick wurde wieder kühl und distanziert. »Tja, sehen Sie, so ist es nun mal mit uns Typen aus der Gosse«, knurrte er. »Wir saugen Geschmacklosigkeit quasi mit der Muttermilch in uns auf und einziges Ziel in unserem Leben ist es, etwas zu bekommen, ohne eine Gegenleistung dafür erbringen zu müssen.« Er strich mit einer rauen Fingerkuppe über ihre Wange und ließ eine brennend heiße Spur auf ihrer Haut zurück.
Dru riss ihren Kopf nach hinten, doch er wich keinen Millimeter. »Und es ist uns vollkommen egal, wem wir dabei auf die Füße treten müssen«, erklärte er ihr leise. »Das sollten Sie sich merken.« Sein Daumen strich über ihre Unterlippe, doch ehe sie ihm auf die Finger schlagen konnte, zog er seine Hand zurück und sah sie mit einem unverschämten Lächeln an, das ihr zeigte, dass mit seinen Zähnen alles in Ordnung war. Wenn auch eventuell ein wenig schief, waren sie doch strahlend weiß und wirkten durch und durch gesund.
Als sie ihm wieder in die Augen blickte, zog er eine Braue in die Höhe. »Was ist jetzt mit den Büchern?«
Mit wild pochendem Herzen öffnete Dru die Schranktür, zog die Ordner heraus und drückte sie ihm zornig in die Arme. »Hier. Das sind die letzten drei Jahre. Machen Sie sie nicht schmutzig und verlieren Sie sie nicht.«
»Dann esse ich meine Erbsen wohl besser nicht wieder mit dem Messer.«
Verlegen, weil sie derart unhöflich gewesen war, verzog sie sich wieder auf ihren Stuhl, schnappte sich einen Bleistift und trommelte in der Hoffnung, sich den Anschein einer Frau zu geben, die keine Zeit für derartigen Unfug hatte, ungeduldig damit auf der Tischplatte herum. »Passen Sie halt einfach auf die Bücher auf.«
»Sehr wohl, Ma’am.« Er salutierte und schlenderte dafür, dass er mehrere Pfund Leder an den Füßen hatte, erstaunlich geschmeidig aus dem Raum.
Dru saß noch lange kochend hinter ihrem Schreibtisch. Sie und J.D. kamen ganz eindeutig nicht miteinander zurecht, aber sie hatte das grässliche Empfinden, als wäre sein unerträgliches Benehmen im Vergleich zu den Gefühlen, die er in ihr wachrief, ein eher geringfügiges Problem.
O Mann, diese Sache gefiel ihr ganz und gar nicht. In ihrem ganzen Leben hatte sie bisher nur auf Tates Vater ähnlich leidenschaftlich reagiert. Doch selbst Tony hatte ein deutlich schwächeres Verlangen in ihr wachgerufen, und bereits das hatte sie an den Rand des Verderbens geführt.
Sie war damals achtzehn Jahre alt und zum ersten Mal, seit Ben und Sophie sie bei sich aufgenommen hatten, aushäusig gewesen. Das College hatte aufregend und viel versprechend angefangen. Sie war sich so erwachsen vorgekommen, und als sie sich am Ende ihres ersten Jahres in Tony verliebte, hatte sie sich eingebildet, besser könne ihr Leben nicht mehr werden. Das erste Mal fort von zu Hause und schon hatte sie die Liebe ihres Lebens gefunden.
Während des gesamten zweiten Collegejahres waren sie und Tony unzertrennlich gewesen. Sie hatten alles zusammen unternommen: gelernt, gespielt, geredet, gelacht und sich geliebt. Himmel, wie hatten sie sich geliebt! Streit hatte es nie zwischen ihnen gegeben und sie hätte geschworen, dass ihre Beziehung im Himmel geschlossen worden war. Dann hatte sie am letzten Tag der Frühjahrsprüfung festgestellt, dass sie ein Kind erwartete.
Und dass ihre Beziehung zu dem guten Tony doch nicht im Himmel geschlossen worden war. Denn bereits am nächsten Tag hatte er sich heimlich aus dem Staub gemacht.
Sie war allein zurückgeblieben und hatte sich die größten Vorwürfe gemacht. Sie hatte kaum glauben können, dass sie derart unvorsichtig gewesen und dass der Traum von einer wunderbaren Zukunft nunmehr begraben war. Sie hatte mit morgendlicher Übelkeit gekämpft, sich gefragt, wie es mit ihrem Leben weitergehen sollte, und entsetzliche Angst davor gehabt, Tante und Onkel zu beichten, wie naiv und sorglos sie gewesen war.
Während der quälenden ersten drei Wochen hatte sie, voll der Abneigung gegen das ungewollte Baby, ernsthaft mit dem Gedanken an eine Abtreibung gespielt. Das war ihr als die praktischste Lösung erschienen: Sophie und Ben würden niemals erfahren, wie verantwortungslos sie sich gebärdet hatte, und sie nähme einfach ihr altes Leben wieder auf. Doch ihr Gefühl hatte ihr etwas anderes geraten ...
Also hatte sie allen Mut zusammengenommen und Tante und Onkel gebeichtet, dass sie Mutter werden würde.
Sie hatten sich wunderbar verhalten. Sie hatte sich davor gefürchtet, die Enttäuschung in ihren Augen zu sehen, aber sie hatten sie, ohne auch nur ein Wort über die von ihr begangene Dummheit zu verlieren oder etwas auf das Geschwätz der Leute in ihrem winzigen, hinterwäldlerischen Dorf zu geben, nach Kräften unterstützt. Und Tate wurde die wirkliche große Liebe ihres Lebens – sie hatte ihre Entscheidung, ihn alleine aufzuziehen, nicht eine Sekunde bereut. Trotzdem war es nicht gerade einfach gewesen, und sie hatte gelernt, in Gefühlsdingen äußerst vorsichtig zu sein. Niemals wieder wollte sie ihr Leben derart aus den Fugen geraten lassen wie damals vor elf Jahren.
Aus diesem Grund war ihr egal, was für eine heiße Nummer dieser J.D. Carver war, und dass ihr Herz einen Hüpfer machte und sie weiche Knie bekam, sobald sie ihn nur sah. Er würde nicht einfach hier hereinschneien und das angenehme, sichere Leben durcheinanderbringen, das sie für sich und ihren Sohn aufgebaut hatte und das ihr nahezu heilig war.