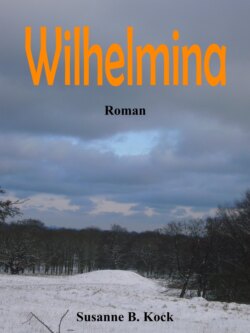Читать книгу Wilhelmina - Susanne B. Kock - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.
ОглавлениеDer kleine Junge im Anorak mit den blauweiß gestreiften Osh-Kosh Latzhosen rutschte ungeduldig auf dem Sitz herum und baumelte deutlich gelangweilt mit den Beinen, die in neuglänzenden Gummistiefeln steckten. Marthes Schätzung nach konnte er nicht viel älter als 3 Jahre sein. So in etwa. Bei der altersmäßig korrekten Bestimmung ihrer Mitmenschen hatte sie meistens Schwierigkeiten, eine Schwäche, die ihr regelmäßig giftige Blicke und spitze Bemerkungen einbrachte. Was sie dagegen ohne Probleme konstatieren konnte war, dass der Junge erkältet war. Seine runden braunen Augen glänzten fiebrig, er schniefte lautstark, hustete und nieste und stippte wieder und wieder seinen kleinen nassglänzenden Zeigefinger in den klaren Schleim unter der Nase. Danach leckte er den Finger geräuschvoll ab. Seine Mutter auf dem Nebensitz war in die neuesten Ausgabe der freundin versunken und kommentierte die Vorgänge mit einem ebenso regelmäßigen wie fruchtlosen „Andi Süßer, lass das, putz dir die Nase“, ohne dabei die Aufmerksamkeit vom Heft abzuwenden oder ihren Sprössling mit einem Taschentuch zu versehen. Nach dem dritten breit gefächerten Sprühregen vom gegenüberliegenden Sitz, kramte Marthe mit einem aufgebenden Seufzer ein fast sauberes Tempo aus der Tasche und reichte es dem Kleinen mit einem auffordernden Lächeln. „Sag danke zu der Tante,” klang es vom Nebensitz, die freundin senkte sich einige Zentimeter, ein freundliches Lächeln wurde in Richtung Marthe entsandt, woraufhin der mütterliche Kopf erneut hinter so viel versprechenden Überschriften wie Scheidung - was nun? Entschlacken, entwässern, entspannen - sanfter Kampf den Kilos! verschwand. Marthe lehnte sich soweit wie möglich in ihrem Sitz zurück, um dem nächsten Virennebel auszuweichen und starrte mangels Lektüre aus dem Fenster, direkt in die Finsternis des U-Bahntunnels. Das war jetzt das dritte Mal in diesem Monat, dass der Wagen nicht ansprang, der Weg in die Werkstatt war wohl unumgänglich. Ob sich das Rumreparieren überhaupt noch lohnte? Vielleicht sollte sie doch lieber einen Neuen kaufen, damit sie endlich Ruhe vor diesen ewigen unerwarteten Rechnungen hatte. Rechnungen! Marthe schloss die Augen und visualisierte den letzten Kontoauszug. Wenig aufmunternd oder wie Hamann bei unzureichenden Prästationen seiner Mitarbeiter mit lispelndem Sprühregen auszustoßen pflegte einfach un-ttsssu-frieden-ssstellend! Mein Gott Hamann, die niederträchtige alte Schlange. Wenn sie ihn auch in dem für morgen anberaumten Gespräch nicht zu einer passenden Gehaltserhöhung bewegen konnte, dann musste sie sich wohl ganz ernsthaft nach einer neuen Firma umsehen, um mehr Geld zu verdienen. Beförderungen waren in Ordnung, aber Beförderungen ohne entsprechende gehaltliche Konsequenzen waren unakzeptabel. Und die Gehaltserhöhung, die mit ihrer Ernennung zur Bereichsleiterin Marketing erfolgt war, konnte wirklich nur als Witz bezeichnet werden. Zum x-ten Mal malte sie sich das Gespräch mit Dr. Frode Hamann, ihrem Boss und dem technischen Leiter der Medinex AG aus. Er würde wieder mit seinem jovialen ich-wollte-ich-könnte Ihnen-in-dieser-Sache-entgegenkommen-Lächeln im ergonomisch korrekten dreh- und wippbaren lederbezogenen Schreibtischstuhl sitzen, die Fingerspitzen gegeneinander pressen und seine vollen Lippen zu einem spitzen Kussmund formen, der Marylin Monroe neidisch gemacht hätte. Oder seine plumpe, teigigweiße Hand mit den manikürten Fingern liebkosend über das dichte, pechschwarze und garantiert gefärbte Haar fahren lassen. Ab und zu würde er mit Daumen und Zeigefinger die Spitzen seines affigen Schnurrbartes bearbeiten und ihr dabei interessiert-betrübt in die Augen schauen. Sie hingegen würde auf dem designmäßig korrekten, aber unbequemen Besucherstuhl hocken und sich wie immer zusammennehmen müssen, um ihm nicht den Plastikbecher mit dem bitteren Kaffee ins Gesicht zu schleudern. „Sie kennen ja unsere finanzielle Situation Fräul… ähh Frau Twiete, mir sind da einfach die Hände gebunden.” Marthe kannte die finanzielle Situation der Firma und wusste, dass die paar Tausend mehr im Jahr, die für die Firma nichts, aber für sie sehr viel bedeuteten, aus Prinzip abgelehnt wurden. Er wollte sie dazu bewegen, selbst zu kündigen. Frode Hamann hatte mit allen Mitteln versucht, ihre Beförderung zu verhindern, hatte dabei aber beim alten Schneider, Direktor von Gottes und eigenen Gnaden wie ihn die Mitarbeiter nannten, auf Granit gebissen. „Sie ist tüchtig, sie ist effektiv, sie hat die Abteilung im Griff und was am wichtigsten ist - die Kunden lieben sie. Und außerdem Hamann”, hatte Schneider mit einem pfiffigen Grinsen hinzugefügt, „wir müssen ja hier auch mit der Zeit gehen, können doch auf Dauer nicht mit einer einzigen Frau im Personalbereich leben, nicht wahr. So jetzt mal nicht so negativ, ihr rauft euch schon zusammen, sie ist ja immer noch eine Etage unter dir.” Schneider hatte Hamann aufmunternd zugenickt und demonstrativ zur Lesebrille gegriffen. Das war's, die Unterredung war beendet und Hamann hatte sich geflissentlich entfernt, mit dem verbindlichen Lächeln intakt, unter dem er in der Firma die vielen Gefühlsregungen, die sich trotz aller Anstrengungen seinerseits nicht gänzlich unterdrücken ließen, verbarg. „Eine Etage unter mir”, schnaubte er, als er sich außer Hörweite des Chefbüros wähnte. „Wenn's nach mir ginge, wäre die im zweiten Deck der Tiefgarage … als Parkscheinentwerter, hahaha.“ Hamann musste lachen, so gut fand er seinen eigenen Witz. Schade, dass er ihn gerade niemandem weitererzählen konnte.
Die Wärme der vollaufgedrehten Heizung, das Vibrieren der Elektromotoren und die müde Stille der vornehmlich lesenden Mitpassagiere im Wagen ließen Marthe dösig werden. Eigentlich gar nichts so schlecht mit der U-Bahn, einfach reinsetzen und fahren lassen. Entspannender als mit dem Auto im Stau zu stehen. Sie lehnte den Kopf gegen die Wand und schloss erschöpft die Augen. Vielleicht sollte sie sich selbst und Hamann den Gefallen tun und kündigen. Wenn sie es sich recht überlegte, hatte sich der Nervenkrieg mit Hamann allmählich negativ auf die meisten Bereiche ihres Lebens ausgewirkt und das hatte sie gründlich satt. Morgens stellte sich immer seltener das beschwingte Gefühl ein, mit dem sie in der ersten Zeit zur Arbeit gefahren war. Statt positiver Adrenalinstösse Überproduktion von Magensäure. Sie hatte sich bereits ein paar Mal dabei erwischt sich vorzustellen, auf welche Weise sie ihm ihre Kündigung präsentieren würde.
Phantasievorstellungen dieser Art waren geistige Lachsbrötchen, Balsam für ihr lädiertes Ego, brachten sie in der Realität jedoch keinen Schritt weiter. Aber von irgendetwas musste sie ja schließlich leben und sie hatte keine Ahnung, wie lange es dauern würde, eine neue Stelle zu finden. Die Wirtschaft klagte über fehlende Aufträge, stagnierende Umsätze. Aber das hatte sie eigentlich schon immer getan, egal ob die Konjunktur gut oder schlecht war. Sie würde ihre Firma nicht groß vermissen und ihre Firma würde sie ebenfalls kaum lange vermissen. Im Feld der umtriebigen männlichen Endzwanziger mit den großen Armbewegungen und dem richtigen Aftershave dürfte es kaum Schwierigkeiten bereiten, schnell ihren Nachfolger finden. Die naive Vorstellung, dass die Firma am persönlichen Wohl ihrer Mitarbeiter interessiert war, sie förderte, nach individuellem Einsatz und Verdienst beurteilte, hatte Marthe bereits nach dem ersten Jahr gründlich revidieren müssen. Wenn man nach oben wollte, eine Karriere anstrebte, dann erforderte das einen guten Draht zur Leitung und hier waren gemeinsamer Hintergrund oder gemeinsame Interessen mit dem Vorgesetzten ausschlaggebender als fachliche Kompetenz. Manchmal stand die fachliche Kompetenz sogar dem Aufstieg direkt im Weg, weil sie seitens des Vorgesetzten als potentielle Bedrohung für die eigene Stellung angesehen wurde. Mitgliedschaften im richtigen Tennis- oder Segelklub, diskretes Namedropping in den unformellen Gesprächen zu Firmenfeiern und bei den großen Events. Das waren die Erfolg versprechenden Strategien. Und natürlich das unablässige Verbinden des eigenen Namens mit geglückten Projekten. Egal ob jährlicher Firmenausflug oder internationale Fachmesse, das Ziel war erst erreicht, wenn man seinen Namen mit diesem Projekt verknüpft und bei den richtigen Leuten in Erinnerung gebracht hatte. Später galt es natürlich gegenüber denen, die einem behilflich gewesen waren, die gute Botschaft weiterzuverbreiten, Dankbarkeit und Loyalität zu zeigen. Selbstverständlich nur bis zu einem gewissen Grad. Spätestens, wenn man sich daran machte, den Stuhl seines Mentors zu erobern, war es angeraten - natürlich unter Einhaltung eines gewissen Fairplay - von Dankbarkeit auf Wettbewerb umzuschalten. Anfänglich so diskret, dass alle außer dem Opfer selbst es bemerkten, je subtiler desto besser.
Als Marthe 1984 an einem sonnigen Aprilmorgen im dezenten, neuerworbenen Hosenanzug, bestückt mit kräftigen Schulterpolstern, die ihrer schmalen weiblichen Schulterpartie etwas von der Robustheit eines Rugbyspielers verliehen, ganz im modischen Trend zu ihrem ersten Arbeitstag in der Vertriebsabteilung der Medinex AG antrat, wusste sie von allen diesen Dingen gar nichts. In der Rückschau eine unbegreifliche Naivität. Damals war Marthe
sicher, dass man sie unter den zahlreichen Mitbewerbern aufgrund ihrer fachlichen Kompetenz ausgewählt hatte und dass sie sich eben zum richtigen Zeitpunkt bei der richtigen Firma beworben hatte. Ganz einfach. Die Medinex AG produzierte elektronische Überwachungsgeräte für Krankenhäuser. Herzfrequenz, Blutdruck und Blutgaswerte, alle lebenswichtigen Parameter waren in Form vom informativen Kurven auf dem Monitorschirm ablesbar. „Wir produzieren die Kästen, die auf den Stationen dafür sorgen, dass es piepst und blinkt“, pflegte Marthe zu sagen, wenn sie Uneingeweihten ihre Branche, in die sie rein zufällig und völlig unkritisch reingerutscht war, beschreiben wollte. Der Markt schrie nicht unbedingt nach Geisteswissenschaftlern, als sie an einem eiskalten Februarmorgen endlich mit ihrer Magister-Urkunde in der Tasche auf den Vorplatz des Universitätssekretariats trat und sich in euphorischer Freude darüber, dem akademischen Prüfungsstress ein für alle mal entronnen zu sein, eine Zigarette anzündete. Und Marthe schrie eigentlich auch nicht nach einem Job. Am liebsten hätte sie ihr behaglich freies Studentenleben fortgesetzt. Fester Freund, billige Wohnung, niedrige feste Ausgaben, ein bisschen Bafög, gutbezahlte Ferienjobs, monatelange Reisen in den Semesterferien. So hätte es alles ihrer Meinung nach gerne weitergehen können. Ihre Berufsvorstellungen waren diffus - irgendetwas mit Schreiben. Oder PR-Arbeit. Oder vielleicht Journalistin? Die Bewerbungen um eine Praktikantenstelle bei den großen Tageszeitungen, bei der ARD und oder dem ZDF waren erfolglos. „Die geburtenstarken Jahrgänge, Sie wissen schon, bei uns kommen auf jede freie Stelle so viele qualifizierte Bewerber – es tut uns wirklich leid. Aber probieren Sie es in ein paar Monaten doch ruhig noch mal.“ Wie oft hatte Marthe das schon gehört. Insgeheim fiel ihr bei jeder neuen Absage aus Regionen südlich der Elbe jedes Mal ein Stein vom Herzen. Was sollte sie denn auch in Süddeutschland? Nach Frankfurt, unter Menschen mit diesem scheußlichen Dialekt. Oder noch schlimmer zu den Narren nach Mainz. Allein die Vorstellung, warme Sommerabende an verschlammten Baggerseen zubringen zu müssen statt mit Surfen und Schwimmen an der Ostsee! Nein, dann doch lieber etwas ganz anderes hier im Norden machen. Sie hatte ja Zeit, konnte einfach als Postbotin weiterjobben, auf die richtige Anzeige, die richtige Stellung warten. Marthe ließ sich Zeit. Las bergeweise Bücher teilweise zweifelhafter Observanz, ohne auch nur den leisesten Gedanken an Sekundärliteratur oder Quellenkritik zu verschwenden, strich die Wohnung, bepflanzte die Blumenkästen auf dem geräumigen Balkon, spielte Hausfrau. Kaufte ein, kochte, wusch und bügelte für Thomas, der jeden Morgen frischrasiert, gekämmt und wohlduftend in seinen Anzug schlüpfte, sich in den Golf setzte und in der Devisenabteilung seiner Bank mit Geldan- und Verkäufen viel Geld verdiente. Nach dem Stress des letzten Unijahres, in dem sie manchmal schweißnasse Alpträume von vergessenen Fußnoten geträumt hatte, genoss Marthe die Rückkehr in ein relativ zwangfreies Leben. Geldverdienen, Reisen, sich mit Freunden in der Stammkneipe treffen, keine lästigen Verpflichtungen. Bei Bedarf ein Mann zum Anlehnen und Kuscheln. Kein Stress, kein Grund dieses perfekte Leben zu ändern. Thomas hatte da eine etwas andere Auffassung und verliebte sich von einem Tag auf den anderen in eine ambitiöse Kollegin und ein anderes Leben. Die Wohnung stand in seinem Namen und wies, was letztlich ausschlaggebend war, einen geräumigen, voll begrünten Südbalkon auf. Ideal für Babys Mittagschlaf an der frischen Luft, zum Trocknen der vielen Kilo Babywäsche und natürlich der abendlichen Entspannung der jungen Eltern über einer Tasse Kaffee .
Marthe stand alleingelassen, ohne Dach über dem Kopf, dafür aber mit einem fast fertigen Norwegerpulli, den sie für Thomas zum Geburtstag gestrickt hatte. Nach 24 Stunden wütenden Heulens und Schluchzens wischte sie sich die Tränen ab, verstaute ihr weniges Hab und Gut in fünf Umzugskisten und zog als bezahlende Untermieterin zu einer Bekannten nach Wilhelmsburg. Auf einer der dort abgehaltenen Wochenendfeten, die irgendwann im Laufe des Freitagnachmittags ihren Anfang nahmen und sich mit wechselnder Besetzung bis Montagmorgen hinzuziehen pflegten, traf sie Manfred, der als Softwareentwickler bei Medinex arbeitete und ihr vorschlug „bewirb dich doch mal, die haben gute Sozialleistungen.” Manfred war nach einem ebenso kurzen wie heftigen Aufenthalt aus Marthes Leben verschwunden und nach Kalifornien ausgewandert. Sein lapidarer Kommentar: „Ich brauch also echt mal Luftveränderung, Deutschland sucks, also echt, für Leute wie mich liegt da drüben die Zukunft.” Die Medinex AG mit guten Kollegen, interessanten Arbeitsaufgaben und einem köstlichen Salatbuffet war geblieben und beanspruchte den größten Teil von Marthes wacher Zeit. Sie liebte ihre Arbeit, fühlte sich wichtig, tüchtig und unentbehrlich. Deshalb hatte sie sich weder über die schnelle Beförderung zur Projektleiterin noch wenig später zur Bereichsleiterin gewundert. Sie hatte das freundliche Interesse und die lobenden Bemerkungen ihres Chefs rein professionell gedeutet, denn sie war ja tüchtig, effektiv, hatte gute Ideen und konnte mit Kunden umgehen. Dr. Frode Hamann war ein glücklich verheirateter älterer Herr um die 50 mit attraktiver Ehefrau, drei Kindern und Dalmatiner im Endreihenhaus. Marthes überrascht-empörte Zurückweisung seiner handgreiflichen Zudringlichkeiten im Rahmen des seinerseits offenbar allzu wörtlich genommenen get-together-meetings auf der jährlichen Vertriebskonferenz war echt gewesen. Sie hatte Hamann nicht benutzt. Ihre Beförderung war verdient und beruhte ausschließlich auf Leistung. Hamann hatte nur das für einen Chef Natürliche getan und sie als die bestqualifizierte Kandidatin vorgeschlagen. Sie schuldete ihm nichts, außer sich in ihrer neuen Rolle zu beweisen. „Mein Gott du Schaf, wie kann man bloß in deinem Alter noch so naiv sein”, hatte Margrit sie gefragt, nachdem sie der Freundin - um solidarisches Verständnis heischend - den Verlauf des Abends geschildert hatte. „Du kannst dich genauso gut nach was anderem umsehen, in der Firma wirst du nichts mehr.” Einfach aufgeben und kampflos verschwinden, obwohl es nicht ihre Schuld war, sondern seine? Das wäre doch der Gipfel der Ungerechtigkeit, meinte Marthe. Nein, sie würde es diesem Ekelpaket mit den klammen Fingern schon zeigen, wer der Stärkere war. Und blieb. In diesem Punkt waren Marthe und Hamann sich zu 100 Prozent einig. Hamann blieb auch. Seit dem kühlen Frühlingsabend in Düsseldorf, an dem Marthe resolut Frode Hamanns kräftige linke Hand von ihrer rechten Brust entfernt und dem verdutzten, alkoholisierten Angreifer in einer instinktiven Abwehrreaktion und unter Ausdruck verbaler Empörung den Arm auf den Rücken gedreht hatte, besaß sie einen mächtigen Feind in der Firma. Und Hamann ließ sie so oft wie möglich merken, wer der Stärkere war.
Der Lautsprecher knitterte Unverständliches, der Zug bremste und fuhr kurz darauf leicht ruckelnd in die nächste Station ein. Marthe öffnete die Augen halb. Hoheluftbrücke. Eigentlich hätte sie nichts dagegen gehabt, sich noch ein bisschen so weiterfahren zu lassen und ungestört ihren Gedanken nachzuhängen. Stattdessen zog sie den Reißverschluss ihrer Jacke hoch und griff nach Tasche und Handschuhen. Die lesende Mutter mit dem schniefenden Sohn stand bereits an der Tür, wo sie ihm in farbenfrohen Einzelheiten schilderte, wie man aussähe, wenn man aufgrund unreglementierten Aussteigens aus dem noch fahrenden Zug unter die Räder käme. Der Kleine war sichtlich beeindruckt und klammerte sich an die mütterliche Hand. Er musste ungefähr das Alter von Thomas Jüngstem haben. Dessen Geburtsanzeige war gleichzeitig Thomas letztes Lebenszeichen gewesen. Kurz danach war er mit seiner Familie nach Süddeutschland gezogen. Wegen der Karriere, oder dem Geld nach, wie er sich ausdrückte und seitdem hatte sie nicht einmal mehr die obligatorischen Weihnachtskarten mit den austauschbaren Texten bekommen. Wer weiß, was aus mir geworden wäre, wenn wir uns damals nicht getrennt hätten, dachte Marthe. Würde ich dann mit zwei rotznäsigen Kleinkindern in einem Dorf auf der Alb sitzen und eine Müttergruppe gründen? Allein der Gedanke ließ sie erschauern. Nein, wohl kaum. Kinder waren süß, sie liebte ihre knuddeligen Nichten und Neffen, aber im Moment hatte sie absolut kein Bedürfnis. Sie fühlte sich noch viel zu jung für die Mutterrolle, dafür hatte sie noch viele Jahre Zeit. Jetzt galt es erstmal, das Leben in vollen Zügen zu genießen und das ging am besten zu zweit und ohne Kinderwagen. Marthe floss mit dem Menschenstrom in Richtung Rolltreppe und tauchte aus der glitzernden Helle des U-Bahn Schachts in die dunkle Kälte der Oberwelt, wo sie fröstelnd an der roten Ampel wartete. Der Duft von Grillwürstchen und gebrannten Mandeln aus den kleinen Buden eines intermistischen Marktplatzes behauptete sich selbst gegenüber der kräftigen Abgaswolke der anfahrenden Autos. Marthe lief das Wasser im Mund zusammen. Der Kühlschrankinhalt war soweit sie sich erinnerte ziemlich unattraktiv, und sie beschloss beim Chinesen vorbeizugehen. Und zur Sicherheit auch gleich noch beim Zeitschriftenhändler Lotto zu spielen. Wahrscheinlichkeitsrechnung hin oder her, einer musste ja gewinnen und sie könnte einen warmen Regen wirklich gut gebrauchen.
Die Plastiktüte mit der süßsauren Ente entsandte köstliche Düfte und Marthe kramte hektisch in ihrer Handtasche nach dem Haustürschlüssel. Das Mittagessen in der Kantine hatte sie ausfallen lassen und jetzt kam zur Strafe der Heißhunger. Sie stemmte ihre Schulter gegen die schwere Holztür, balancierte Handtasche, Plastiktüte und rechten Handschuh in der linken Hand und tastete nach dem Lichtschalter. Das Treppenhauslicht erwachte mit einem satten Klick zum Leben und fast gleichzeitig stieß Marthe einen spitzen Überraschungsschrei aus. Emilie Finkenstein, Hausbesitzerin und uneingeschränkte Herrin über neun Mietparteien stand stumm und regungslos im gleißenden Licht auf dem Treppenabsatz zum ersten Stock und sah anklagend aus. Was an und für sich nichts Überraschendes war, da Frau Finkenstein seit dem Tod ihres Mannes während der 63er Sturmflut konstant einer lebenden Anklage glich. „Stellen Sie sich mal vor, der Mann hat einen Lungendurchschuss, Stalingrad, die Jahre beim Russen und die TB überlebt und dann ertrinkt er mitten im schönsten Frieden, weil er eine Katze retten will!" Diesen Satz pflegte Frau Finkenstein mit einem vehementen, durch die Nüstern ihrer schmalen Nase gepressten verächtlichen Schnaufen lautmalerisch zu unterlegen. In Marthes Augen war die Episode mit der Katze eigentlich ein sehr sympathischer Zug an diesem Herrn Finkenstein, dem sie nur als streng blickenden, uniformierten Soldaten im Silberrahmen auf Frau Finkensteins Fernseher begegnet war. Aber das sagte sie natürlich nie laut, so wie sie überhaupt versuchte, mit ihrer Vermieterin auf gutem Fuß zu stehen, auch wenn das normalerweise das Äußerste ihrer begrenzten diplomatischen Fähigkeiten erforderte. Zentral gelegene Mietwohnungen in Hamburg waren rar. Bezahlbare, zentral gelegene Mietwohnungen im schönsten Jugendstil mit Parkettfussboden und 4,20 m Deckenhöhe waren Gold wert. Sie hatte diese Perle in der Isetrasse über die Bekannte einer Kollegin gefunden und sich bereits beim Betreten des stilvoll restaurierten Treppenhauses mit Mosaikfussboden und hochglanzpoliertem Treppengeländer geschworen alles zu tun, um ihr Zimmer in Wilhelmsburg mit diesem Domizil zu vertauschen. Wenn es so etwas wie Liebe auf den ersten Blick zwischen Wohnungen und Menschen gab, dann hier zwischen Marthe und diesen stuckverzierten Quadratmetern. Letztlich hatte es Marthe auf der Vermieterseite einen riesigen Blumenstrauß, eine Schachtel Pralinen und mehrere Gespräche, deren Inhalt hauptsächlich aus massiven Schmeicheleien bestand, gekostet. Auf der Vormieterseite war es etwas teurer gewesen. 6.000 DM Abstand für altrosa Veloursvorhänge mit Quasten und ehemals beige Spannteppiche mit undefinierbaren bräunlichen Flecken. Aber Marthe wollte einfach hier wohnen und zahlte. Die Vorhänge waren an die Theater AG einer ihrer Freundinnen gegangen, die an einem Gymnasium in Olsdorf unterrichtete und Materialien für das Bühnenbild der Mutter Courage benötigte.
Der Spannteppich war trotz verhaltener Proteste seitens Frau Finkenstein „ist doch schade drum, ist doch reine Wolle“, direkt in den Sperrmüll gewandert.
Marthe wusste sofort, warum man ihr zu dieser späten Stunde in Häkelweste und plüschigen, kunstpelzverbrämten Hausschuhen auflauerte. Und Frau Finkenstein wusste ebenfalls, dass Marthe es wusste. „Ich weiß, dass Sie eine vielbeschäftigte, berufstätige junge Frau sind, aber das entbindet Sie nicht von der Putzpflicht!“ Marthe hatte diese Woche Treppendienst. Eigentlich hätte sie schon gestern die Treppe wischen und das Geländer polieren sollen. Aber da war sie so beschäftigt damit gewesen, die 5. Version des Marketingbudgets fürs nächste Jahr zu bearbeiten, dass sie diese Tätigkeit erst verschoben und danach verdrängt hatte.
Marthe seufzte, lächelte Frau Finkenstein entschuldigend an und gelobte das Versäumte umgehend nachzuholen. Mit Diskutieren kam man hier nicht weiter, das wusste sie aus bitterer Erfahrung. „Mach ich, mach ich noch heute Frau Finkenstein, gleich nach dem Abendbrot.” Marthe wedelte mit der wohlduftenden Plastiktüte, und schob sich mit einem „schönen Abend noch" so schnell wie möglich am Zerberus vorbei.
Auf den letzten Stufen, hörte sie bereits das Telefon klingeln. Stefan! Er hatte offenbar doch noch die letzte Maschine bekommen. Dann konnte der ganze missglückte Tag zumindest noch einen netten Abschluss bekommen. Marthe wurde ganz warm vor Freude, sie nahm die noch fehlenden Stufen im Galopp und ließ alles, was sie in den Händen hatte im Flur fallen. Leicht keuchend nahm sie den Hörer ab. „Twiete!" „Ja sag mal, wo hast du denn wieder die ganze Zeit gesteckt, ich hab schon den ganzen Abend versucht, dich zu erreichen, du könntest ja auch ruhig mal zwischendurch anrufen, aber dazu bist du natürlich wieder viel zu beschäftigt, ich könnte hier umfallen, keines meiner Kinder würde es bemerken.” Marthe wendete den Blick himmelwärts und schluckte einen enttäuschten Fluch stumm hinunter. Die Vorfreude auf einen unverhofften romantischen Abend erlosch genauso schnell wie sie entstanden war. „Hallo Muttchen”, seufzte sie mit flacher Stimme in den Hörer, aus dem sich in unverminderter Stärke und im üblichen leicht indignierten mütterlichen Tonfall ein Schwall von Fragen und Insinuationen in Marthes Ohr ergoss. Während Marthe mit strategisch eingestreuten mmhhs, ach wirklich oder sag bloß den Redefluss ihrer Mutter kommentierte, versuchte sie die Ente mit dem rechten Fuß aus der stabilen Seitenlage in eine aufrechte Position zu bringen. Ihr Magen knurrte so laut, dass sogar ihre Mutter es hören musste. Leicht verspätet fand sie die übliche Antwort auf die übliche mütterliche Frage. „Ich musste Überstunden machen.” Aber diesmal hatte ihre Mutter die obligatorische einleitende Runde mit rhetorischen Fragen schneller abgeschlossen als erwartet und ging nun unmittelbar zum wirklichen Grund ihres Anrufs über. „Tante Wilhelm ist tot. Verkehrsunfall. Zu schnell in die Kurve und da lag schon Eis.” Der leise Anflug von Genugtuung in der mütterlichen Stimme war nicht zu überhören. „Bitte lasse sie jetzt nicht die ganze Litanei abrasseln, sonst schrei ich”, betete Marthe im Stillen und ihr Gebet wurde erhört. Frau Twiete begnügte sich mit der kurzen Version: „Na, war ja auch nicht anders zu erwarten. Selbst in ihrem Alter hat sie sich ja immer noch aufgeführt wie eine Wilde. Allein der Wagen. Konnte ja wieder alles nicht groß und teuer genug sein.” Soweit Marthe sich erinnerte, war einer der Favoriten ihrer Tante das bordeauxrote Jaguarcabriolet gewesen. Der einzige Wagen, den sie nach dem Tode ihres Mannes behalten und über die Jahre regelmäßig durch das neueste Modell ersetzt hatte. Tante Wilhelm war eine gute Autofahrerin, die Geschwindigkeitsbegrenzungen und Verkehrsregeln einhielt, wenn sie Zeit dazu hatte. Da sie jedoch meistens in Eile und in Gedanken schon beim nächsten Punkt auf ihrer langen Aufgabenliste war, produzierte sie regelmäßig Schrammen, Beulen und Blechschäden. „Na, sollte eben in ihrem Alter keine Autorennen mehr fahren und schon gar nicht in angetrunkenem Zustand”, kam es spitz durch die Leitung. Der angetrunkene Zustand war das Sahnetüpfelchen. Marthe konnte hören, wie sich ein triumphierender Unterton in die mütterliche Indignation mischte. Tante Wilhelm hatte die Angewohnheit sich ein Glas ordentlichen Rotwein zu den Mahlzeiten zu gönnen und als Inhaberin eines ansehnlichen Vermögens, hatte sie bei der Beschaffung gehobener Qualitätsweine nie Probleme gehabt. „Besser und billiger als Vitaminpillen”, erwiderte sie stets lachend, wenn ihre Familie mit mehr oder weniger deutlichen Hinweisen auf ihren regelmäßigen Alkoholkonsum zu sprechen kam. „Man bekommt gute Laune und gesund ist es auch noch.” Marthe konnte das mütterliche „das hat sie nun davon, ich hab ja schon immer gesagt, dass das mal ein schlimmes Ende nehmen wird“, förmlich durch die Leitung fühlen. Normalerweise hätte sie jetzt irgendetwas in Richtung „wie furchtbar oder die Ärmste, das tut mir aber leid“, sagen müssen. Bei dem äußerst kühlen Verhältnis zwischen ihrer Mutter und deren Schwägerin „warum tut die denn auch bloß immer so extravagant, immer muss es bei ihr was anderes sein als bei Nachbarns“, hätten derlei Bemerkungen jedoch denselben Effekt gehabt wie Öl ins Feuer zu gießen. Mit dem neutralsten Tonfall, der ihr zur Verfügung stand beschränkte Marthe sich daher auf ein „hat sie noch sehr leiden müssen?”
„Nein, sie war sofort tot, hat sich wohl beim Überschlagen das Genick gebrochen. Wir wurden ganz offiziell von ihrem Familienanwalt oder wie man diesem Herren nennen soll, informiert. Du weißt schon, dieser arrogante Schnösel, den sie zu Papas Beerdigung mitgeschleppt hat." Theresa Twiete machte eine bedeutungsvolle Pause. Sowohl aus rein praktischen Gründen, um Luft zu holen als auch um der Beerdigung vor nun bald sechs Jahren angemessen Rechnung zu tragen. Seit dem plötzlichen Tod ihres Mannes, der im Alter von 62 Jahren ganz unpassend in den Armen seiner Verkaufsleiterin und Geliebten einem Schlaganfall erlegen war, hatte Theresa Twiete sich eine passende Geschichte zur Erklärung und zwecks mentaler Nachbearbeitung bereitgelegt, die sie über die Jahre mit ständig neuen Details erweiterte und verbesserte und die mittlerweile so überzeugend wirkte, dass sie selbst daran glaubte. Theresa Twiete, geliebte Ehefrau und Mutter von vier Prachtkindern „der Apfel fällt ja bekanntermaßen nicht weit vom Stamm“, wird nach 34-jähriger glücklicher Ehe „stellen Sie sich mal vor, genau an unserem Hochzeitstag fällt er mir um, das hat ja schon fast was Symbolisches,” brutal aus dem ehelichen Idyll gerissen, steht ganz alleine und hilflos da, ist oft am Ende ihrer Kräfte, gibt aber nicht auf, sondern kämpft sich durch. „Um der Kinder willen, auch wenn sie schon alle aus den Windeln raus sind.“ Glockenhelles Lachen. „Und weil Heinrich es so gewollt hätte.” Marthe hatte diese mütterlichen Phantasiegeschichten, in der die Realität soweit wie möglich ausgeklammert oder bis zur Unkenntlichkeit geschönt wurde, anfänglich gehasst und fühlte sich jedes Mal peinlich berührt, wenn sie bei Geburtstagen und an Fest- und Feiertagen Zeuge der mütterlichen Geschichtsbereinigung wurde. Besonders, weil sie wusste, dass die meisten der Anwesenden die Wahrheit kannten oder zumindest die Gerüchte, die kursierten. Ihre Mutter mit glühenden Wangen „ach nein danke, bloß keinen Kaffee mehr, bin schon ganz überdreht", im Kreise ihres Fanklubs, in dem nur ein paar gleichaltrige Damen mit Witwenstatus aktiv versuchten, mit ihren eigenen, bei weitem weniger spektakulären Todesfällen etwas von der Aufmerksamkeit zu erheischen, die Frau Twiete gerne 100% für ihre Person beanspruchte. Der Rest des Publikums interessiert lauschend, den Kuchenteller balancierend, und zwischen zwei Bissen Torte mit aufmunternden Kommentaren wie „nein wirklich und er sah ja auch immer so gesund aus, grausam so mitten aus dem schaffenden Leben gerissen", oder „Sie Ärmste, gerade wo sie endlich mal Zeit für sich selbst gehabt hätten, mit den Kinder aus dem Haus." Irgendwann befolgte Marthe Markus brüderlichen Rat, der ihre giftigen Bemerkungen über das zweifelhafte mütterliche Gedächtnis mit einem trockenen „was willst du eigentlich, andere rennen zweimal in der Woche zum Psychiater, unsere Mutter macht ihre Traumenbearbeitung selbst, dazu noch gratis und wie man sieht mit Erfolg“, kommentierte. „Wenn das ihre Methode ist zu verdrängen, dass unser Vater jahrelang eine andre Frau gevögelt hat, kann sie von mir aus dichten und erfinden soviel sie will, Hauptsache sie ist glücklich dabei.”