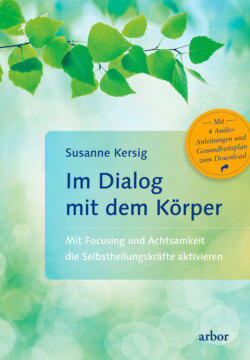Читать книгу Im Dialog mit dem Körper - Susanne Kersig - Страница 15
Kapitel 1 Selbstverantwortung und Patientenkompetenz
Оглавление»You can go your own way!« sang die Band Fleetwood Mac in den 70er Jahren. Den eigenen Weg gehen – gilt das auch für unsere Rolle als Patientinnen und Patienten? Sollten wir uns bei medizinischen Entscheidungen nicht einfach denjenigen anvertrauen, die ein langes Studium absolviert haben und schließlich ExpertInnen auf diesem Gebiet sind? Oder sollten wir uns vielleicht auch einmal fragen, wer letztendlich die Verantwortung für unsere Gesundheit trägt? Im ÄrztIn-PatientIn-Verhältnis hat sich in Hinblick auf diese Fragen in den letzten Jahrzehnten einiges verändert.
Als junge Psychologin arbeitete ich Mitte der 80er Jahre in einer Rehabilitationsklinik in einem winzigen Dorf im Schwarzwald. Zu uns kamen PatientInnen mit orthopädischen und internistischen Problemen sowie mit Augenerkrankungen. Ich war offen gestanden zunächst schockiert darüber, wie sich viele PatientInnen in der Sprechstunde darstellten: Sie erwarteten, von unserem Team behandelt, therapiert und am besten täglich massiert zu werden, ohne etwas an ihrem – aus meiner Sicht häufig krankmachenden – Lebensstil verändern zu wollen. Eines Tages hielt ich in Anwesenheit meines Chefs, eines freundlichen, aber etwas ängstlichen Internisten, eine flammende Rede und bat die PatientInnen darum, die Klinik nicht wie eine Kfz-Werkstatt zu betrachten, nicht wie einen Ort, an dem man herumliegen kann, um sich Medikamente einträufeln und passiv therapieren zu lassen. Mein Chef kräuselte während meiner Ansprache zunächst die Stirn und warf mir zunehmend böse Blicke zu, die mir zu verstehen gaben, ich möge mit diesem Unsinn bitte umgehend aufhören. Im anschließenden Gespräch mit ihm begriff ich, dass er nicht nur Angst davor hatte, ich könnte unsere Patienten mit meiner norddeutschen Direktheit vor den Kopf stoßen, sondern dass er sich mündige Patienten gar nicht unbedingt wünschte!
Mittlerweile befinden wir uns in der Gestaltung der ÄrztIn-PatientIn-Beziehung an einem Wendepunkt. Über Jahrhunderte hinweg sollten PatientInnen nur passiv sein und den Anweisungen ihres – meist männlichen–Arztes möglichst Folge leisten, ohne viel nachzufragen. Noch in den 60er Jahren wurden den PatientInnen Diagnosen zum Teil nicht mitgeteilt, oder sie wurden nur unzureichend über ihre Erkrankung informiert. Diese Haltung prägt unsere Gesellschaft immer noch tief. Nicht selten geben wir auch heute noch die Verantwortung für unsere Genesung blind an die behandelnden ÄrztInnen ab.
Warum aber ist es so entscheidend, dass wir sie selbst übernehmen?
Eine ÄrztIn kann uns mit medizinischen Informationen und messbaren Parametern versorgen, sie kann aber unseren Körper nicht von innen fühlen. Sie kennt weder unsere Lebenssituation noch unsere inneren Konflikte. Letztendlich können nur wir die Bedeutung unserer Symptomatik finden, nur wir können unseren Lebensstil in Richtung Gesundheit verändern. Die Ärztin oder der Arzt kann uns darin begleiten und unterstützen.
Des Weiteren ist die Datenlage in der Medizin ist nicht so gesichert, wie es von außen erscheinen mag. Aus verschiedenen Gründen musste ich selbst wegen der Behandlung meiner Schilddrüsen-Unterfunktion mehrmals die ÄrztIn wechseln. Die erste Ärztin diagnostizierte vor ca. 22 Jahren bei mir Hashimoto-Thyreoiditis, eine Autoimmun-Erkrankung, bei der sich die Schilddrüse selbst zerstört. Diese Erkrankung sei chronisch, ich müsse damit leben, bräuchte mir aber keine Gedanken darüber zu machen, da man sie mithilfe von Schilddrüsen-Hormonen gut in den Griff bekäme. Ich nahm und nehme die empfohlenen Hormone bis heute ein. Zehn Jahre später zog ich aus Süddeutschland nach Hamburg. Dort suchte ich erneut einen Spezialisten auf, um meine Schilddrüse kontrollieren zu lassen. Dieser Professor erläuterte mir, dass ich nie eine Hashimoto-Thyreoiditis gehabt hätte, die Datenlage sei eindeutig. Ich fühlte mich erleichtert. Als ich auf Anraten einer Heilpraktikerin Jahre später doch noch einmal abklären wollte, ob ich denn nun eine Hashimoto-Thyreoiditis habe oder nicht, konsultierte ich einen weiteren, sehr erfahrenen Endokrinologen. Dieser Facharzt sagte nach Auswertung aller Ergebnisse, er könne mir nicht sagen, ob ich diese Erkrankung hätte, vielleicht sei sie auch ausgeheilt, es sei aber auch egal, denn es würde an der Therapie nichts ändern. Nachdem dieser Spezialist eine astronomisch hohe Rechnung ausgestellt hatte, ging ich bei der nächsten fälligen Kontrolle der Schilddrüse zu einer mir von verschiedenen Seiten empfohlenen Endokrinologin. Diese kam zu dem Schluss: »Sie haben eindeutig eine Hashimoto-Thyreoiditis. Diese Erkrankung kann nicht ausheilen, sie ist chronisch.« Sie verordnete zusätzlich zu den Schilddrüsen-Hormonen die Einnahme von Selen und empfahl mir ein Buch über Leben mit Hashimoto-Thyreoiditis.
Vier ÄrztInnen, drei Meinungen. Diese verwirrenden Ergebnisse liegen meiner Ansicht nach nicht an der Inkompetenz der von mir aufgesuchten Fachleute – es waren alles erfahrene und angesehene VertreterInnen ihres Faches –, sondern daran, dass die Fakten in der Medizin eben häufig nicht so eindeutig sind, wie wir sie gerne hätten. Dies betrifft nicht nur die Diagnosen, sondern auch die Therapien. »Man glaubt es kaum, aber die meisten medizinischen Behandlungsmethoden können sich nicht auf wirklich gutes quantitatives Belegmaterial berufen,« so der angesehene Medizinprofessor und Direktor des Stanford Prevention Research Centers, John Ioannidis (Freedman 2010). Viele Studien, die in renommierten Fachzeitschriften veröffentlicht wurden, werden zum Beispiel kurze Zeit später von anderen, weiteren Studien zur gleichen Frage widerlegt.
Hinzu kommt, dass nicht alle medizinischen Empfehlungen ausschließlich zum Wohle der PatientInnen getroffen werden. Kliniken und Praxisbetreiber stehen mittlerweile unter einem großen Druck, hohe Renditen zu erzielen. So wird in Deutschland wesentlich häufiger operiert als in anderen Ländern. Einer Studie im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung zufolge gibt es bei uns zum Beispiel jährlich 70 000 Schilddrüsenoperationen, wobei bei 90 Prozent der Eingriffe keine bösartigen Veränderungen vorliegen. Auch seien 70 Prozent der Verordnungen für Magensäureblocker, die zu den am häufigsten verordneten Medikamenten zählen, medizinisch nicht notwendig (IGES 2019).
Darüber hinaus sind ÄrztInnen immer wieder gezwungen, Interventionen anzuordnen, die ihnen selbst nicht sinnvoll erscheinen, um sich gegen Schadensersatz-Prozesse abzusichern. Obwohl zum Beispiel mehr als 20.000 AmerikanerInnen im Jahr an krankenhausbedingten Infektionen sterben und Intensivstationen in dieser Hinsicht am gefährlichsten sind, kann es sein, dass ein behandelnder Arzt die Verlegung dorthin anordnen muss, auch wenn sie ihm im Einzelfall nicht richtig erscheint. Nur so kann er sich vor möglichen Rechtsansprüchen klagender Angehöriger absichern. Prof. Gerd Gigerenzer spricht von einer tickenden Zeitbombe im Gesundheitssystem und meint damit den drohenden Vertrauensverlust von Patienten angesichts ärztlicher Entscheidungen, die nur dem Selbstschutz vor Klagen oder dem eigenen Profit dienen und nicht das Patientenwohl als oberste Prämisse haben (Gigerenzer 2013).
Angesichts dieser Gründe macht es zutiefst Sinn, dass wir die Verantwortung für die eigene Gesundheit nicht blind abgeben, sondern selbst übernehmen. Das bedeutet, dass wir uns bei weitreichenden medizinischen Maßnahmen umfassend informieren, vielleicht auch eine zweite Meinung einholen, bevor wir eine Therapieentscheidung verantwortlich treffen. Besonders bei chronischen Erkrankungen bedarf es der aktiven Übernahme von Verantwortung von Betroffenen und den Mut, den eigenen Weg zu gehen, manchmal eben auch gegen ärztlichen Rat oder gegen drängende Angehörige, indem wir unserer inneren Überzeugung und dem inneren Körperwissen treu bleiben. Studien über PatientInnen, die entgegen aller ärztlichen Prognosen ihre Krebserkrankung besiegt haben, ergaben, dass sie allesamt für ihre Gesundheit selbst Verantwortung übernommen haben, natürlich nicht ohne medizinischen Rat (Turner 2015).
Dabei muss man als betroffene Person damit rechnen, vom medizinischen Fachpersonal nicht immer freundlich behandelt zu werden, wenn man die Kontrolle über die eigene Genesung selbst übernimmt. Der amerikanische Psychoonkologe Lawrence LeShan schrieb in seinem lesenswerten Buch Diagnose Krebs, Wendepunkt und Neubeginn (LeShan 1993), dass er sich oft Sorgen um seine PatientInnen machte, wenn er sie in der Klinik besuchte und das Personal ihn besonders freundlich empfing. Er schlussfolgerte daraus, dass sein Patient oder seine Patientin angepasst ist. Wurde er hingegen vom Personal eher grimmig begrüßt, weil ein(e) PatientIn sich aufmüpfig verhielt, freute er sich, denn so wusste er, dass diese(r) auf dem Wege der Besserung war.
PatientInnen sind heute wesentlich aufgeklärter und selbstverantwortlicher, und möchten, dass ihnen MedizinerInnen partnerschaftlicher begegnen als noch vor einigen Jahrzehnten. Vielleicht wird ja der Begriff »Patient«, lateinisch »geduldig, aushaltend, ertragend«, eines Tages durch das passendere Wort »Agent«, also jemand, der handelt, ersetzt – das wünscht sich Harald Walach, der ehemalige Leiter des Instituts für transkulturelle Gesundheitswissenschaften an der Europa-Universität Viadrina. (Walach 2011)
»Die Kraft des Arztes liegt im Patienten«, erkannte Paracelsus bereits im 16. Jahrhundert. Medikamente und Operationen können den Heilungsprozess unterstützen und anregen. Letztendlich findet er aber im Körper und Geist der Betroffenen statt, mithilfe ihrer Fähigkeit zur Selbstheilung. Um als PatientInnen die eigene Kompetenz und Verantwortung voll ausschöpfen und wirklich das Steuer in die Hand nehmen zu können, brauchen wir neben einer guten fachlich-medizinischen Begleitung auch Wissen und Methoden, um die Sprache unseres Inneren Arztes / unserer Inneren Heilerin zu verstehen und zu nutzen. Dieses Wissen möchte ich Ihnen in dem vorliegenden Buch an die Hand geben.