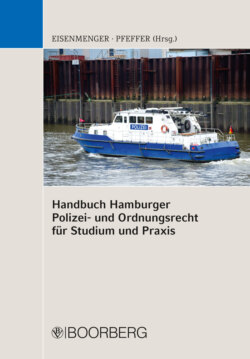Читать книгу Handbuch Hamburger Polizei- und Ordnungsrecht für Studium und Praxis - Sven Eisenmenger - Страница 62
На сайте Литреса книга снята с продажи.
a) Ermessen – eine Einordnung
Оглавление184
Wenn man ein Gesetz zur Gefahrenabwehr kreiert, dann steht man vor einem Dilemma. Einerseits muss das Gesetz – schon wegen des Bestimmtheitsgrundsatzes gem. Art. 20 Abs. 3 GG (s. o. A.III.2.) – hinreichend präzise gefasst sein, also klare Lösungen bereithalten. Andererseits kann der Gesetzgeber nicht alle Situationen voraussehen, mithin auch nicht abschließend sämtliche denkbaren Gefahrensituationen detailliert aufführen, sondern er muss versuchen, das Gesetz so abstrakt zu formulieren, dass es allgemeingültig ist und auf eine Vielzahl von Situationen Anwendung finden kann.
185
Eine Lösung dieses Dilemmas besteht nun darin, auf der Tatbestandsseite bzw. „Voraussetzungsseite“ einer Norm unbestimmte Rechtsbegriffe zu fixieren, wie etwa „Gefahr“ in § 3 Abs. 1 SOG, um eine Situation zu beschreiben, gleichzeitig aber der Praxis Flexibilität zu geben bei der Frage, was darunter zu verstehen ist. Eine zweite „Stellschraube“ besteht auf der Rechtsfolgenseite darin, der Verwaltung auch die Entscheidung zu übertragen, ob sie einschreitet, selbst wenn alle Voraussetzungen vorliegen. Lässt der Gesetzgeber im Wege von Formulierungen wie „darf … durchsucht werden“ (§ 15 Abs. 1 SOG), „ist berechtigt, eine Person anzuhalten“ (§ 12 Abs. 1 SOG), „kann“ Maßnahmen treffen oder „treffen … nach pflichtgemäßem Ermessen … die erforderlichen Maßnahmen“ (§ 3 Abs. 1 SOG), der Verwaltung diesen Entscheidungsspielraum, so räumt er ihr Ermessen ein. Ist die Behörde ermächtigt, nach ihrem Ermessen zu handeln, hat sie ihr Ermessen entsprechend dem Zweck der Ermächtigung auszuüben und die gesetzlichen Grenzen des Ermessens einzuhalten (so ausdrücklich § 40 HmbVwVfG). Im Gegensatz zum unbestimmten Rechtsbegriff ist das Ermessen nur eingeschränkt durch Gerichte überprüfbar (s. B. I.4.c.).
Beispiel:
§ 12 b Abs. 1 Satz 1 SOG lautet: „Eine Person darf aus ihrer Wohnung und dem unmittelbar angrenzenden Bereich verwiesen werden, wenn dies erforderlich ist, um eine Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit von Bewohnern derselben Wohnung abzuwehren.“
Analysiert man die Norm aufbautechnisch, so ergibt sich:
Tatbestandsseite mit unbestimmten Rechtsbegriff „Gefahr“:
„wenn dies erforderlich ist, um eine Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit von Bewohnern derselben Wohnung abzuwehren.“
Rechtsfolgenseite mit Ermessen „darf“:
„Eine Person darf aus ihrer Wohnung und dem unmittelbar angrenzenden Bereich verwiesen werden“