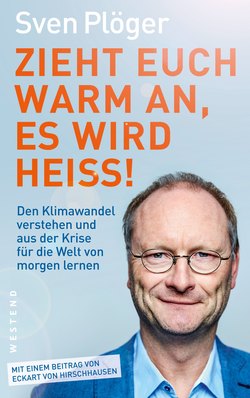Читать книгу Zieht euch warm an, es wird heiß! - Sven Plöger - Страница 44
Emissionshandel und weitere Instrumente
ОглавлениеMit dem Emissionshandel, wie er seit 2005 als einer der flexiblen Mechanismen des Kyotoprotokolls in der EU eingeführt wurde, hatte die Politik einen lobenswerten und überfälligen Paradigmenwechsel vollzogen. Die Idee, dass die Atmosphäre ein freies Gut sei, das jedermann beliebig zumüllen durfte, wurde von einem Prinzip der Verknappung abgelöst. Erstmals musste das Recht, CO2 in die Luft zu blasen, beantragt und über entsprechende Zertifikate für kontingentierte Mengen genehmigt werden. Zur Teilnahme am Emissionshandel verpflichtete man Unternehmen mit besonders hohem spezifischen Ausstoß, maßgeblich aus Energiewirtschaft, Eisen-, Stahl-, Zement-, Papier- und chemischer Industrie. Im Handelszeitraum von 2013 bis 2020 waren es in Deutschland 1 900 solcher Firmen, die ihre Emissionen jährlich bei der Deutschen Emissionshandelsstelle (DEHSt) melden mussten und ihrerseits mit den zugeteilten Zertifikaten international handeln durften.
Die Idee markierte zwar einen Fortschritt gegenüber dem vorigen Laissez-faire, doch war sie anfangs schlecht umgesetzt. Denn um die energieintensiven Industrien vor Konkurrenznachteilen zu schützen, verteilte die Politik kostenlose Zertifikate, deren Volumen man überdies noch für ein deutlich überhöht angenommenes künftiges Wachstum nach oben »korrigiert« hatte. Der Markt war geflutet mit Verschmutzungsrechten, ihr Preis verfiel rapide und der beabsichtigte Druck auf die Industrie, sich in Richtung Effizienz und Einsparung zu entwickeln, löste sich in Luft auf. Ein klassischer Fall von Marktversagen, unter dem das System bis in die aktuelle Handelsperiode leidet, denn noch immer müssen diese überflüssigen Zertifikate abgefischt werden.
Immerhin hat die EU für diesen Zeitraum die Spielregeln für alle Mitgliedstaaten weitgehend angeglichen und zumindest der Stromsektor muss mittlerweile seine Zertifikate vollständig über Auktionen einkaufen. Ebenso wurden nun alle Treibhausgase einbezogen, also auch Lachgas und perfluorierte Kohlenwasserstoffe. Zwar erhalten Industriebranchen und Wärmeproduktion noch immer kostenlose Kontingente, aber sie müssen sich dem Wettbewerb untereinander stellen, da die Menge der Zertifikate sich daran orientiert, wie viel Treibhausgase die europaweit effizientesten 10 Prozent aller Anlagen eines Sektors pro Tonne des jeweiligen Produkts abgeben. Die Gesamtzahl der Berechtigungen nimmt dabei jährlich um gut 1,7 Prozent ab. Seit 2012 erstreckt sich der Emissionshandel auch auf den Flugverkehr mit Start- oder Landepunkt innerhalb der EU, dieser Anwendungsbereich wird 2020 überarbeitet. Da auch hier zahlreiche Geschenke und Ausnahmen gemacht wurden – 85 Prozent der Zertifikate waren kostenlos und bis 2016 wurden nur innereuropäische Flüge eingebunden – blieb die Wirkung minimal. Die Einnahmen aus dem Emissionshandel investiert die Bundesregierung in Klimaschutzmaßnahmen in den Kommunen, der Wirtschaft und bei den Verbrauchern, zum Beispiel für Zuschüsse zur Heizungsmodernisierung in privaten Haushalten.
Der Emissionshandel in der EU ist sicherlich weiterhin verbesserungswürdig, doch dürfte er einen wesentlichen Anteil daran haben, dass die deutschen Emissionen bereits 2019 stärker zurückgegangen waren als zunächst geschätzt. Man kann dies aber auch so lesen, dass ein stärkerer Gesetzesrahmen uns den notwendigen Klimaschutzzielen noch deutlich schneller nahebringen würde. Tatsächlich gehen die Überlegungen der EU-Kommission genau in diese Richtung. Bislang wurden die energieintensiven Branchen geschont, auch um zu verhindern, dass sie aus der EU abwandern und mit ihren Emissionen lediglich andernorts das Weltklima belasten – der sogenannte »Carbon-Leakage-Effekt«. Nun könnten bald CO2-intensive Produkte beim Import an den Außengrenzen der EU mit einem Aufpreis belastet werden (»Border Carbon Adjustment«), der sich nach der Höhe ihrer Klimaschädlichkeit richten würde.
Wie auch immer solch ein Ansatz ausgestaltet wird – als Steuer, Zoll oder in anderer Form – eines zeichnet sich bereits ab: Die Emissionsgeschenke an die Hochverbraucher innerhalb der EU sind mit einem solchen Aufschlag für Importeure nicht mehr vereinbar und ihre Zeit dürfte sich dem Ende neigen. Damit müssten die Produzenten ihre Effizienz endlich unabhängig von ihrem Standort steigern. Es sieht so aus, als ob sich das Blatt doch noch in die richtige Richtung wendet, denn nicht eine billige oder teure Tonne CO2 entlastet das Klima, sondern nur eine, die nicht produziert wird. Allerdings, auch hier lernen wir aus der Coronakrise: Der CO2-Preis ist aufgrund der stark geminderten Produktion und folglich mangels Nachfrage nach Zertifikaten rapide in den Keller gegangen. Dort dürfte er nach Einschätzung des Brüsseler Think Tanks Centre on Regulation in Europe (CERRE) wegen der wirtschaftlichen Unsicherheiten auch noch auf einige Zeit bleiben. Dies offenbart eine typische Schwäche rein marktwirtschaftlich konstruierter Mechanismen: Zum einen richten sich ihre Preissignale nach der Konjunktur, nicht nach der Physik. Zum anderen entsteht dadurch dem Prinzip nach ein endloses Pendeln – sinkt der Preis, steigen die Emissionen wieder. Das letztliche Ziel sollte aber kein ewiges Auf und Ab des CO2-Ausstoßes sein, sondern eine konstante Senkung bis auf null – und das noch innerhalb der nächsten Jahrzehnte.
Parallel zum Emissionshandel auf EU-Ebene, der nur etwa 45 Prozent aller Emissionen erfasst, führt Deutschland ein eigenes System der CO2-Bepreisung ein, das alle Produkte und Konsumenten einbinden soll – ein Ergebnis der Verhandlungen zum Klimapaket. Um nicht jedes Produkt im Detail behandeln zu müssen, soll diese Steuer weit oben in der Lieferkette erhoben werden, beispielsweise bei den Treibstoffherstellern, sodass sie ihre Wirkung im ganzen nachfolgenden Preisgefüge entfaltet. Der Einstiegspreis von 25 Euro pro Tonne CO2 ab 2021 lässt allerdings keine echten Ambitionen erkennen. Laut den bereits erwähnten Zahlen des Umweltbundesamtes verursacht eine Tonne CO2 Schäden von rund 180 Euro, wonach die deutschen Treibhausgasemissionen 2016 Gesamtkosten von rund 164 Milliarden Euro zu verschulden hatten. Entsprechend hatten Volkswirtschaftler im Sinne einer deutlichen Lenkungswirkung einen Einstiegspreis von 80 Euro gefordert. Aus der Geschichte des Emissionshandels konnte man bereits ersehen, dass zu niedrige CO2-Preise eben kein Signal an die Marktteilnehmer senden. Sie sind sogar in zweifacher Hinsicht schädlich, indem sie Industrien, wenn auch nur in geringem Maße, belasten, dem Klima aber nichts nützen – Sprengstoff für die öffentliche Akzeptanz.
An dieser Stelle lohnt sich ein Blick auf unsere Nachbarn, die Schweiz und Schweden: Die Schweiz hat sich 2008 für eine nationale Lenkungsabgabe auf fossile Brennstoffe entschieden, die heute 96 Schweizer Franken pro Tonne CO2 beträgt. Die Gelder werden zu einem Drittel in Maßnahmen und Förderungen zur Gebäudesanierung gesteckt, der Rest geht direkt an die Steuerzahler zurück. Dadurch will die Schweiz eine angepeilte Reduktion des CO2-Ausstoßes zu mindestens 60 Prozent im Inland erreichen. Schweden hingegen hat bereits 1991 eine CO2-Steuer in Höhe von 30 Euro je Tonne eingeführt – also schon vor 30 Jahren mehr, als wir uns heute zutrauen. Inzwischen ist der Preis bei 115 Euro angekommen. Die Skandinavier haben diesen für manchen hierzulande schier undenkbaren Vorgang offenbar gut überstanden und wollen bis 2045 klimaneutral sein. Ölheizungen gibt es so gut wie keine mehr, geheizt werden Häuser dort mittlerweile größtenteils über Wärmepumpen. Man muss aber auch ehrlich darauf hinweisen, dass Schweden neben viel Wasserkraft auch noch einen hohen Anteil von Atomstrom nutzt, doch die Einnahmen aus der CO2-Steuer werden genutzt, um den Ausbau der regenerativen Energien vorantreiben.