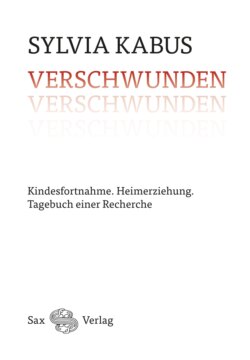Читать книгу Verschwunden - Sylvia Kabus - Страница 10
ОглавлениеEin unmöglicher Zustand aber ist eingetreten
Ein Kapitel Aktenkunde
Jugend ist nachdenklich und aufgeschlossen. Wir müssen viel mehr in sie hineindringen. Wir müssen viel mehr Wege ausfindig machen, mit scharfer Arbeit einsetzen. Wir müssen diesen Halbwüchsigen, der Jugend des kommenden Krieges, den Boden unter den Füßen wegziehen, auf dem ihre Väter seit Generationen gestanden haben.
Anna Seghers
Das ist dann auch gelungen. Eine erziehende Generation, die ihre Kinder ausspähte, ihr nicht Wege bahnte, sondern »den Boden unter den Füßen« wegzog, sie vereinsamte. Der Text ist 1931 verfasst, stellte ich ungläubig fest, ich hatte ihn sofort auf die DDR bezogen mit der als Vision ausgegebenen Gewalt, der einzuzwingenden Erziehung. Er weckte eine Erinnerung an das Studium an der Berliner Humboldt-Universität, als meine Seminargruppe, im Germanistik-Seminar, gegenüber dem Pergamonmuseum, sich ohne Verabredung, doch einstimmig weigerte, die späten, die »Produktions-Romane« von Anna Seghers zu lesen und dabei blieb, auch als ein Eklat folgte. Widerstand hatte sich bis dahin höchstens passiv und schweigend vollzogen, und als ich einmal aufstand und mich laut dagegen verwahrte, Schülern Hass gegen »Klassenfeinde« einzuimpfen, solidarisierte sich niemand im Rund des Vorlesungssaals. Jetzt aber verlangten alle Literatur und Sprache, nicht abgezwungene proletarische Verherrlichung und dröhnend propagierte »Parteilichkeit«.
Auch Seghers, die »somnambule Trinkerin«, wie Fritz J. Raddatz sie bezeichnete,16 spürte in ihren DDR-Jahren, dass es um die Frage des Lebensreichtums, der ganzheitlichen Entwicklung, die jedem zukommen sollte, nicht heikler hätte bestellt sein können. »Das Vertrauen«, so ein Titel der beiden Werke, die wir nun also geschlossen nicht anrührten, war zu diesem Zeitpunkt verlorengegangen, zum System wie zu ihr. Dafür hätte es Schriftsteller gebraucht, die Verständnis für »die Jugend« und deren Not in Schulen, Fabriken, Heimen »hier und heute« eingefordert hätten, besonders Anna Seghers, nachdem sie ihr poetisches Lied auf »einfache« Menschen in der Karibik gesungen hatte und dafür, wie für »Das siebte Kreuz«, gefeiert worden war.
Wer war sie eigentlich?, so lautete unsere Frage. Die Erwiderung: Diese Gesellschaft hatte nicht vor, auf irgendetwas zu antworten.
Früh entstandene Unaufrichtigkeit führte dazu, dass Vergehen an Menschen wie Frau S., Herrn K. und ihren Kindern bis heute existieren und zugleich auch nicht. Aktenkundige Abläufe dürfen trotz öffentlichen Interesses an Entschlüsselung nicht nachgelesen und öffentlich gemacht werden, was unvermeidlich die Erinnerung an die Ohnmacht der Opfer über viele Jahre hin zurückholt, an eine Irrationalität, die in schizophrenen Systemen herrschte und den Einzelnen blockierte. Die vermeintliche Unverständlichkeit von Menschen im und aus dem Osten, ihr »Rätsel« bis hin zu behaupteter »Zurückgebliebenheit« und »Demokratieunfähigkeit« haben hier eine Wurzel.
Die DDR-»Jugendhilfe« blieb bis 1990 eine Domäne der Volksbildung. Diese strukturelle Andersartigkeit gegenüber bis dahin gültiger wie auch bundesdeutscher Praxis erklärt sich mit einer durchgesetzten sowjet-bolschewistischen Kollektiverziehung, dahinter erst nahm die Jugendwohlfahrt einen dürren Platz ein und blieb im Vergleich mit der finanziell stets großzügig ausgestatteten »ideologischen Arbeit« unterfinanziert.
KPD-Mitglieder, mit denen Machtpositionen nach 1945 besetzt wurden, standen für eine Programmatik von »Umformung« und »Umerziehung«. Was anfangs der Vertreibung des Nazi-Geistes aus kriegstraumatisierten Psychen gegolten haben mochte, zielte über die folgenden Jahrzehnte hinweg auf den ideologisch permanent ungenügenden Menschen an sich, der zum Hauptinteresse von Beobachtungs- und Manipuliersucht wurde.
Dass die gewaltbereite Ideologisierung gerade die Jugend besonders unerbittlich traf, wirkte sich als stetige psychische Anspannung aus, die nicht ohne Folgen für die Persönlichkeitsentwicklung bleiben konnte. Kein Kind oder Heranwachsender stand gemeinsamen Veranstaltungen oder »kollektiver Jugendarbeit« ursprünglich ohne Interesse gegenüber, viele aber erlebten sie als zu insistierend und unverrückbar politisch dominiert. Die sofortige Androhung des Schulverweises wegen ein paar abgespielten westlichen Musiktiteln bei einem Klassenabend verstörte, ebenso die selbstzufriedenen Berichte von Geschichts- oder Staatsbürgerkundelehrern davon, wie sie mit Schülern verfahren waren, die vor uns gegen immer und immer wieder ihre Gewaltoption betonende Machthaber – und eben nicht Proletarier – aufbegehrt hatten. An der Erweiterten Oberschule, die ich besuchte, veranstaltete der Kulturbund »Ausspracheabende« zu Themen wie »Sind Oberschüler reaktionär?«, verbleiben durfte nur, wer sich »zum gesellschaftlichen Fortschritt bekannte«, was auch für Lehrer galt. Proteste gab es dennoch, persiflierende Losungen in Klassenzimmern, bei Märschen durch die Stadt, denen die Relegierung folgte. »Klassenkampf«, Lenins Revolutionstheorie des unbegrenzten Terrors realisierte sich nicht irgendwo, sondern nebenan, auf Arbeit, in der Schulklasse, überall, dabei propagiert als »einzig wissenschaftliche Weltanschauung«.
Etwas Zerreißendes wartete hier. Natürlich gab es mitunter heitere »Kollektivität«, geschmetterte Lieder, Sommerleichtigkeit, doch auch Zittern um »Kopfnoten«, die »Verhalten« maßen, ein Schulleben lang. Auch ein Kind konnte spüren, dass die drangsalierende Kontrolle Leben, Unbefangenheit, Freude wegfraß. Wir empfanden Mitleid mit der Generation, deren Jugend der Krieg zerstört hatte, so wenn Lehrer im Unterricht in Tränen ausbrachen bei Erzählungen über Kriegserlebnisse und verlorene Angehörige. Parallel aber erlebten wir die von ihnen ausgeübte Gewalt bei Verhaltensabweichungen oder gar Widerstand. Wesentlichen Beziehungen fehlte so Eindeutigkeit. Das Schutzbedürfnis der Kinder blieb unerfüllt, ihr Heimatgefühl fragmentiert.
Heute ist zu erkennen, welche Autoritätskrise sich damit manifestierte. Damals: Ein heimlich schreckender Zugriff. Nicht Vermittlung und inhaltliche Diskussion, sondern Vorherbestimmung eines jeden zum zukünftigen Kämpfer, gar »Revolutionär«.
Wer stand uns da gegenüber? Trotz allen Wortreichtums war das in diesem Alter nicht auszumachen. In den Lesebuchtexten, von denen noch zu sprechen sein wird, bei Appellen, hinter Zeugnisbeurteilungen? Wer wies an, formte? Das authentische Gegenüber fehlte. Auch die unverrückbar »Gerechten« erstarrten zur Abstraktion. »Denn an einem läßt auch unsere Literatur gar keinen Zweifel: Ohne die Überlebenden, die 1945 aus der Illegalität, aus den Konzentrationslagern und aus dem Exil kamen, insbesondere ohne die klassenbewussten Menschen unter ihnen, fehlte unserer Revolution tatsächlich ihre ethisch-politische Legitimation, ja sie hätte wahrscheinlich gar nicht stattfinden können. [...] Andererseits gehört die zentrale Position, die den Männern und Frauen des deutschen Widerstandes von unseren Schriftstellern von Anfang an eingeräumt wurde, unverzichtbar zu den konstituierenden Faktoren des von der frühen DDR-Literatur entworfenen Menschen- und Gesellschaftsbildes«, so Alfred Klein, »Leiter der Abteilung Geschichte der sozialistischen Literatur (Leipzig) der Akademie der Künste«, 1984, während jeder in der DDR die flächendeckende Beschwerung durch mangelnde Freiheit erfuhr.17
Revolution. Lebenslange Beklommenheit steigt auf bei dem Wort, das mich stets warnte, genau hinzusehen, was darauf in der Wirklichkeit folgte. Und Legitimation! Ohne freie Wahl, freie Wahl zuerst des Denkens, der persönlichen Anschauung. Wer aus dem Klub der selbstermächtigten »Revolutionäre« hätte sich je um Legitimität geschert. Die Rede, gehalten vor dem Rat der Wissenschaften der Akademie der Künste der DDR, zielte, wie so viele, vorbei an den vielbeschworenen »Millionen«. Mit ihnen und nicht oder nicht nur den »Klassenbewussten« hätte Demokratie stattfinden müssen, wenn es je »volksnah« werden, wenn Entwicklung hätte stattfinden sollen. Das alles bedeutete die Unterstellung der Jugendfürsorge unter die »Volksbildung«. Die Funktionalisierung von Kindern durch die sozialistische Erziehung war dabei die weitgehendste Verfehlung. Ihre Würde war in jedem Augenblick antastbar.
Unruhig beobachtet, dann wieder unterstützt von den Archivarinnen, arbeite ich mich weiter vor in aufgespürte Akten. Wohin es welche schriftlichen Hinterlassenschaften nach 1990 verschlagen hat, wie wenig systematisch der Erhalt ist, können auch die Archivarinnen nicht immer sagen, vorwärts geht es nur mit nichts ausschließendem Suchen. Doch dann: Einblicke in die interne Kommunikation und in die Selbsteinschätzung eines Systems. Der Alltag von Jugendhilfe, Heimerziehung, von unterstützungsberechtigten, stattdessen jedoch nicht selten der Willkür unterworfenen Menschen öffnet sich. Bruchstücke intimer, für Kinder und Eltern lebensbestimmender Vorgänge.
In der Optik linker Ideologie sind Sozialismus und soziale Sicherheit bis heute Synonyme. Doch es blieb karg. Schroff. Ärmlich. Auch Jahre nach Kriegsende besteht abwürgende Knappheit weiter, ist Fürsorge schwerlich zu verwirklichen. Bei ausbleibendem Wohlstand der Bevölkerung trifft Sozialabbau besonders Heimerziehung und Pflegekinderwesen. Vehementer Einspruch und die Anmahnung von Menschlichkeit antworten in einem Protestschreiben vom 26.8.1952 auf Richtsätze beim Pflegegeld und bei der Pfändung. Darin wendet sich die Jugendhilfe-Stadtbezirkskommission des 5. Stadtbezirks Leipzig an die bezirkliche Volksbildung und bezeichnet die festgelegten Beträge juristisch wie auch »nach einem gesunden demokratischen Empfinden« als völlig indiskutabel. »Weit schwerwiegender als die rein sachlichen Grundlagen wird hier das demokratische Volksempfinden hintergangen. Abgesehen davon, daß es wohl kaum jemand möglich sein wird, mit diesem Existenz-Minimum auf längere Sicht auszukommen, ist es einem werktätigen Menschen gegenüber völlig unvertretbar, ihn bis auf 90.- DM herunterzupfänden. Diese verantwortungslose Härte muß als Kahlpfändung bezeichnet werden und trägt wohl in keiner Weise dazu bei, die Arbeitsfreudigkeit und Leistungsfähigkeit unserer Menschen zu heben.«18
Man bittet um Aufhebung »derartig rigoroser Richtsätze« und stattdessen um »menschlich vertretbare«. Das hiesige Amtsgericht nähme außerdem eine Pfändung unter 117.- DM überhaupt nicht an. Der Pflegegeldanspruch der Pflegeeltern von Gertrud W., Anlernling in der Baumwollspinnerei Mittweida, wird 1955 von 31,50 DM auf fast Null herabgestuft. Zur Begründung teilt die Döbelner Jugendhilfe dem Rat des Bezirkes am 17.3.1955 mit, dass die Pflegeeltern »nie mit etwas zufrieden sind und ihre Pflegetochter in ihren großen Ansprüchen noch unterstützen«.19 Ein politisches Motiv folgt: »Um der Forderung unserer Regierung nachzukommen, Sparsamkeit bei der Verwendung der Mittel walten zu lassen, haben wir uns zur Einsparung des Pflegezuschusses von monatlich 35,00 DM entschlossen und nur eine mntl. Beihilfe von 10,00 DM bewilligt.« Im selben Jahr bestimmt der Entwurf einer Verordnung über die Verbesserung der Arbeitsbedingungen auf dem Gebiet der Rechte der Kinder die Verpflegungssätze neu. Der Tagessatz für Kinder in Heimen wird von 1,40 auf 1,60 Mark erhöht, der für Jugendliche auf 2,00 Mark.20
Es mangelt an Vergewisserung, ob die Kinder in guten Händen sind, es mangelt an ärztlicher Betreuung, Entwicklungen stagnieren. »Die Hauptabteilung Mutter und Kind, Berlin, hat bei ihren Kontrollreisen wiederholt festgestellt, daß die von ihr überprüften Pflegestellen seit Jahren nicht kontrolliert worden sind. In mehreren Fällen mussten Pflegekinder bei diesen Überprüfungen sofort herausgenommen und anderweitig untergebracht werden bzw. die umgehende Herausnahme veranlaßt werden«, heißt es 1951 in einer Rundverfügung aus dem Ministerium für Gesundheitswesen des Landes Sachsen an die Stadt- und Landkreise.21 Mit der Frage, was zur Beseitigung zuvor festgestellter Mängel im Pflegekinderwesen veranlasst wurde, wendet sich das Ministerium für Volksbildung am 9.2.1955 erneut an den Rat des Bezirkes Leipzig. »Die Angaben der Kreisreferate hinsichtlich der ärztlichen Kontrolle gemäß § 7 der 1. DB vom 9.10.52 sind nach den bisherigen Erfahrungen stark anzuzweifeln. Ferner sind die Ursachen zu erforschen, warum unsere Pflegekinder in ihren schulischen Leistungen zurückbleiben.«22 Laut einer Beschlussvorlage vom 10.2.1955 stellen sich die Leipziger Mitarbeiter von Jugendhilfe und Heimerziehung anstehenden Aufgaben »Zur Überwindung der bestehenden Mängel und Verbesserung unserer gesamten Arbeit«. Unter »1/b)« zählt dazu »eine regelmäßige Unterstützung der westdeutschen Patrioten durch fortlaufenden Briefverkehr mit ihnen und c) durch Geldzuwendungen oder direkte Päckchensendungen«. Auch Erfahrungsaustausch mit westdeutschen Jugendämtern einschließlich Treffen in Leipzig und Westdeutschland, Briefverkehr und brüderliche Hilfe sind zu diesem Zeitpunkt noch vorgesehen. Bitter hierbei der Gedanke, dass DDR-Heimkinder oftmals weder Pakete noch Geld empfangen durften, wie zu belegen sein wird.23
»Ab 1.1.53 werden die zentrale Adoptions- sowie die Prozeßstelle aufgelöst [...], doch wurden der Abt. Mutter und Kind hiermit Aufgaben übertragen, zu deren ordnungsgemäßer Durchführung zunächst jede Fachkenntnis fehlt«24, schreibt der Verwaltungsleiter des Leipziger Dezernats Gesundheitswesen, Mutter und Kind, am 18.12.1952 an das zuständige Ministerium. Hinzu kämen große Rückstände bei den vom Amtsgericht übernommenen Vorgängen. Die Aktenübergabe erfolge spät, es fehlten Arbeitskräfte, das Personal des Amtsgerichts habe »bereits anderweitig Arbeit gefunden. [...] Notwendig ist eingehende und schnellste Schulung aller Kollegen«. Nur wer persönlich bei der Abteilung Mutter und Kind vorspreche, könne mit einer Bearbeitung seines Vorgangs rechnen. Aufgrund von mangelnder Sachkenntnis werde mit Schäden für die Bevölkerung gerechnet.
Reagiert wird damit auf eine brüske Veränderung. Mit der Verordnung über die Übertragung der Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 15.10.1952, nach der fortan die Organe der Jugendhilfe die Aufgaben von Vormundschaftsgerichten übernehmen, tritt eine verhängnisvolle Änderung ein. Mit Gesetz vom 23. Juli 1952 war die Abschaffung der nach 1945 ursprünglich hier und da etablierten Verwaltungsgerichtsbarkeit, der Finanzgerichtsbarkeit und kommunalen Selbstverwaltung in Kraft getreten. Fortan unterlag das Handeln der öffentlichen Verwaltung – im Gegensatz zur Bundesrepublik – keiner Kontrolle durch Bürgerinnen und Bürger mehr, wesentliche rechtliche Ansprüche gingen damit verloren und waren nicht länger einklagbar. Nicht Fachkräfte für Arbeit, Jugend und Soziales, sondern die Organe des Volksbildungsministeriums entschieden fortan über Vormundschaften, Heimeinweisungen und Adoptionen. Jugendwohlfahrt wurde zu »Jugendhilfe«. Eines von sich mehrenden Beispielen dafür, dass Ideologie diskussionslos den Vorrang vor fachlicher Kompetenz erlangte.
Verwaltungsgerichtsbarkeit, ein Wort wie ein Steinbrocken, dabei pures Leben. »Konkretisiertes Verfassungsrecht« nennt sie Fritz Werner, 3. Präsident des Bundesverfassungsgerichts, »Schlussstein im Gebäude des Rechtsstaats« Gustav Radbruch.25 In der Bundesrepublik bildete sie bei zunehmendem Wohlstand und genussvoll gelebter Freiheit ein Recht sicherndes, mit der Zeit als selbstverständlich empfundenes staatsbürgerliches Fundament. Hingegen ging in der DDR mit ihrer Abschaffung die Überprüfbarkeit sämtlicher öffentlicher Akte verloren.
Ein Bruch mit mitteleuropäischer Tradition. Moralisch wie wirtschaftlich zerrüttet, etablierte die DDR vor dem Herbst 1989 beim Obersten Gericht eine Verwaltungsgerichtsbarkeit. Justizminister Hans-Joachim Heusinger informierte am 1.7.1989 im SED-Parteiorgan Neues Deutschland, dass am selben Tag das Gesetz über die Nachprüfbarkeit von Verwaltungsentscheidungen in Kraft trete. Ein ratsames oder angeratenes Mehr an Demokratie im Hinblick auf mögliche Veränderungen? Oder gefordert von westlicher Seite, von Kreditgebern? Gar die Vorstellung von einem möglichen Ende? Genutzt oder erprobt werden konnte die Veränderung kaum noch. Zudem wurden die besagten Gerichte mit bereits bisher fungierenden Richtern besetzt.
Was hätte Frau S., was hätten Eltern ausrichten können, die nicht einmal eine schriftliche Beschlussübermittlung erhielten, wenn ihr Kind in ein Heim eingewiesen wurde? »›Aus der rechtswidrigen Handhabung der öffentlichen Gewalt entstandene Ansprüche‹ konnten durch den Verzicht auf die von der Novemberrevolution erstrittene Freiheit des Einzelnen nicht geltend gemacht werden«, so Rolf Henrich. »Rudolf Bahro widmete sich dem Nachweis, dass es sich bei der Gesellschaft der DDR um eine seit dem Feudalismus nicht mehr dagewesene ›geschichtete Gesellschaft‹ handelt, eine ›Schichtenfolge mit harten Übergängen, verbunden mit einer entsprechenden Rechtlosigkeit und Ohnmacht der unteren Ränge‹«.26 Und der ungewollten Schichten, ist hinzuzufügen. Wer aus dieser Zeit erinnert nicht hochbeliebte »private« Bäcker, Schneiderinnen, Juweliere, Schreibwarenhändler, die verschwanden im Zuge der Vernichtung von »Selbständigen«, welche angeblich »Kapitalisten« seien. Zwei Millionen von ihnen wurden die Lebensmittelkarten entzogen, Tausende sahen sich politisch motivierten Verfahren mit Zuchthausstrafen und Vermögensentzug ausgesetzt. Unverhohlene Raubzüge des Staates, begleitet von zunehmender Gewalt. Im April 1952 – das Jahr begann mit Buntmetallsammlungen der Bevölkerung für den Neuaufbau Berlins – wurden auf Befehl Stalins die Volkspolizei-Bereitschaften zu einer Armee von 300 000 Mann erweitert, der Kasernierten Volkspolizei.
Ein Sturm teils wutentbrannter Beschwerden gegen die Gesetzesänderung und ihre offenbar überrumpelnde Eile ist dokumentiert. Auslöser sind fehlende personelle Voraussetzungen für die Umsetzung in den Ämtern. »Durch die bisherige Kürzung des Stellenplanes in dem Referat Mutter und Kind konnten die Aufgaben im Vormundschafts=, Pflegschafts=, Beistands=, Adoptions= und Pflegekinderwesen trotz Einsatzes aller Kräfte und laufender Überstunden nicht so erledigt werden, wie dies wünschenswert ist und in unseren Gesetzen angestrebt wird«,27 meldet die Delitzscher Abteilung Mutter und Kind am 16.1.1953 an die regierungsamtliche Kontrollstelle für die Arbeit der Verwaltungsorgane. »Ein unmöglicher Zustand aber ist dadurch eingetreten, dass auf Grund der ›Verordnung‹ [...] Aufgaben übernommen werden mussten, ohne dass eine neue Planstelle bereits geschaffen wurde.« Im Interesse Minderjähriger müssten Arbeitsbedingungen geschaffen werden, »die wenigstens als einigermaßen normal angesehen werden können«. Angesprochen wird zudem die fehlende Kompetenz. »Eine Bearbeitung der vom Gericht übernommenen Fälle konnte bisher so gut wie gar nicht erfolgen. Bei den übernommenen Vorgängen handele es sich teils um äusserst komplizierte Rechtsgeschäfte, die keinesfalls nur flüchtig bearbeitet werden dürften. »Diese schwierigen Fälle wurden bei den Vormundschaftsgerichten nicht einmal von den Rechtspflegern, sondern von den Vormundschaftsrichtern bearbeitet.« Eine Nachfrage habe ergeben, dass in den Nachbarkreisen gleiche Schwierigkeiten vorlägen. »Abschließend erlauben wir uns nochmals darauf hinzuweisen, dass die Bearbeitung nicht von Laienkräften, sondern durch eine qualifizierte Kraft erfolgen muss.«
Überforderung bis zur Empörung. Der Grimmaer Kreisarzt verlangt die »Einschaltung« des stellvertretenden Ratsvorsitzenden und informiert fünf Referate und Abteilungen, »denn die Abt. Gesundheitswesen muss es restlos ablehnen, in irgendeiner Form für die Folgen haftbar gemacht zu werden, die durch das ›Quirlen eines weiteren Koches im Brei‹ entstehen. Ein größeres Durcheinander dürfte wohl kaum jemals entstanden sein«.28 Er zeigt sich »felsenfest davon überzeugt, dass noch vor Ostern die ersten Beschwerden wegen nicht gezahlter Unterhaltsgelder hier eingehen. Ich bitte mir verbindlich mitzuteilen, welcher Stelle diese Beschwerden zuzuleiten sind, denn ich stehe auf dem Standpunkt, dass der sich damit auseinander setzen soll, der dieses unheilvolle Durcheinander angestiftet hat. Es versteht sich von selbst, dass ich als Kreisarzt und selbstverständlich auch unsere Referatsleiterin von Mutter und Kind die Verantwortung für die hieraus resultierenden Klagen, um keinen härteren Ausdruck zu gebrauchen, restlos ablehnen muss«.
Übergangsprobleme aufgrund versäumter Vorbereitung, die sich nach und nach lösen lassen? Auch weiterhin wird die Jugendhilfe sich im Kreis nichterfüllbarer Ziele und Zuständigkeitskonflikte drehen. Intern beklagte fachliche und organisatorische Unzulänglichkeit wird chronisch, Anforderungen seitens der Justiz kann nicht entsprochen werden. Nach Kontrollen wird auffallend häufig die prophylaktische und fürsorgende Funktion innerhalb des Aufgabenspektrums angemahnt, ohne dass diesen vorrangigen, nur zu gern als »vornehm« bezeichneten Aufgaben im Interesse von Familien und Einzelnen entsprochen wird.
1952. Auf der 2. Parteikonferenz der SED wird die »Staatsmacht« als »Hauptinstrument« beim planmäßigen Aufbau des Sozialismus in der DDR propagiert. Die Überbetonung von Staat und Partei hat im Laufe der Jahre und Jahrzehnte nicht wenig dazu beigetragen, dass Menschen vom »Glauben« an den Sozialismus abrückten und eine offenkundige Diskrepanz sich im Gefühl vieler verankerte. Im Zuge der zugleich angekündigten »weiteren Demokratisierung« sollen Arbeitskräfte des Staatsapparates freigesetzt werden »für die Produktion«, breite Schichten der werktätigen Bevölkerung wiederum »herangezogen« werden für Aufgaben des Apparates, halten Arbeitspläne des Rates der Stadt Leipzig fest.29 Voran kommen auch längerfristig weder die erforderliche Qualifikation der Mitarbeiter noch Zuordnung und Fokussierung der Arbeitsaufgaben in der Jugendhilfe. Nach einem an das Ministerium für Volksbildung gerichteten Beschwerdekatalog des Generalstaatsanwalts über die mangelhafte Arbeit der Referate Jugendhilfe der Kreise Leipzig-Stadt und Leipzig-Land vom 7.7.1958 legt der zuständige Referatsleiter am 19.8.1958 Rechenschaft ab. Vordergründig stehen notorische Terminüberschreitungen in Jugendstrafsachen zur Debatte, wodurch sich Verfahren verzögerten, abgesetzt oder ohne die erforderliche Zuarbeit der »Jugendhilfe« durchgeführt werden mussten. Doch die Kritik der Generalstaatsanwaltschaft ist umfassend. »Tatsächlich haben sich aber Fälle gehäuft, in welchen zwei bis vier Monate vergingen, ehe die Jugendhilfe die Ermittlungen bearbeitete und abschloß. Durch diese Verzögerungen waren Mahnungen von Seiten der Staatsanwaltschaft und der VP erforderlich«, bestätigt der Referatsleiter die ergangenen Vorwürfe. Ebenso dass »Sorgerechtsangelegenheiten (Entzug des Sorgerechtes, Ruhen der elterlichen Gewalt u. a.) mangelhaft bearbeitet oder nicht durchgeführt wurden«.30 Ein Grund dafür: Mitarbeiter würden »in nicht zu vertretendem Maße in Arbeiten außerhalb des Aufgabenbereichs eingesetzt. [...] Die Mängel in der Arbeit der Jugendhilfe zeigen sich aber nicht nur in der Jugendgerichtshilfe, sondern auch in anderen Teilgebieten, wie zum Beispiel in der Erfüllung der Stellungnahmen zur Sorgerechtsregelung in Ehescheidungssachen, in der Beschwerdebearbeitung sowie in der Einhaltung der Termine allgemein«. Dem Referatsleiter bleibt nur zu bestätigen, dass die Arbeit auf seinem Aufgabengebiet »in den vergangenen Jahren laufend zu Beschwerden Anlaß gegeben« habe, doch verweist er auf die ungenügende »Qualität der Mitarbeiter«. »Diese hat sich zwar mit der Reduzierung der Planstellen etwas gebessert, dass dabei auch einige schwache Kräfte ausgeschieden sind. Aber auch bei den verbleibenden Mitarbeitern liegen noch ernsthafte Mängel in dieser Beziehung vor.«31
Nach Tagungen in mehreren Stadtbezirken ein »Zwischenbericht« der städtischen Abteilung Volksbildung an die Bezirksebene. »Eine Veränderung auf Grund der durchgeführten Ratssitzungen ist in den Referaten Jugendhilfe nicht zu spüren«, hält der amtierende Stadtschulrat fest. »Trotz gegenteiliger Hinweise werden sogar Planstellen gestrichen, so in Süd, Nordost, Südost und Nord. Die Kollegen des Stadtbezirks Nord haben sogar die Absicht, in Zukunft die Stelle des Referatsleiters einzusparen. Sie wollen seine Aufgaben im Kollektiv mit übernehmen.«32
Hartgesottene Eigenmächtigkeit. Die Situation in den Leipziger Stadtbezirken Süd, Mitte und Nordost gilt als »besonders schwierig«. Sorgerechtsregelungen könnten »nur ungenügend bearbeitet werden, um einigermaßen die Frist einzuhalten, was besonders schwerwiegend ist, wenn man bedenkt, dass Sorgerechtsregelungen möglichst endgültig sein sollen. [...] Grundsätzlich kann in den Referaten keine systematische Arbeit geleistet werden ...«33
Eine von Anfang an erschöpfte Gesellschaft? Sie verschleißt sich durch Ideologie und die Fixierung auf »Gefährdungen« einer Jugend, deren angeblichen Kern das verhasste Interesse an westlicher Lebenskultur bildet. Von einem »Zurückbleiben in der operativen Arbeit« berichtet die Jugendhilfe Leipzig an die Bezirksabteilung Inneres. Anlass bieten »Brigadeüberprüfungen« der Referate Leipzig-Land und Südwest in Bezug auf »den Stand und die Bekämpfung der Jugendgefährdung«. Anders als in Westdeutschland sei diese in der DDR »keine Massenerscheinung«34 – was das gewaltsame Vorgehen gegen Treffs Jugendlicher in der Öffentlichkeit, gegen ihre kulturellen Vorlieben oder mutige Demonstrationen im Stadtbild umso fragwürdiger macht –, andererseits wird die »Gefahr« jedoch durch ständige beschwörende Wiederholung eingerüttelt. Die Kontrollbrigaden setzen sich zusammen aus Vertretern der Kommissionen für Volksbildung und Jugendfragen, der FDJ, aus ehrenamtlichen Jugendhelfern, Justiz- und Jugendhilfe-Mitarbeitern. Zu Verheerungen durch »Ehren-Amtlichkeit« später. Erhellend an dieser Stelle die »hauptsächlichsten Ursachen« auftretender Probleme in Heimen. Zwei Drittel der dort untergebrachten Jugendlichen seien Kinder alleinstehender Mütter, die vorwiegend berufstätig sind. Bei einem Drittel der untersuchten Fälle liege Schulbummelei vor, dabei bei jedem zweiten Kind aus häuslichen Verhältnissen, die »in erzieherischer Hinsicht in Ordnung waren«. Der Anteil berufstätiger Mütter bei Sitzenbleibern betrug sogar siebzig Prozent, was den heutigen Schrei nach Kitas nachdenkenswert macht und zu angemessener Deutung von DDR-Kinderbetreuung wie zu früher Trennung überhaupt anregen mag. Die Hälfte aller Heimkinder waren Sitzenbleiber. »Diese Feststellungen decken sich im wesentlichen auch mit der Einschätzung auf dem Gebiete der Jugendkriminalität im Stadtgebiet Leipzig ...«35
Als Ursachen für angeordnete Heimeinweisung nennt der Abschlussbericht zu fünfzig Prozent »überwiegend häuslich erzieherisch unzulängliche Verhältnisse«, die andere Hälfte sei auf »ungenügende Betreuung infolge beruflicher Tätigkeit alleinstehender Mütter, auf Mangel an Hortplätzen, ungenügende Einbeziehung in die Freizeitgestaltung durch die Pionier- und Jugendorganisation« zurückzuführen. Kinder, die politisch unliebsamen Eltern entzogen und eingewiesen wurden, erscheinen dabei nicht, ebenso wenig Heranwachsende, deren Heimerziehung staatlichen Kontrollen zufolge als grundlos beurteilt wurde. Auch über die überfallartig organisierten Kindeswegnahmen wie bei Herrn. K. und Frau S. kein Wort.
»Hingabe«, »im allgemeinen gründlich« erfolgende Berichte, »anzuerkennender Einsatz« werden genannt. Misserfolge dennoch. Das System der Jugendhelfer sei auf einem gewissen Stand der Organisierung stehengeblieben, die ehrenamtlichen Helfer würden im Wesentlichen nur mit Berichten über die Erforschung der häuslich-erzieherischen Situation beauftragt. Die Zahl ist sogar rückläufig und die Gewinnung von Betriebsjugendhelfern in den Anfängen steckengeblieben. »Gegenwärtig ist der Zustand in den Referaten der Jugendhilfe in der Regel so, dass die Jugendhilfe erst dann eingreift bzw. einzugreifen in der Lage ist, wenn staatliche Zwangsmaßnahmen erforderlich sind. Damit muß festgestellt werden, dass die prophylaktische und erzieherisch wirkungsvollste Arbeit der Jugendhilfe sehr wenig zur Anwendung und Entfaltung kommt.«36
Diese Klagen rücken die psychische Verfassung damaliger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Blick. Hohe Reizbarkeit und Verschlossenheit vieler von ihnen im öffentlichen Verkehr, knappe Abfertigung, autoritäre Distanz, die es oftmals unmöglich machte, angstfrei gelöst an Behördengänge heranzugehen, rührten ohne Zweifel auch aus ständigen auslaugenden Zwängen her, die innerlich verhärten oder beschädigen mussten – ausgenommen freilich Mitwirkende, die all dem begeistert und scheinbar mühelos entsprachen, so es sie gab. Bedrückend blieben die perpetuierenden ideologischen Auflagen, weil sich nie jemandem erschloss, wie denn beispielsweise politische und fachliche Aufgaben vollkommen miteinander verschmelzen sollten, ein alchemistischer Vorgang, der sich – weder in der Metallurgie noch im ärztlichen Heilwesen noch in der industriellen Produktion oder wo auch immer – schlicht nicht erzwingen ließ. Die Forderung hatte allein zur Folge, dass Menschen in permanente Verlegenheit gebracht und vor sich lächerlich gemacht wurden, und immer wieder auch sprachen Einzelne Kritik an der üblichen hysterisch-leeren Vorwärtswut, die ohne Hinblick auf erforderliche Kompetenz und deren Sicherung erfolgte, offen aus.
Nicht ausreichend recherchierte, möglicherweise überstürzte Fallentscheidungen werden so vorstellbar auch aus der angespannten Dauerfixierung des Personals heraus, dass sie die Erfüllung vorrangig politischer Auflagen versäumen könnten. Unruhe, die sich auswirkte auf die heruntergefahrene wirkliche Arbeit mit anvertrauten Familien.
Es mag so scheinen, als konzentrierten sich meine Aufzeichnungen auf Dokumente mit besonders oder ausschließlich kritischem Aussagewert. Weder hier noch im Weiteren. Nicht die oftmals überraschenden Inhalte und nicht die enge Abfolge der Alarmrufe aus dem Inneren der Jugendhilfe folgen einer besonderen Auswahl. Zudem: Wer wäre seiner Herkunft gegenüber nicht berührbar, erinnerte nicht gern intakte, Stabilität gebende Lebensumstände, wenn er sie erfahren hat, ein funktionierendes Gemeinwesen mit aufmerksamem Blick auf Menschen, voll »Wärme«, die im Nachhinein zu stärken vermag. Doch es bleibt etwas Ruheloses, das aus »gesetzmäßigen« Gründen – wie sehr Kommunisten dieses Wort doch liebten! – die Sache verdarb. Ein Scheitern an der Unentrinnbarkeit aufgezwungener gesellschaftlicher Zielsetzung, die Recht vermissen ließ.
Dazu die tragikomische Praxis. Das Leben!
Ein weiteres Hindernis bildet die notorisch planlose Planwirtschaft. »Auch die operative Arbeit als des wesentlichsten Mittels, mit dem pulsierenden Leben in aktiver Verbindung zu stehen, ist noch ungenügend entwickelt bzw. ist im Referat Jugendhilfe des Landkreises Leipzig im wesentlichen durch die rigorosen Planstellenkürzungen im Juni 1958 die operative Arbeit fast zum Erliegen gekommen«, schätzt der Bericht der Brigadeüberprüfung weiter ein.37 Gravierend wirkt ein »hoher Ausfall von Arbeitszeiten, weil ein großer Teil der Mitarbeiter zu häufigen Einsätzen außerhalb ihres Arbeitsgebietes herangezogen wurde, wie z. B. 2 Kollegen je 9 Tage zur Überprüfung von Fleischwarengeschäften und Abzug eines Kollegen 14 Tage zur Errechnung von Preisdifferenzen und 5 Kollegen je ½ Tag zum Austragen von Einladungen. An einem Sprechtag – Mittwochnachmittag – wurde sogar ein Mitarbeiter vom Publikumsverkehr weggeholt und eingesetzt zum Zählen von Därmen. Wesentlich mit durch diese Mängel kam es [...] zu der Beschwerde des Generalstaatsanwaltes über das Versagen der vom Referat Jugendhilfe durchzuführenden Jugendgerichtshilfe.« In der Folge »mußte eine Vielzahl von Jugendgerichtsverhandlungen verzögert oder abgesetzt werden. Das hatte zur Folge, daß die Jugendlichen z. T. monatelang auf die Aburteilung warten mußten und indessen in Gefahr kamen, erneut straffällig zu werden. Damit wurde auch das Ansehen unserer Jugendgerichtsbarkeit herabgesetzt«. Unmissverständlich wird hier die mangelhafte »Erledigung der Erforschung der häuslichen Situation der jugendlichen Straffälligen« benannt.38
Lahmende Realisierung. Obgleich von verantwortlichen Stellen auf die steigende Jugendkriminalität hingewiesen wird, reagieren weder die Volksvertretung noch die Räte oder die ständig (herbei-)zitierten ehrenamtlichen und staatlichen Partner darauf; sie alle beschäftigen sich ernüchternd wenig mit Fragen der »Jugendgefährdung«. Als stehe man plötzlich im leeren Raum. Selbst die Abteilung Volksbildung behandelt die Probleme kaum. Notrufe erfolgen. »Die noch verbliebenen Mitarbeiter des Referates haben keinen Überblick mehr über ihr Arbeitsgebiet. [...] Dies bezieht sich insbesondere auf die pädagogische Propaganda, die Anleitung der ehrenamtlichen Jugendhelfer, die Zusammenarbeit mit den Organisationen und die Anleitung und Kontrolle der Aufgaben der Jugendhilfe in den Gemeinden.«39
Der Befund des »Brigadeberichts« ist alarmierend. Es sei nicht gelungen, den Stand der Jugendkriminalität in den vergangenen drei Jahren zu senken, auch Schulbummelei und »das Herumtreiben von Kindern und Jugendlichen« seien verhältnismäßig häufig. Etwa die Hälfte der Delikte und Eigentumsvergehen seien bis auf Ausnahmen nicht durch Not erklärbar. Lösungen für die Zukunft? Stärkere Durchsetzung der marxistischen Konzeption als Grundlage für alle Entscheidungen und Handlungen der Jugendhilfe. Jeder Mitarbeiter soll alle Teilgebiete der Jugendhilfe beherrschen. Vor allem aus Arbeitern der Betriebe sind weitere ehrenamtliche Mitarbeiter zu gewinnen, Jugendhelfer in die sozialistischen Erziehungsaufgaben der Jugendhilfe einzubeziehen.
Ein sofortiger reflexhafter Rückfall in die Abstraktion. Wie sollte eine »stärkere erzieherische Verantwortlichkeit in den Wohngebieten, Gemeinden und Betrieben« aussehen? Zu welchem Klima all das führen? Noch mehr Ausforschung und Kontrolle? Vertrauensschwund untereinander, Schwund von Vitalität hin zu Verkrampftheit des Einzelnen, Erstarrung? In rein politische Richtung zielt die Aufforderung, sich stärker auf »die Auswahl und Qualifizierung der Pflegeeltern und Vormünder zur Gewährleistung der sozialistischen Erziehung der ihnen anvertrauten Mündel und Pflegekinder«40 zu orientieren. Kindeswohl? Auch die »Festigung der häuslich-erzieherischen Verhältnisse« wird genannt, doch vor allem blutlos und beklemmend auf »die Durchsetzung der sozialistischen Erziehung in den der Jugendhilfe unterstellten Heimen« gepocht.
Die »vorwärtstreibende Kraft« des Sozialismus wird zu Sand in überstrapazierten Getrieben. Im Februar 1960 kritisiert der Senat des Bezirksgerichts Leipzig in einem Ehe- und Sorgerechtsbeschluss die »völlig ungenügende« Stellungnahme der Jugendhilfe Delitzsch. Ermittelt werden sollten die Verhältnisse beider Elternteile, ihre erzieherischen Fähigkeiten und die Beziehung des Kindes zu ihnen. Doch »umfaßt die Stellungnahme des Rates des Kreises Delitzsch, Referat Juhi, 4 Sätze, ohne dass aber auch nur mit einem Wort die vorgenannten gesetzlich festgelegten Merkmale erwähnt werden. Denn die Feststellung, dass die Verhältnisse bei den Eheleuten R. nicht sehr günstig seien, sind nach den Angaben der Verklagten ohne jeden Hausbesuch getroffen worden«.41 Der Wohnort des Vaters ist nicht eruiert, die berufliche Tätigkeit der Mutter falsch angegeben. Harsch werden »eingehende Ermittlungen« verlangt, »um diese mangelhafte Arbeit nach über vier Jahren seit Inkrafttreten der Ehe-VO abzustellen«.
Die beanstandete Zuarbeit wurde von einem ehrenamtlichen Jugendhelfer gefertigt. »Der Bericht ist mehr als mangelhaft und sinnentstellend«, nimmt ein Referent der Delitzscher Jugendhilfe dazu Stellung, mehrere Stellungnahmen für das Gericht seien »alles andere als ein Sorgerechtsbericht«.42 Jugendhelfer seien nochmals auf »die Wichtigkeit, Bedeutung der Sorgerechtssachen« hinzuweisen. »In jedem Fall ist mit beiden Elternteilen vom Bearbeiter außerdem eine Aussprache durchzuführen ...« Selbstkritisch wird festgestellt, dass die Jugendhilfe hätte »Hausbesuche durchführen müssen«, jedoch sei kein Kraftwagen dagewesen.
Es fällt schwer, angesichts dieser Zeugnisse an wohlbegründete Sorgerechtsentscheidungen zu glauben, auch die Erfahrungen von Frau S. bleiben dafür zu aufschreckend. Als Jugendhilfevertreter endlich ihre Wohnung in Augenschein nahmen und die Lebensbedingungen ihrer Tochter im Nachhinein nicht beanstanden konnten, änderte das nichts an der Wegnahme des Kindes.