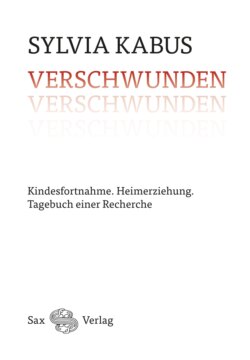Читать книгу Verschwunden - Sylvia Kabus - Страница 8
ОглавлениеFrau S.
Frau S. kann nur schwer laufen. Wegen dem Stock hat sie nicht gleich eine Hand frei für die Blumen, die ich mitbringe. Licht flutet durch die Wohnung, in die sie mich einlässt. Es geht auf Ostern zu und sie lächelt.
Auch ihr begegne ich zum ersten Mal. Nach achtundzwanzig Jahren habe sie ihre Tochter wiedergefunden, sagt sie sofort, als wir ins Zimmer treten, und zeigt auf eine Gruppe gerahmter Fotos. Eine dunkelhaarige junge Frau ist darauf zu sehen, allein, im Hochzeitskleid, mit Bräutigam.
»Jeder sagt, sie ist mir wie aus dem Gesicht geschnitten.«
Gefunden. Triumphierend und einschränkend zugleich klingt das. Frau S. hat vier Kinder. Susanne, die jüngste Tochter, lebt noch zu Hause, sie schaut fern und wirft uns Blicke zu.
»Und sie ist gut in der Schule!«, sagt Frau S.
Susanne schaut weiter und lässt sich Zeit, als ich sie frage, was sie werden will. Tierpflegerin vielleicht, sie habe einen Platz als Praktikantin im Leipziger Zoo in Aussicht. Es könnte klappen. Ihre Schwestern Manuela und Bianca seien bereits aus dem Haus, erzählt Frau S. Nur die Älteste, Annett ... Sie verschwand 1977 aus der Kindertagesstätte, sie verschwand, und auch jetzt hat Frau S. sie nicht wiedergesehen. Sie weiß nur von ihr. Sie kann sie ansehen auf den Fotos im Schrankfach, zwei davon von ihrer Hochzeit.
Frau S. spricht ohne Zögern, mit einem Ausdruck, der offen und erwartungsvoll ist wie der von Herrn K., als er glaubte, ich hätte seine Tochter gefunden. Sie hält noch die Narzissen in der Hand. Die Stimmen draußen vor den geöffneten Fenstern, die beiden Frauen hier, das hat etwas sehr Unmittelbares. Wie eine Garantie, dass das Leben nicht auf einmal abbricht.
Was für ein Gedanke.
Ihr Mann kommt zurück vom Wochenmarkt in der Bornaischen Straße, der ständig größer werde und ein Angebot habe, das den Weg durch die ganze Stadt lohne. Er kaufe dort besser und preiswerter ein als anderswo, außerdem sei er bekannt, weil er regelmäßig komme. »Die Straßenbahn geht von hier durch bis ans Ende«, sagt er, und mit einem Blick zu Frau S.: »Sie will immer mit, aber sie kann nicht laufen, in der Zeit bin ich schon dreimal wieder da.«
»Er sagt, du bleibst da«, kommentiert sie, »und da muss ich bleiben.«
»Manchmal geht sie doch mit, dann wird sie gleich überall begrüßt«, sagt er, und sie tauschen ein Lächeln. In dem Fall holt er zu Hause erst die Einkäufe nach oben und dann sie. Manchmal zieht sie sich auch allein, Stufe für Stufe am Geländer hoch. Frau S. sollte zur Operation, aber dann haben sie ihr doch keine neue Kniescheibe eingesetzt. Sie lacht jetzt bitter, oder als könne sie nur lachen.
Die Treppe im Haus ist aus Fertigbeton und halb so breit wie in umliegenden Bürgerhäusern. Da wo sie an die Wände stoßen soll, ist ein Schlitz, durch den man die Etagen hinabblicken kann bis ins Erdgeschoss. Was Halt geben soll, sieht aus wie bloß aneinandergestellt. Das Geländer wirkte zerbrechlich wie eine Attrappe. Schwer vorzustellen, wie Frau S. die Stufen bewältigt.
Ich bin gekommen, um sie nach der 1977 verschwundenen Tochter zu fragen. Ihre Spannung überträgt sich auf mich, der schnell wechselnde Ausdruck fällt mir auf, eine humorvolle Leichtigkeit. Dazwischen ausdauernde, nicht ablenkbare Blicke. Eine scharfe Aufmerksamkeit für das, was vorgeht. Die, habe ich das Gefühl, setzt keine Sekunde aus.
Sie hat Hausaufgaben von Susanne vor sich liegen, als wir uns gegenübersitzen. Dass ich ihre Erzählung auf Band aufnehme, möchte sie nicht, aber mitschreiben kann ich. So haben wir beide ein Heft auf den Knien.
Die Mutter von Frau S. arbeitete in einem Krankenhaus. Sie gab die Tochter im Babyalter, wie damals nicht unüblich bei Schichtarbeit, in eine Wochenkrippe. Doch ehe das Kind eine bewusste Beziehung zu ihr finden konnte, wurde es ihr nach einer Denunziation weggenommen. Frau S. wächst beim Vater und seiner neuen Frau auf, die leibliche Mutter verschweigt er ihr lebenslang. Erst 2004, als diese stirbt, erfährt sie von ihr durch einen Verwandten, der im Internet lange nach ihr gesucht hat.
»Ich habe immer gekämpft«, sagt sie mit blitzenden Augen. »Gekämpft gegen die Verunglimpfung meiner Mutter und gekämpft um meine Tochter.«
Die Stiefmutter, Ruth, ist damals Stallarbeiterin in einer LPG im Landkreis Leipzig, wie auch der Vater. Es scheint ein Angstverhältnis für Frau S. gewesen und geblieben zu sein. Für die Stiefmutter und deren Kinder ist sie die Stiefputze, die ausgegrenzt wird bei den Mahlzeiten, die aus dem Zimmer muss, wenn Gäste kommen, die als dumm hingestellt wird. Eine Kindheit der von Erwachsenen ausgekosteten Demütigung.
»Ich bin mit Prügel aufgewachsen«, sagt sie.
Sie hätte zu einer eingeschüchterten Haussklavin werden können. Nach der Schule lernt sie Köchin. Die Stiefmutter holt ihren Lohn ab. Als sie erwachsen wird und auszieht, sagt sie: »Ich komme nicht mehr zu dir.«
»Und warum?« fragt die Stiefmutter zurück und schlägt ihr ins Gesicht.
Woanders ist es besser. Sie arbeitet in der Mensa der Karl-Marx-Universität in Leipzig. »Es war wunderschön«, sagt sie, »wir haben gutes Essen gekocht, gelacht, wir haben Witze gerissen. Ich war so klein, ich kam immer nicht hoch an die Regale und brauchte einen Hocker. Ich besaß jetzt eigene Sachen, mein Chef hat für mich ein eigenes Konto angelegt, er hat mir sozial viel geholfen. Auch bei der Suche nach einer Wohnung.«
Er ist es, der sie unterstützt, bis ihr Monatslohn auf ein eigenes Konto überwiesen wird und ihr gehört.
»›Damit du mal zur Ruhe kommst‹, sagte er. Er hatte … etwas Feines.«
Sie erhält Auszeichnungen, lernt Wärme und Unterstützung kennen. »Fein« nennt sie auch die Eltern ihres Mannes, der bei diesen Worten lächelt. »Wie die mich umarmt haben. So eine große Zuneigung, mein Mann hat nur gestaunt.«
Man kann sich vorstellen, dass sie schnell Sympathie findet, so herzlich und spontan. Überhaupt. Sklavin. Alles andere als das.
1977 wird Annett geboren. Frau S. lebt im Aufgebot, steht vor der Verheiratung. Sie und ihr Verlobter sind glücklich über das Kind. Sie haben eine Wohnung eingerichtet, das Kind ist gut versorgt. Leben, nach einer Kindheit und Jugend, in der ihr Freude und Integrität weggeschlagen wurden.
Trotz all dem verschwindet Annett im selben Jahr aus der Kindereinrichtung.
»Ich komme in die Krippe in Taucha und frage, wo ist mein Kind?«
»Das ist abgeholt.«
»Von wem?«
»Regen Sie sich nicht auf.«
»Ich hole die Polizei.«
»Machen Sie das nicht, wir haben einen guten Ruf.«
»Sie haben keinen guten Ruf. Wo ist mein Kind?«
Die Stiefmutter habe es »abgeholt«, mit drei Polizisten, erfährt sie schließlich. Sie verlangt ihre schriftliche Einwilligung als Mutter zu sehen. Es existiert keine.
Sie geht erneut hin, und wieder. Sie kann gar nicht anders, angesichts der betäubenden Leere, die sich auftut. Sie verlangt, dass die Leiterin kommt und sich stellt.
Unmöglich. Die Leiterin lässt sich nicht mehr sprechen.
»Es war eine Entführung. Später, irgendwann nach Neunundachtzig, war auch die Kindereinrichtung abgerissen. Nein. Zu mir ist niemand gekommen nach dem Ende der DDR«, sagt sie. Und auch: »Die sind alle weg, obwohl sie alle da sind.«
Damals forderte sie eine Erklärung von ihrer Stiefmutter. »Wo ist meine Tochter?« Und blieb ohne Antwort.
»Ich bin zum Jugendamt gerannt. Die haben mich voll rausgeschmissen: Sie können das Kind nicht erziehen. Das brauche ich Ihnen nicht zu erklären, das geht Sie nichts an.«
»Wieso geht mich das nichts an!«
»Mit Ihnen diskutiere ich nicht.«
»Das ist mein erstes Kind! Haben Sie gehört? Mein erstes Kind!«
Die Gesprächsabläufe sind nur zu glaubwürdig, in Konfliktfällen mit dem Staat zahllose Male erfahren.
In Frau S. ist die Fassungslosigkeit geblieben. Die erbitterte Klarheit. Jede Empfindung von damals.
»Stur. So stur. Die Frau im Jugendamt war so böse mit mir!«, sagt sie hochrot. »Ich habe mich gewehrt. Mein Kind hat alles, ich kann es dem Staat vorweisen. Bett, Versorgung, zu essen, einen eigenen Schrank, alles Geforderte!«
Jetzt, hinterher, nicht vorher, wie es ihre Pflicht gewesen wäre, kommen Behördenmitarbeiter sich ihre Wohnung ansehen und bestätigen, es ist alles Nötige da.
»Das darf doch nicht wahr sein«, sagt jemand vom Amt.
»Eigentlich waren sie entsetzt. Aber was weg ist, beißt nicht mehr.«
Sie antwortet ihnen: »Gottes Mühlen mahlen langsam, aber dann schrecklich.« Und: »Sie müsste man eigentlich schlagen für jede Lüge, die sie meiner Stiefmutter glauben.«
»Na, sagen Sie mal!«, wundern sich die Fürsorger.
»Der Richter wusste nicht, ob er lachen oder weinen sollte«, sagt sie.
Doch sie glauben dem Amt. Ruth.
»Sie wollen doch nicht sagen, dass diese Frau im Recht ist?«, hält Frau S. ihnen entgegen.
»Da können wir nichts machen.«
»Das war die größte Frechheit des Jugendamtes«, sagt sie, »zu behaupten, ich hätte mein Kind alleingelassen.«
Sie bricht zusammen bei der Arbeit. Der Chef schickt sie heim. Es kommt zu einer Verhandlung.
»Mein Kind hatte alles«, wiederholt sie. Sie bietet Nachbarn und Bekannte als Zeugen auf. Sie legt ihre Auszeichnungen vor. Sie setzt durch, dass Jugendhilfemitarbeiter mit zu ihrem Chef kommen, der ihre tadellose Arbeit bestätigt.
»Trotzdem haben sie mir nicht beigestanden.«
Man sprach nicht mit ihr. Vorher nicht, danach nicht, jetzt nicht. Es gab kein »Beratungskonzept« für die jungen Eltern, keine Hilfe. Kein Gehör.
Doch der Staat will ihre Zustimmung zu dem, was geschehen ist, ihre Unterschrift.
Sie lehnt immer wieder ab, eine Weile geht das so hin, mit ihrer Verweigerung. Schließlich wird sie ins Jugendamt Taucha bestellt. Dort sind auch Polizisten anwesend.
Sie fragt sofort, was sie damit zu tun hätten.
Frau S. hat eine schnell erfassende Art, durchschaut Vorgänge und spricht sie laut aus. Wie gegen böse Geister.
»Entweder Sie setzen sich hin und hören zu, oder ...«
Sie bleibt stehen und schreit los, dass sie nie und nimmer unterschreibt.
»Wer hier was zu sagen hat, das sind wir!«, ist die Antwort. »Klack. Da gehen Sie in den Knast, wenn Sie so saudämlich sind.«
Sie sagt immer wieder nein.
»Gut, da gehe ich in den Knast.«
Handschellen lagen da, als sie kam. Sie sollte sie sehen. Für den Staat gab es nichts zu besprechen. Sie sind mehrere gegen eine, da ist es möglich, dass Worte nichts mehr bringen.
»Ich hatte schon die Handschellen um.«
Für den Arzt und Psychotherapeuten Karl-Heinz Bomberg bilden Menschen, die der repressive SED-Staat aufgrund bestimmter Verhaltensweisen, die zum Beispiel als Asozialität oder staatsfeindliche Hetze ausgelegt oder fehlgedeutet wurden, eine der Hauptgruppen politisch Verfolgter.7 Wer durch häusliche Gewalt bereits Urvertrauen verloren habe, nicht auf positive Erfahrungen zurückgreifen könne, müsse erst recht entschädigt werden. Das Gegenteil sei leider oft der Fall.8 Was erlebte Frau S. durch das schocktraumatische Verschwinden ihres Kindes? Die Verweigerung menschlicher Achtung, den Einsatz von Gewalt. Angst. Rufzerstörung. Methoden, welche die »Grundsäulen des Selbstwerterlebens« (Bomberg, 2011) schädigen sollten und auch ohne Staatssicherheit Bestandteil perfektionierter operativer Psychologie oder Zersetzungskunst waren.
Dazu die Stiefmutter. Was hatte sie davon, das eigene Enkelkind, das, wie sie selbst wusste, nicht vernachlässigt war, auszuliefern? Rache für die Unabhängigkeit der jungen Frau? Für ihren Widerstand, den Aufbau eines eigenen Lebens?
»Von Rechts wegen«, sagt Frau S., »hätte meine Stiefmutter mein Kind nicht abholen dürfen, nicht ohne meine Vollmacht. Das war undenkbar. Aber sie hat sich von jeher gebrüstet, dass sie immer wieder Kinder weggeholt habe. Sie ging zum Jugendamt, erzählte ich weiß nicht was, danach wurden sie abgeholt. Die haben ihr geglaubt, oder sie hatte einen bestimmten Einfluss. Wen hätte man da eigentlich wegsperren müssen?«
Ihre strahlende Vehemenz nach Jahrzehnten. Aber auch Panik, die wieder hochsteigt, vor einer irrationalen Kraft wie der Denunziation? Vor urplötzlicher Ent-Machtung? Einem Überfall von irgendwo her?
Wie sollte sie die nicht haben? Oder gar befreit sein, wo nichts ans Licht geholt ist, Ungelöstes als geregelt gilt. »Ein negatives Erbe, das niemand haben will, aber keiner ausschlagen darf und kann, weil es untrennbar Bestandteil der deutschen Geschichte ist ...«9 »Wenn sie wüsste, dass ich sie gefunden habe, dass ich meine Tochter gefunden habe«, sagt sie immer wieder. Aufmerksam sieht sie mich an, offenbar kann sie Gedanken lesen: »Wenn Sie meine Stiefmutter kennen würden ... Sie würden sich auch fürchten.«
Auch sie erlebte die damalige Verantwortliche in der Jugendhilfe Leipzig-Schönefeld, von der Herr K. sprach. »Man hatte noch gar nichts gesagt: Halten Sie den Mund. Nur Einschüchterung. Sofort kam sie damit, dass sie einen einsperren. Von mir aus. Dann sperren Sie mich eben ein«, antwortete sie damals, und bestätigt: »Ja, es stimmt. Nach Neunundachtzig war die Frau weg wie nichts.«
Ihre Verlobung zerbricht nach dem Schock des Verschwindens der Tochter.
Sie suchte nach ihr von 1977 bis 2005.
Machtlose Jahre. Nach 1989 nimmt sie den Kampf erneut auf. Noch einmal vergehen sechs Jahre. Sie lernt die Nachwende-Ämter kennen und deren Personalkontinuitäten. Ein Schlaganfall folgt dem nächsten, sie ist halbseitig gelähmt. »Die Druckmittel waren existentiell, psychologisch und moralisch so umfassend, dass sie bei den meisten Menschen ernste Folgen verursachen mussten.«10 Die Stiefmutter bleibt eine Angstgegnerin. Doch warum beraubte sie sich des eigenen Stiefenkels? Zerstörungsdrang? Gehörte er zum Halbdunkel des Lebens in der DDR? Weckte die allgegenwärtige Nötigung zum »Mitmachen« derartig paradoxe, selbstschädigende Regungen?
Selbst in einem entschlossenen Menschen wie Frau S. lebt Angst nach erlittener Denunziation weiter. Schatten dieser Art haben eine lange Halbwertzeit; auch wenn bekannt ist, wer jemanden bezichtigte, bleibt etwas Gesichtsloses. Diese intensive Nachwirkung ist nur mit einem Lebensalltag zu erklären, in dem Recht hinter aufgezwungene Ideologie zurücktrat und selbst bei Beweisen staatlicher Fehleinschätzungen und -urteile keine Korrektur erfolgte. Edith Könze, ehemalige Journalistin und jahrzehntelang Mitarbeiterin der Arbeiter- und Bauerninspektion, einem DDR-Kontrollorgan mit Wurzelmyzel in viele Alltagsbereiche des Lebens hinein, bestätigte mir in zahlreichen persönlichen Gesprächen, dass es im Jugendhilfe-Bereich regelmäßig Denunziationen gab und danach »nicht lange gefackelt« worden sei. »Wenn da einer was sah, in der Nachbarschaft oder irgendwo, ging es ruckzuck. Das war rabiat, lange gefragt wurde nicht.« Oftmals sei die tatsächliche Situation gar nicht klar erwiesen gewesen und wurde nicht nachgeprüft, Anschuldigungen genügten für das, was sie »kurzen Prozess« nennt: fehlendes Gespräch und Vergewisserung, Entzug von Erziehungsrecht, Heimeinweisung, erzwungene Adoption.
Bürger wurden ebenso heftig zur »Mitwirkung« geworben wie bei Widerspruch sanktioniert. Eine Stunde Null des Vertrauens brachte der Sozialismus nicht mit sich. Zur Ausforschung von Familien hingegen, bei der Privates durchwühlt wurde auf der Suche nach der politischen Gesinnung von Menschen, waren Amt und »ehrenamtlichen Kräften« keine rechtlichen Grenzen gesetzt, wie sich aus den Akten erschließen wird. Das galt für Schule wie Betrieb, »Jugendhilfe« und ihre Kommissionen, Gewerkschaft und Wohnbezirksausschuss, für jede Organisation, jeden Bürger und jede Bürgerin. Ungute Vermischungen entstanden, aus Pathos und Revolutionsgehabe, aus Zwang und Verwundung. Eine Perversion von »Gemeinsamkeit«, die verhinderte, dass Lebensbereiche souverän gelebt werden konnten. Die charakteristische diffuse Verunsicherung im Inneren betraf nicht Ausnahmen, sondern war allgemein.