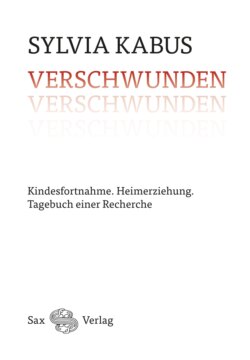Читать книгу Verschwunden - Sylvia Kabus - Страница 9
ОглавлениеHinter Glas. Lachen
Beschränkte Auskünfte
Im Stadtarchiv erfahre ich von der Leiterin, sie habe die Akten des DDR-Jugendamtes vernichten lassen. Die aus den Stadtteilen Südost oder Ost seien in einem Keller untergebracht und schimmlig gewesen, »das ging nicht mehr«. Einen Moment lang fällt mir nichts ein, das ich darauf sagen könnte. Auch sie schweigt. Schimmel? Schimmel sei gesundheitsschädlich. Sie wird ein wenig rot im Gesicht.
Anruf im Jugendamt und Frage nach dem Archiv. Das stimmt erst ratlos, »aber ich gebe Sie mal weiter«, heißt es, so lande ich bei einer Mitarbeiterin, die es betreue.
»Bei mir lesen Sie gar nichts! Alle vor Sechsundvierzig Geborenen sind im Container. Sie finden nichts. Fünf Jahre nach der Volljährigkeit kam alles weg in der DDR. Adoptionen: sechzig Jahre nach Geburt. Das ist der heutige Stand. Wenn ich nach bin mit DDR in zwei Jahren, gibt es überhaupt nichts mehr.«
Sie mag meine Fragen nicht, antwortet abgehackt.
»1994 bis 1998 ist alles weggekommen. Das Stadtarchiv hat sein Okay gegeben.«
»Wohin kamen die Akten? Was heißt weg?«
»Das wurde im Neuen Rathaus vernichtet. 1996 ist das Turmzimmer geräumt worden.«
Ich frage nach Adoptionen.
»Selbst das kriegen Sie nicht raus.«
»Das glaube ich nicht.«
»Viele Adoptionsakten sind wegen Zecken weggeschmissen worden. Sie waren verzeckt.«
»Verzeckt?«
»Verzeckt, und Wasserschaden.«
»Wer hat das entschieden?«
»Das Stadtarchiv. Sie können ruhig in die Adoptionsvermittlungsstelle gehen, Sie finden nichts.«
Ich sage, ich hätte den Eindruck, dass sie das freut.
»Von mir kriegen Sie gar nichts.«
Sie lässt keine nachdenkliche Ebene zu. Zwei Dinge verstärken sich gegenseitig: Die Breitseite der Verweigerung und der Grobianismus der DDR, authentisch wie am ersten Tag. Es scheint kein Gespräch möglich.
»Alles ist weg. Sie finden nirgends was. Es hat in der DDR keine Zwangsadoptionen gegeben. Es gab eine einzige, in Berlin. Eine. Gab es nicht. Hat’s nicht gegeben.«
Im allgemeinen Sozialdienst der Stadt explodiert eine Stimme, als ich frage, wie ich Frau N., das damalige amtliche Gegenüber von Herrn K. und Frau S., finden könne.
»Das dürfen Sie nicht, solche Fragen. Was weiß ich denn, wer Sie sind! Das ist alles Datenschutz. Sie dürfen gar nichts. Nichts.« Sie schreit. »Das Personalamt bewahrt Personalakten nur fünf Jahre nach Ausscheiden auf.«
Sie ist aufgeladen mit neuem Recht, versucht es laut bellend mit Einschüchterung. Neues Recht, neue Angst? Davor, die Demokratie nicht korrekt zu handhaben, ertappt, erkannt zu werden, die in der DDR innegehabte und heute fortgeführte Anstellung zu verlieren?
»Eine öffentliche Verwaltung gestattet zumindest Anfragen, auch nach einer ehemaligen Mitarbeiterin!«
»Gehen Sie zum Ordnungsamt. Zum Einwohnermeldeamt.«
»Mit nur einem Nachnamen?«
»Hier bekommen Sie nichts.«
Die lange zurückliegenden Geschichten von Herrn K. und Frau S. treiben mich an. Sie sind frisch, stechend, nichts daran ist abgeschliffen. Ich dränge, insistiere, frage weiter. Ignoriere, dass ich abgestoßen werden soll. Absurd. Nach all den Wagnissen, Verfolgungen, illegalem und offenem Widerstand in der DDR möchte man lieben, nicht erneut ankämpfen. Außerdem gibt es doch gar keine Gegenseite mehr. Oder?
Ein Überfall. Den Archivaren ist entgangen, dass sie mir Aktenkopien über Immobilienbewegungen in der DDR ausgehändigt haben. Aufzeichnungen über Verkäufe, zweifelhafte staatliche Vorgänge, politischen Druck, der ausgeübt wurde, um zu Grundstücksaneignungen zu gelangen. Nun haben sie es entdeckt. Überstürzt werde ich aufgefordert, zwei Mitarbeitern zu folgen. Es geht in eine enge Glaskabine, die ansonsten der Überwachung des Lesesaals zu dienen scheint. Hocherregt folgt eine Belehrung. Ich dürfe nichts »verwenden« von dem Gelesenen, keinen der Namen nennen, vor allem nichts über Immobilien. Ich verweise auf meine Bücher über die Friedliche Revolution und über vertriebene Juden der Stadt Leipzig, um Vertrauen herzustellen. Ein langjähriger Leiter des Archivs hat Letzteres positiv rezensiert, die Titel sind ihnen bekannt, scheinen die Bestürzung aber noch zu steigern. Ich muss an Jürgen Fuchs denken, dessen Mitarbeit in der Gauck-Behörde wegen »zu erwartender Veröffentlichungen« und »Indiskretionen sattsam bekannter Art und Weise«11 verhindert werden sollte. Und wie er selbst sich sah mit den Augen der Gegenseite: »Staatsfeind«, »schriftstellernder Dissident«, »Einzelkämpfer«, »einer von denen, die gefährlich waren und vielleicht noch sind«,12 »Menschenrechtler, leidgeprüfter Federfuchser«,13 »selbsternannter Stasijäger von der Straße«14.
Die Atmosphäre in dem Glaskasten bleibt irrational. Ich mache darauf aufmerksam, dass nicht ich verantwortlich sei für Akten, die mir ausgehändigt wurden. Wir kleben in der Vitrine, erstickend für alle, physisch und psychisch, wobei ich offenkundig die weniger Erschrockene bin. Angespannte Menschen. War die Freundlichkeit, Gelöstheit aller Offiziellen nach dem Herbst 1989 tatsächlich nur eine Momentsache? Ein historischer Augenblick, wie es so schön hieß, und jetzt ist nervöse Angst historisch?
Institutionen. Diese deutsche Lehre über Unmöglichkeit.
Als der Himmel am Nachmittag grau wird nach der weißen Sommerglut, hellgrau wie das Archiv, als draußen endlich Wind aufkommt, frage ich am Desk, ob man die Fenster im Lesesaal öffnen könne. Schweigend wird überlegt. Ziemlich lange. Tiefernste Augen sehen mich an. Jemand gestattet eine halbe Stunde Durchzug.
Ich lese mich erneut in Aktenmappen ein, deren Umschläge an Farben alter Klassenzimmer erinnern, verblichen wie abgegriffenes Holz, grünlich wie zerkratzte Wände.
»Erinnerung ist Krankheit, Empfindsamkeit, Pathologie.« Einer der Sätze, die Jürgen Fuchs hinterließ.
Ich schwitze, muss wischen, reiben, ständig, unbeschreiblich.
Rita Jorek, Kunsthistorikerin und Autorenkollegin, bringt mich in Kontakt mit Frau B., einer Koordinatorin in der Jugendamtsleitung Leipzig. Sie und andere Kolleginnen würden den Mangel an Aufarbeitung der Geschichte des Jugendamts beklagen, sagt sie, und wären bereit, mit mir zu sprechen. Journalisten aus alten wie neuen Bundesländern, erfahre ich im darauffolgenden persönlichen Gespräch, stellten ständig Anträge auf Recherchen, ohne Antwort. Zu Adoptionen in der DDR käme mindestens eine Anfrage pro Woche. »Es wird alles abgeblitzt.« Hinter vorgehaltener Hand werde gedeckelt, die Mitarbeiterinnen sprechen von Verdunkelung. Sie fühlen sich alleingelassen. Eine gestaute Situation.
Sie will meine Recherche beim Jugendamtsleiter unterstützen, er könne eine Sondergenehmigung erteilen, erfahre ich. Seit langem erwarten die Mitarbeiterinnen eine rechtliche Begründung für die Abweisungen. Das Rechtsamt sei gefragt, rühre sich jedoch nicht, lehne einfach ab. Ich solle die Amtsleitung mit den eigenen Ansprüchen konfrontieren, Rechtsamt, Pressereferat, nicht lockerlassen.
Eine andere Mitarbeiterin erzählt von Demütigungen damals. Von Fürsorgerinnen wüssten sie, dass abtreibungswillige Frauen vor Kommissionen erscheinen mussten, auch Vergewaltigte wurden gezwungen, Kinder auszutragen, sie seien sogar mit Häme konfrontiert worden, in dem Sinn, sie seien »selber schuld!«.
Sie nennt mir eine Abteilungsleiterin im jetzigen Landesjugendamt Chemnitz, sie habe das meiste Fachwissen nach jahrzehntelanger Praxis in der DDR.
Das Jugendamt befindet sich im Leipziger Stadtteil Plagwitz. Dahingleitende Boote auf dem Kanal, die mittlerweile weltweit bekannte Wollkämmerei mit ihren Künstlern und Lofts. Dagegen die langen Häuserriegel des Amtes in der Naumburger Straße. Kasernenartige Gänge durchziehen das Gebäude. Der leichte Schritt wird langsamer, das, was Neunundachtzig nah schien, fraglicher. Umbrüche, Tempi, Energie, aufgebrochene Zeiten.
Ich schreibe an das Pressereferat, rufe im Landesjugendamt Chemnitz an. Die ehemalige Vertreterin der DDR-Jugendhilfe und heutige Abteilungsleiterin sieht keine Chancen, »Einzelfälle« zu untersuchen, nur in »wissenschaftlicher Verallgemeinerung«. Auch mit Forschungsaufträgen erfolge eine »Bloßlegung« nur in den zurückgenommenen Formen der Wissenschaft.
Was sie sagt, folgt postwendend auf meine Fragen und klingt routiniert.
»Was ist wissenschaftliche Verallgemeinerung ohne Einzelfälle?«, frage ich.
»Adoptionsunterlagen werden am erfolgten Ort aufbewahrt. Das Stadtarchiv besitzt auch Verwaltungsschriftgut. Es kann sein, dass es Einblick gibt. Wenn sie wollen«, betont sie. Eventuell sollten es die Eltern mit mir machen.
Abgeschnurrt, wie auf Knopfdruck. Dann macht sich etwas Luft in ihr.
»Aber Kindeswegnahme! Was denn für Zwangsadoptionen? Zeigen Sie mir mal eine. Nein.« Oft habe die »Jugendhilfe« Bescheide über den Entzug des Sorgerechts geschickt, die Eltern nicht ernstnahmen, das könne auch für Gespräche gelten. Sie will nie unangekündigten Kindesentzug erlebt haben und wird noch bestimmter. »Gucken Sie sich mal die Grausamkeiten des heutigen Rechts an. Wenn es so grausam für die Eltern war, dann hätten die sich ja nach der Wende gemeldet.«
Frau S. hat sich gemeldet. Trotz eines Traumas, das ihr amtlich zugefügt wurde, zog sie drei weitere Kinder groß. Sie alle haben Berufe, keines war in einem Heim. Sie selbst ist das Virulente an ihrem Fall. In ihrer Hintergründigkeit ist jeder einzelne Wartetag aufgehoben. Schlagfertig, sticht sie hervor aus dem erzwungenen Schweigen Anderer, die die Erwartung, sie mögen »sich melden«, wie Hohn anmuten muss.
Ich mache dennoch einen Versuch, der »Jugendhelferin« die Vereinsamung von Eltern vor Augen zu führen, die Bedeutung des »Einzelfalles«, der faktisch und seelisch bis heute unaufgelöst bleibt und zur Wissenschaft dazu gehöre. Ich spreche von Angst und gewaltsam erzeugten Schuldgefühlen, von denen sie womöglich umklammert waren oder noch sind, von Problemsituationen, bei denen keine Jugendhilfe half.
»Adoptionsakten dürfen eingesehen werden von dem adoptierten Kind und den Sorgeberechtigten. Die leiblichen Eltern haben kein Einsichtsrecht mehr. Nur im Verwaltungsverfahren StGB 1 und 10. Nach der Adoption hat sich das erledigt«, leiert sie.
Erledigt. Wo habe ich das gehört? »Das hat sich damit erledigt«, bekam Herr K. gesagt, damals, von der Frau im Jugendamt, die »eine Qual« war.
Die Abteilungsleiterin lacht ein altbekanntes Lachen über Zwangsadoptionen.
»Was? Wo sollen die denn sein?«
Das Lachen hat Kraft. Es ist sich sicher, dass niemand es widerlegt, daher der verächtliche Beiklang. Eine Gefahr, sagt es, ist historisch ausgestanden. Es hätte anders kommen können, aber nun ist es so, ein nahtloser, vollrunder Erfolg.
Ich lege auf.
Was sie sagt, ist nicht wahr. Dem Argument, Eltern hätten Benachrichtigungen übersehen oder unbeachtet gelassen, standen Behörden gegenüber, die nicht immer, doch oftmals zu verhärtet auf einflusslose Menschen herabblickten, um sie zu stützen oder auch nur lückenlos zu informieren. Diesbezügliche Akten werden hier immer wieder von amtlichen Versäumnissen sprechen. Während der Erzählung von Herrn K. meinte ich einen Moment lang, er müsse doch wissen, was er in einer so gravierenden Sache wie der Wegnahme seiner Tochter unterschrieben hat, was genau auf dem Papier vor ihm stand, schließlich war es lebensentscheidend. Dann aber holte mich ein bekanntes Gefühl ein. Ich erinnerte mich daran, dass betäubende Umstände und massive Einschüchterung buchstäblich Inhalte und Wahrnehmung auszulöschen vermögen. Was erlebte er bei der Vorladung, die die Trennung von seinem Kind besiegelte? Absoluten Druck und die Erkenntnis, dass er beistandslos vor Menschen saß, die Entscheidungen über ihn, ohne ihn getroffen hatten.
Lautes Lachen also. Und auf der Opferseite Ohnmacht, im Erinnern und im Lebensgefühl der Gegenwart. Thomas Hoppe spricht von der »Zäsur der Lebenswelten, die Menschen, die zu Opfern von Systemunrecht wurden, von jenen trennt, die dieses verantworteten oder solches Handeln stillschweigend akzeptierten. Letzteren gelingt es meist, in und nach Wendezeiten in der unter neuem Vorzeichen entstehenden gesellschaftlichen Realität wieder Fuß zu fassen, sich nicht selten erfolgreich darin zu etablieren, ja den Gang der weiteren Entwicklung womöglich maßgeblich mitzubestimmen und so erneut Verhältnisse entstehen zu lassen, die den eigenen Interessenlagen und Präferenzen günstig sind«.15 Dafür ist die Koryphäe am anderen Ende der Leitung ein kaum prägnanter zu denkendes Beispiel.