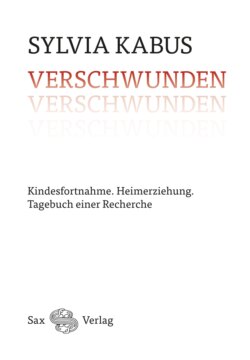Читать книгу Verschwunden - Sylvia Kabus - Страница 5
ОглавлениеVorbemerkung
Die Gewalt ist dabei nicht verschwunden, wohl aber hat sich die Vorstellung verbreitet, dies sei geschehen.
Teresa Koloma Beck
Die Geschichte der aus vorgeblich sozialen Gründen den Eltern entzogenen, in Heime eingewiesenen und adoptierten Kinder bleibt das am zögerndsten berührte Thema innerhalb der DDR-Aufarbeitung. Auch mit zeitlichem Abstand können Geschädigte nicht damit rechnen, vorurteilslos und mit angemessener Sensibilität ausstehende Gerechtigkeit zu erlangen. Schicksale sind seit 1989 bekannt geworden und haben Erschütterung ausgelöst, anders die Intimität des damaligen Staates. Amtliche Pflichtverletzungen und Vergehen, fälschliche Bezichtigung der »Asozialität«, Strategien der Überwältigung im Umgang mit den leiblichen Eltern, Erpressung zu Unterschriftsleistungen – bei Fallanfragen in Archiven und Behörden ruft der Themenkomplex schnell Zurückweisung und vielgestaltige Verweigerung hervor. Der individuelle Hergang des Kindesentzugs damals und der Blick auf Verantwortliche bleiben weiße Flecken in der Geschichtsschreibung.
Ein toter Punkt ist zu überwinden. Von dieser Bemühung berichtet das vorliegende Buch. Es entstand auf der Grundlage einer mehrjährigen Recherche. Begonnen als Bericht über Eltern, die durch die Fortnahme ihres Kindes in der DDR verwaisten, und als Suche nach unerschlossenen Aktenquellen zu diesem Thema – hierin auch der Hoffnung des Berichtes »Aufarbeitung der Heimerziehung in der DDR« folgend –, konturierte sich durch direktes Herantreten an damals wie auch an heute Verantwortliche unabweisbar ein weiterer Aspekt. Bekanntlich scheitern Anträge auf Einsicht in Adoptions-, aber auch in bestimmte Verwaltungsakten zumeist bereits im Moment des Bemühens darum. Publizisten und Wissenschaftler aus Ost und West sind dadurch gleichermaßen an ihren Nachforschungen gehindert; spätestens hier wird das Fehlen einer nicht zu ersetzenden Dimension von Aufarbeitung und buchstäblicher Aufgeschlossenheit bemerkbar, wie sie nach 1989, in einem »neuen« Deutschland, erwartet werden durfte. Gewalt wohnte mitten im Licht, wird aber bis heute nivelliert, herumgestoßen, ignoriert. Allzu oft – in Behörde, Wissenschaft und Politik – wird mit dem Verweis auf DDR-Gesetzeslagen Auseinandersetzung geopfert. Beklemmende Übervorsicht führt zur gegenseitigen Blockierung gesellschaftlicher Kräfte. Personalkontinuitäten und fehlender gesellschaftlicher Diskurs über Recht und Rechtsmissbrauch in Unrechtssystemen erzeugen ein Maß von Abwehr gegen Aufklärung, das einer Demokratie unangemessen erscheint. Dies erwies sich bei unternommenen Rechercheschritten in Ost und West.
Das Trauma DDR ist Erbe und Leid eines ganzen Volkes und nicht zu trennen vom anderen Deutschland, dessen Entwicklung auf dem Gebiet der Jugendhilfe, neben zahlreichen anderen Facetten, hier ebenfalls Aufmerksamkeit geschenkt wird. Den lange getrennten Landesteilen gemeinsam sind Wurzeln einer partiell dunklen Pädagogik, aus denen sich die heute geltende Priorität der Achtung vor dem Kind und seinem Wohl entwickelte. Dabei wand sich die Geschichte der Anerkennung von Vergehen und rechtsverletzender Machtausübung unter anderem in deutschen Heimen atemstockend langsam durch die Jahre, in der Bundesrepublik bis in die Siebzigerjahre, östlich davon bis nach Systemende. Das Thema Zwangsadoption erregte die Bundesrepublik dank der Freiheit der Medien, ohne dass dies zu einem politisch entschlossenen Einsatz der Regierung dagegen führte.
Durch komplexe gesellschaftliche Verdrängung scheinen manche historischen Gegenstände und menschlichen Geschichten von selbst einen Abschluss zu finden, der in aller Unnatürlichkeit natürlich anmutet. Moderne Gesellschaften, so schreibt Teresa Koloma Beck 2017, scheinen der Gewalt den Rücken gekehrt zu haben, so gelte sie eher als Modernisierungsdefizit. Dies treffe nicht zu. »Diskursive Verschleierung«, die »Blockierung von Beobachtungsinstanzen«, »Ausschluss der Öffentlichkeit« seien Versuche, Gewalt der Aufmerksamkeit zu entziehen. »Wohl reduzieren sich die Horizonte des Handelns, in denen systematisch mit Gewalt gerechnet werden müsste«, dennoch existiere sie als soziale Praxis weiter, sogar mit Potenzialen »zuvor unvorstellbarer Reichweite und Intensität«.
Zu irisch-katholischen Waisenhäusern, in denen hemmungslos vergewaltigt wurde, Kinder mit kochendem Wasser übergossen oder winters nackt in Schuppen eingesperrt wurden, zu Schweizer Verdingkindern, die der administrativrechtlichen Aufsicht sozial unannehmbar erschienen und teilweise bis 1980 zu schwersten Arbeiten bei Fremden gezwungen und durch Misshandlungen geschunden wurden, zu gequälten Heimkindern in Ost und West Deutschlands, auf die Gesellschaften lange mit angespanntem Schweigen antworteten, treten aktuell sexueller Missbrauch beispielsweise im Sport und in der künstlerischen Ausbildung sowie tief beunruhigende Statistiken, nach denen pro Woche drei Kinder gewalttätig zu Tode gebracht werden und die Opferzahlen häuslicher Übergriffe bis zur Tötung sprunghaft ansteigen. Eine hinlängliche Befragung der Gewaltproblematiken und -wurzeln in bedrängenden Vergangenheiten, als Wahrheitsfindung und Prävention, steht aus.
Schicksalsbeschreibungen, denen der Blick auf den konkreten amtlichen Hergang und agierende Personen rechtlich verweigert bleibt, können nicht länger genügen. Hier mag auch eine Antwort auf die Frage liegen, was an systemischer Gewalt in der DDR noch interessieren kann nach vermeintlich ausreichender Thematisierung. Oftmals meinen Menschen, beinahe unendlich viel von einem Gegenstand aufgenommen zu haben, doch Überdruss stellt sich auch ein, wenn Tiefe, wenn Durchdringung im Interesse fruchtbaren Weiterkommens nicht erreicht wird. Die allergische Gereiztheit ist dann echt, die bereitwillige Aufnahme nicht. Man ermüdet an einem Zuviel, das ein Zuwenig ist.
In der DDR habe es vermutlich Hunderte unfreiwilliger und politisch motivierter Adoptionen gegeben, so wurde im Frühjahr 2018 das Ergebnis diesbezüglicher Vorstudien berichtet. Juristen rechnen mit weit mehr. Ein nicht überraschender Befund, der von den Betroffenen eher still und unbemerkt zu tragen war, die ausreichend Grund hatten, keinen Augenblick an »wissenschaftlich begründete« Angaben von »fünf« oder »sieben« Zwangsadoptionen zu glauben. Heute leben in den westlichen Bundesländern Hunderttausende Ostdeutsche durch Ausbildung, Ortswechsel und andere Aufbrüche, viele davon sozialisiert durch eine Erziehungsdiktatur, die weiterhin ihre Anhänger findet. Aktenerschließung und Erzählung über die Lebensräume von Kindern und Jugendlichen damals im vorliegenden Buch sollen dem eine realitätsbasierte Sicht gegenüberstellen.
Es ist Menschen und einer Jugend gewidmet, die Überforderung, stereotyper Denunziation auch ohne Spitzel, ständiger politischer Mobilisierung und einer besonderen Gnadenlosigkeit ausgesetzt waren. Dies zuweilen, wie die Dichterin Gabriele Eckart schrieb, »so allein wie an dem Rande eines Freitods«.
Sylvia Kabus
München, April 2019