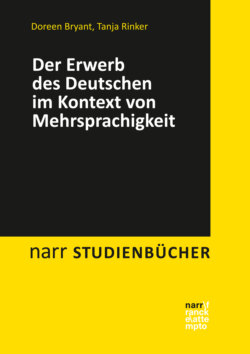Читать книгу Der Erwerb des Deutschen im Kontext von Mehrsprachigkeit - Tanja Rinker - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.1 SprachrhythmusSprachrhythmus
ОглавлениеUnter SprachrhythmusSprachrhythmus versteht man die bestimmten Regularitäten folgende zeitliche Gliederung lautsprachlicher Äußerungen (Pompino-Marschall 2009: 248). Entscheidend hierbei sind die prosodischen Grundeinheiten, von denen man annimmt, dass sie tendenziell in gleichmäßigen Abständen aufeinander folgen (Isochronie-HypotheseIsochronie-Hypothese). Bezüglich der zugrundeliegenden Einheiten lassen sich Sprachen dem akzentzählenden, silbenzählenden oder morenzählenden1 RhythmustypRhythmustyp zuordnen. Deutsch zählt zu den akzentzählenden Sprachen (wie auch Englisch, Niederländisch, Russisch). Bei diesem Rhythmustyp ist der Isochronie-Hypothese zufolge der Abstand zwischen den betonten Silben – also die Dauer eines Betonungsintervalls – annähernd gleich. Diese Einheit wird auch als FußFuß bezeichnet. Ein Fuß umfasst immer eine betonte SilbeSilbe und die dazugehörigen unbetonten Silben bzw. die unbetonten Silben bis zur nächsten AkzentsilbeAkzentsilbe. Bei den silbenzählenden Sprachen (z. B. Französisch, Spanisch, Türkisch) sind im Kontrast zu den akzentzählenden Sprachen die Betonungsintervalle von unterschiedlicher Dauer, die Silben als prosodische Grundeinheiten hingegen von gleicher Länge. Abb. 1.1 veranschaulicht die beiden Rhythmustypen. Dargestellt sind mit Bezug zur Zeitachse die Silben (σ) mit Hervorhebung der Akzentsilbe und die akzenttragenden Intervalle, die prosodischen Füße (Σ). Durch die Visualisierung wird deutlich, dass bei den akzentzählenden Sprachen, deren Betonungsintervalle tendenziell gleich lang sind, bei mehrsilbigen Füßen ein gewisser KomprimierungsdruckKomprimierungsdruck auf den unbetonten Silben lastet. In Abb. 1.1 sind sie daher deutlich kürzer dargestellt als die Akzentsilben. Der Komprimierungsdruck verursacht VokalreduktionVokalreduktion oder VokaltilgungVokaltilgung und kann sogar zum SilbenausfallSilbenausfall führen. So wird im Deutschen der ReduktionsvokalReduktionsvokal [ə] (der sog. Schwa-LautSchwa-Laut) oft gar nicht realisiert (z. B. spricht man Vogel laut DUDEN-Aussprachewörterbuch [fo:.gl] und Garten als [gar.tn] aus und nicht etwa [fo:.gəl] und [gar.tən]. In einigen Kontexten wirkt der Schwa-Laut silbenbewahrend (z. B. sehen, rennen, einen). Wird er an diesen Stellen getilgt, kommt es zum Silbenausfall. Damit ist dann in der akustischen Wahrnehmung beispielsweise die Akkusativform des indefinten Artikels (einen [ʔaɪ.nən] → [ʔaɪ.nən] → [ʔaɪn]) kaum mehr zu unterscheiden von der einsilbigen Nominativform ein, was sich erschwerend auf den Erwerb des nominalen Flexionsparadigmas auswirkt.
Abb. 1.1:
akzentzählendsilbenzählendIdealisierte Isochronie des akzentzählenden und silbenzählenden Rhythmustyps
Auch wenn die Isochronie-HypotheseIsochronie-Hypothese in ihrer strengen Form messphonetisch nicht aufrechterhalten werden kann, lassen sich in den Sprachen der unterschiedlichen Rhythmustypen verschiedene phonologische Merkmale beobachten, die als Auswirkungen einer Isochronie-Tendenz verstanden werden können (Pompino-Marschall 1995: 236).
Einige dieser Merkmale sind (neben der bereits erwähnten VokalreduktionVokalreduktion) in Tab. 1.1 dargestellt. Wir beschränken uns im Folgenden auf den akzentzählenden und den silbenzählenden Typ und vernachlässigen den eher selten vorkommenden morenzählenden Rhythmus (z. B. im Japanischen).
| silbenzählende Sprachen (z. B. Türkisch) | akzentzählende Sprachen (z. B. Deutsch) |
| einfache SilbenstrukturSilbenstruktur (präferiert KV) | verschiedene, teils komplexe Silbenstrukturen |
| klare Silbengrenzen | Ambisilbizität (Silbengelenk)Silbengelenk2 |
| keine VokalreduktionVokalreduktion | VokalreduktionVokalreduktion in unbetonten Silben |
| keine distinktive VokalquantitätVokalquantität | distinktive VokalquantitätVokalquantität |
| Vokalharmonie3Vokalharmonie möglich | keine VokalharmonieVokalharmonie |
| fester Wortakzentfester Wortakzent | freier Wortakzentfreier Wortakzent |
Tab. 1.1:
Merkmale silbenzählender und akzentzählender Sprachen (nach Auer & Uhmann 1988: 253; Bredel 2013: 378; Hirschfeld & Reinke 2018: 65); K = Konsonant, V = Vokal
Tab. 1.1 mit den verschiedenen rhythmusassoziierten Phänomenen gibt eine ungefähre Vorstellung von der Komplexität der Lernaufgabe und zeigt gleichzeitig auf, welche Aspekte zu berücksichtigen sind, will man Deutschlernende einer silbenzählenden Erstsprache an den deutschtypischen SprachrhythmusSprachrhythmus heranführen. Von den kontrastierten Phänomenen sind es insbesondere der WortakzentWortakzent, die Silbenstrukturen und die distinktive VokalquantitätVokalquantität, die bekanntlich Schwierigkeiten bereiten. Die folgenden Abschnitte widmen sich diesen drei Bereichen.
Aufgaben
1.* Wie lassen sich im Rahmen der Isochronie-HypotheseIsochronie-Hypothese die bei akzentzählenden Sprachen zu beobachtenden Komprimierungseffekte (VokalreduktionVokalreduktion bzw. Wegfall unbetonter Silben) erklären?
2.** Welcher der drei Sätze entspricht (tendenziell) der isochronischen Beispielsequenz? Begründen Sie Ihre Antwort.a.Die Zeit wird umgestellt.b.Jürgen liebt Flohmärkte.c.Plötzlich erschien ein Geist.
3.*** In akzentzählenden Sprachen wird der Akzent „in vielfältigerer Weise grammatisch genutzt“ als in silbenzählenden Sprachen (Auer & Uhmann 1988: 250). Man denke beispielsweise an die Minimalpaare trennbarer und untrennbarer Verbformen ('umstellen vs. um'stellen, 'wiederholen vs. wieder'holen). Welche weiteren Bereiche, bei denen die Akzentsetzung Unterschiede bewirkt, fallen Ihnen für das Deutsche ein? Lesen Sie vergleichend bzw. ergänzend zu Ihren Überlegungen sowie zu weiteren Akzentphänomenen die Seiten 250-252 in Auer & Uhmann (1988).