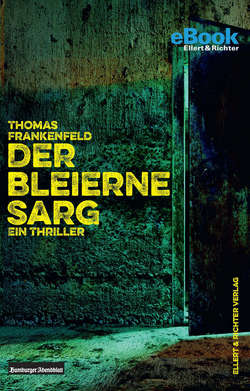Читать книгу Der bleierne Sarg - Thomas Frankenfeld - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
10
ОглавлениеHamburg
„Jetzt begreife ich allmählich, warum Sie dabei sind“, sagte Hartdegen mit scharfem Blick auf die Hauptkommissarin und lehnte sich im Sessel zurück. Er musterte sie scharf. „Abteilung fünf?“
Shahin nickte. „Richtig. Sie sind ausgezeichnet informiert, Herr Professor. Ja, ich gehöre der Abteilung fünf im Landeskriminalamt an; operativer Einsatz und unterstützende Ermittlung. Es ist meine – nein, es ist unsere Aufgabe, alles über die die Entstehung und die Hintergründe dieses Virus herauszufinden, vor allem aber natürlich, die Täter dingfest zu machen, bevor sie weitere Massaker begehen können.“
Thomsen meldete sich zu Wort. „Gibt es eigentlich schon irgendwelche Verlautbarungen oder Forderungen seitens der Täter? Die werden ja wohl nicht einfach so elf Menschen ermordet haben. Die wollen doch sicher irgendetwas.“
„Sie haben recht. Es ist in der Tat eine Forderung eingegangen.“
Ein weiteres Bild erschien; es zeigte einen auf Arabisch verfassten Text, über dem ein Emblem stand. Es war ein schwarzes Banner, in dessen Mitte der weiße Umriss eines Adlers zu sehen war. Der Raubvogel wies ein schwarzes Auge in Form eines Totenschädels auf. In seinen Krallen hielt er das Sturmgewehr von Typ Kalaschnikow AK-47, allgegenwärtiges Symbol islamistischer Terrorgruppen von Tunesien bis Indonesien. Shahin zeigte auf das Bild.
„Dieses Schreiben stammt von einer bislang unbekannten radikalislamistischen Gruppe namens ‚Falken von Hattin‘, offenbar eine Tarnorganisation oder Filiale des ‚Islamischen Staates‘. Möglicherweise wurde sie auch nur für diesen Zweck gegründet. Soweit ich recherchiert habe, bezieht sich der Name Hattin auf die entscheidende Niederlage der europäischen Kreuzritter gegen Sultan Saladins Heer im Jahr 1187. Und zwar bei einer Hügelgruppe unweit von Jerusalem – nämlich den Hörnern von Hattin.“
Lindberg nickte zustimmend.
„Dieses Schreiben ging etwa zeitgleich mit dem Anschlag auf Hallig Hooge bei der Landesregierung ein“, fuhr Shahin fort. „Darin wird die Freilassung eines Mannes gefordert, der gegenwärtig in Haus sechs der Hochsicherheitsabteilung der Justizvollzugsanstalt Hamburg-Billwerder einsitzt. Der Massenmord von Hooge wird in dem Schreiben als ‚Demonstration‘ und ‚erste Warnung‘ bezeichnet.“
Wieder ein Klicken, wieder ein neues Bild. Es zeigte einen blonden, bärtigen Mann, etwa Mitte dreißig, der mit finsterem, abweisendem Blick in die Kamera starrte.
„Dieser sympathische Herr ist Arnfried Jestermann, geboren 1984 in Hannover. Bürgerliches Elternhaus, abgebrochenes Politikstudium, abgebrochene kaufmännische Lehre und vor allem abgebrochene Moral. Anfang 2014 reiste er in die Türkei. Überlebende des Massakers an den Jesiden in der Sindschar-Region im Nordirak durch Kämpfer des ‚Islamischen Staates‘ berichteten von einem auffallend hochgewachsenen, blonden Deutschen, der sich besonders bei den Gräueltaten hervorgetan habe. Er habe den Kampfnamen ‚Abul el-Hol‘ getragen.“
„Der Vater des Schreckens“, nickte Lindberg. „So wird die große Sphinx-Statue in Gizeh seit alters her genannt. Kein schlechter Kampfname für einen Dschihadi. Zumindest originell.“
Shahin setzte ihren Vortrag fort. „Jestermann wütete danach vor allem in Mossul, der zweitgrößten Stadt des Irak, die 2014 unter die Terrorherrschaft des IS geriet und 2017 von Koalitionstruppen befreit wurde. Er wurde im Mai 2019 durch die britische Spezialeinheit SAS bei Erbil gefasst und ein paar Monate später an Deutschland ausgeliefert. In Billwerder wartet er auf seinen Prozess. Wir glauben, dass er über umfassendes Wissen darüber verfügt, wie sich der IS nach den schweren Niederlagen in Syrien und im Irak neu organisiert hat, wo seine Trainingslager und Waffenverstecke liegen, wer seine neuen Feldkommandeure sind und wie seine aktuelle strategische Ausrichtung aussieht.“
„Oha. Kein Wunder, dass der IS ihn zurück haben will“, murmelte Hartdegen. „Ich vermute, wenn dieser Mann auspackt, wäre das der Todesstoß für den IS?“
„Zumindest würde es den Kampf gegen den IS stark erleichtern“, bestätigte Shahin. „Jestermann kennt Führungspersonal, Taktiken, Verbindungen zu anderen radikalislamistischen Organisationen und Zellen, zum Beispiel auch in Deutschland.“
„Warum versucht der IS ihn dann nicht einfach zu liquidieren?“, fragte Lindberg.
„Weil dies ein verheerendes Signal für die ohnehin verunsicherten Anhänger und Kämpfer des IS wäre“, entgegnete Shahin. „Es würde ja bedeuten, dass der IS seine treuesten Kämpfer bedenkenlos opfert. Mit den Anschlägen zur Freipressung von Jestermann aber demonstriert die Terrororganisation, dass sie sich um ihre Leute kümmert.“
Shahin besprach mit den Anwesenden, welche Aufgaben jeder übernehmen könnte. Im Anschluss machte sich Lindberg sofort auf den Weg nach Wedel, um im Stadtarchiv nach Hinweisen zu dem Toten im Bleisarg zu suchen.
Wedel in Holstein
Das Archiv war im Untergeschoss des Wedeler Rathauses untergebracht, eines Backsteingebäudes im Zentrum der Stadt, dessen baulicher Kern 1937 auf dem Gelände des Städtischen Gasthofes errichtet worden war. Die Archivarin war bereits vom Landeskriminalamt verständigt worden und gestattete Lindberg Zugang zu den Regalen und Schränken mit alten Schriften. Sie instruierte den Archäologen über das verwendete Archivsystem und Lindberg machte sich auf die Suche.
Als Archäologe und Anthropologe waren ihm Archive vertraut und er wusste, wie man darin suchen musste. Nachdem er die nächsten Stunden in dem staubtrockenen Raum in Wedel verbracht hatte, rief er Becca Shahin an.
„Haben Sie irgendetwas gefunden, das uns weiterhelfen könnte?“, fragte sie sofort.
„Ich denke schon. Das Wedeler Archiv hat erstaunlich viele Schriften aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges“, antwortete Lindberg geduldig.
„Und?“
„Ich habe in Kirchenakten, Sterbebüchern, Familienchroniken und amtlichen Verlautbarungen gestöbert. Vieles bleibt immer noch im Dunkeln, aber so allmählich wird wenigstens ein roter Faden in der Sache sichtbar. Ich glaube, ich weiß jetzt, wer der Tote in dem Bleisarg ist und warum er auf diese Weise bestattet wurde.“
„Das würde ich gern persönlich und ausführlicher hören. Sie fahren jetzt sicher nach Schleswig zurück?“
„Ja, ich muss mich dringend duschen und ein Bier trinken nach den Stunden mit staubigen Akten.“
„Gut“, sagte Shahin, „wenn es Ihnen recht ist, komme ich morgen in Ihr Büro im Archäologischen Landesamt. Passt Ihnen neun Uhr?“
Lindberg stimmte zu und machte sich auf den Weg nach Hause. In seiner Kehle saß der Staub uralter Akten. Zuhause angekommen, trank er ein kaltes Bier. Und dann noch eines. Anschließend fiel er todmüde ins Bett.
Schleswig
Die Hauptkommissarin war – Lindberg hatte es nicht anders von ihr erwartet – am nächsten Morgen absolut pünktlich. Er bot ihr einen Kaffee an und beide setzten sich in einen freien Konferenzraum.
„Na, dann erzählen Sie mal, Dr. Lindberg. Ich muss sagen, ich bin wirklich sehr gespannt.“
Der Archäologe blätterte in seinen Aufzeichnungen. „Ich habe telefonisch bei Dr. Winter vorhin noch ein paar Informationen zu hämorrhagischen Fiebern eingeholt“, begann er. „Das soll uns als Basiswissen dienen. Sie haben ihren Ursprung im subsaharischen Afrika. Es wird vermutet, dass die Viren dort von den ursprünglichen Wirten – das waren Fledermäuse, Flughunde oder auch Affen – irgendwann auf den Menschen übergesprungen sind. Seit wann es diese Viren gibt, wissen wir jedoch nicht. Und natürlich auch nicht, wann der erste Mensch daran starb. Einen ‚Patienten Null‘ können wir allenfalls bei heutigen Seuchenausbrüchen identifizieren.“ Er zog eine handschriftliche Notiz heraus. „Wie zum Beispiel ein zweijähriges Mädchen aus dem Dorf Meliandou in Guinea. Es starb am 6. Dezember 2013 – innerhalb von drei Wochen folgten ihm seine Schwester, seine Mutter, seine Großmutter und eine Krankenschwester, die es gepflegt hatte. Die Gäste der Trauerfeier für die Verstorbenen verbreiteten die Seuche dann im ganzen Land.“
„Entsetzlich“, murmelte Shahin.
„Doch die für uns entscheidende Frage ist natürlich: Wie kam das Virus im 17. Jahrhundert von Afrika nach Wedel?“, fuhr Lindberg fort. „Das war damals immerhin eine Reise von mehreren Wochen; außer Seeleuten, einigen Forschern und ein paar wagemutigen Händlern gelangte doch niemand dorthin. Schon gar nicht kurz nach dem entsetzlichen Krieg, der ein Drittel der Deutschen umgebracht hatte.“
Er klappte seinen Laptop auf und klickte einige abgespeicherte Dokumente an.
„Ich bin im Wedeler Archiv auf einen Mann namens Johannes Heinsohn gestoßen“, sagte er. „Er stammte aus einer alten Seefahrerfamilie, wurde in Wedel geboren, laut Kirchenregister im Jahr 1619, lebte und starb auch in dieser Stadt. Heinsohn war Steuermann und fuhr jahrelang auf einem Hamburger Handelsschiff, einer Karacke namens ‚Anna von Stralsund‘. Im Mai 1658 kehrte er von einer Afrikafahrt zurück. Das Schiff hatte Elfenbein und Zuckerrohr in Kamerun aufgenommen, die Fracht wurde im Hamburger Hafen gelöscht.“
Shahin stützte den Kopf auf die Arme und hörte sehr konzentriert zu. Lindberg bemerkte, dass sie eine kleine Haarsträhne beim Binden ihres Pferdeschwanzes übersehen hatte; sie hing hinter ihrem linken Ohr herunter. Er lächelte und blickte wieder auf den Bildschirm des Computers.
„Es ist ein Glücksfall für uns, dass Heinsohn während der Reise eine Art Tagebuch führte, das er später daheim seiner Familie vorlesen wollte. Damals gab es ja noch kaum Zeitungen, und Nachrichtenmagazine schon gar nicht. Solche persönlichen Tagebücher von Reisenden berichteten den Familien allerlei über die große Welt draußen. Aus Heinsohns Tagebuch erfahren wir, dass er auf der Rückfahrt von Afrika schwer erkrankte und beinahe starb. Er habe viel Blut verloren, schrieb er.“
Shahin kniff die schwarzen Augen leicht zusammen. „Wissen wir, woran er erkrankte?“
Lindberg lehnte sich knarrend im Stuhl zurück. „Nicht genau, nein. Es ist in den Aufzeichnungen bezüglich dieses Blutverlustes aber ausdrücklich von einer Krankheit und nicht von einer Verletzung die Rede. Heinsohn litt bis zu seinem Tod im Jahr 1662 an heftigen Schmerzen und erblindete fast; seinen Beruf als Seemann konnte er nicht mehr ausüben. Die Blutungen und die Spätfolgen wären in der Tat typisch für ein hämorrhagisches Fieber, hat Dr. Winter mir gesagt. Die letzten Jahre hat Heinsohn sein Haus nur noch selten verlassen.“
Die Hauptkommissarin sah ihn skeptisch an. „Ein hämorrhagisches Fieber? Wie Ebola oder Lassa? Gab es das damals überhaupt schon?“
„Die meisten Erkrankungen, mit denen sich Menschen heute herumplagen müssen, gibt es bereits seit Jahrtausenden“, sagte Lindberg. „Es gab nur nicht jede Krankheit überall auf der Welt. Zum Beispiel waren Pocken, Masern oder die Grippe im Mittelalter in Amerika völlig unbekannt. Der Vernichtungszug der spanischen Konquistadoren gegen die Reiche der Azteken und Maya war nur deshalb möglich, weil die indigenen Menschen wie Fliegen an diesen eingeschleppten Krankheiten starben. Diese Krankheiten gab es dort vorher nicht. Und daher besaßen die Menschen auch keine Abwehrkräfte.“
Lindberg schenkte der Polizistin noch einmal Kaffee nach.
„Stellen wir uns einfach mal vor, dass Heinsohn in Afrika mit einem hämorrhagischen Fieber infiziert wurde, das er jedoch überlebte. Er blieb aber weiterhin für eine Weile der Träger dieses Virus und könnte bei seiner Rückkehr nach Wedel durch Körperkontakt oder infektiöse Wäsche, Kleidung oder Gegenstände seine Familie angesteckt haben. Wie die Akten im Stadtarchiv von Wedel zeigen, starben Heinsohns Frau und Sohn kurz nach seiner Rückkehr und wurden auf dem alten Friedhof an der Kirche beigesetzt.
„Wie wahrscheinlich ist es denn, dass ein Mensch im 17. Jahrhundert ein hämorrhagisches Fieber überleben konnte?“, fragte Shahin. „Eine ärztliche Versorgung und geeignete Medikamente gab es ja wohl noch nicht. Und diese Pestärzte mit ihren seltsamen Vogelmasken hatten doch keine Ahnung, womit sie es zu tun hatten.“
„Sie haben völlig recht. Für die damalige Zeit würde es wirklich an ein Wunder grenzen, dass Heinsohn überlebte. Wenn es ein hämorrhagisches Fieber war“, räumte Lindberg ein. „Wie mir Dr. Winter erzählte, liegt die Sterblichkeitsrate bei Ebola zum Beispiel – abhängig vom Virustyp – in unserer Zeit zwischen dreißig und neunzig Prozent. Beim Ausbruch 2014 und 2015 in Westafrika lag die Rate im Durchschnitt bei dreiundsechzig Prozent. Und dies bei intensiver medizinischer Betreuung. Das Erstaunliche ist aber: Es gibt tatsächlich Menschen, die diese Krankheit aus eigener Kraft überleben können. Und es gibt sogar Menschen, die aus bislang unbekannten Gründen vollkommen immun gegen bestimmte Ebolaviren sind. Wer die Krankheit überlebt, bleibt mindestens einige Jahre lang immun.“
„Warum erkrankte die Schiffsbesatzung dann nicht auch?“, warf Shahin ein.
„Das wissen wir doch gar nicht“, entgegnete Lindberg. „Aufzeichnungen darüber gibt es nicht. Die Inkubationszeit bei Ebola kann bis zu drei Wochen betragen. Wir wissen nicht, wann Heinsohn andere Menschen angesteckt haben könnte und wie eng der Kontakt zur Besatzung gewesen war. Es ist möglich, dass die Krankheit bei der übrigen Besatzung erst ausbrach, als das Schiff schon im Hafen lag. Im Übrigen dürfte man in Zeiten der Pest auf einem Schiff einen Kranken mit derartig dramatischen Symptomen sehr schnell und wirksam isoliert haben. Wir können hier nur spekulieren. Theoretisch ist es sogar möglich, dass Heinsohn niemanden an Bord infizierte, eben weil er in seiner Koje blieb. Aber hier bewegen wir uns auf dünnem Eis.“ Lindberg blickte wieder auf seinen Laptop. „Heinsohns Aufzeichnungen aus den letzten Jahren sind schwer zu entziffern, weil er kaum noch etwas sehen konnte und seine Schrift sehr krakelig wurde. Aber er beklagt sich darin, dass man ihn miede, weil er angeblich den Tod bringe. Den ‚Schnitter‘ habe man ihn gerufen. Niemand wolle mit ihm zu tun haben. Jeder laufe fort, wenn Heinsohn sich näherte; er wurde mit Flüchen bedacht und mit Steinen beworfen. Wie schon gesagt: Er hat dann sein Haus kaum noch verlassen.“
Becca Shahin sah nachdenklich aus dem Fenster auf den parkartigen Garten, der das Herrenhaus Annettenhöh umgab. Lindberg bemerkte, dass ihre Augen wirklich pechschwarz waren wie die Nacht; sie erschienen geradezu bodenlos. Schwindel überkam ihn. Er riss sich von dem Anblick los.
„Ein Mann, der den Tod bringt, wenn er jemanden berührt oder vielleicht auch nur mit ihm redet“, sagte sie gerade, „der aber selbst nicht an dem Übel stirbt, das er verbreitet. Seine Zeitgenossen müssen damals ja befürchtet haben, dass Heinsohn in Afrika, diesem unheimlichen, rätselhaften, dunklen Kontinent mit seinen Hexern und Schamanen, von einem todbringenden Dämon erfasst worden war, der nun in ihm nistete.“
Lindberg nickte. „Ja. Das ist sehr wahrscheinlich. Diese harte Zeit war voller Aberglauben, Furcht vor Dämonen, Wiedergängern und Teufeln. Und wie bestattet man einen Mann, der einen Dämon in sich trägt, dessen Atem und Berührungen tödlich für andere Menschen sind?“, fragte er.
„Mein Gott, Sie haben recht! Nach dem, was Sie berichten, spricht vieles dafür, dass der Tote in dem Bleisarg tatsächlich Johannes Heinsohn ist!“, rief Shahin aus. „Aber warum hat man ihn nicht einfach verbrannt?“
„Genau diese Frage habe ich auch Dr. Winter gestellt“, entgegnete Lindberg. „Sie vermutet, dass man damals befürchtet hat, mit dem Feuer und dem aufsteigenden Rauch könne man das Miasma des Todes erst recht verbreiten. Wer weiß, vielleicht hat man ja an einen Höllendämon im Körper Heinsohns geglaubt, den das lodernde Feuer freisetzen würde. Aus diesem Grund hat man wohl auch das Zeichen des heilkundigen Dämons Buer in die Wände des Sarges geschnitten. Nur eben verkehrt herum – mit der Bedeutung, dieser Dämon heile nicht, sondern töte per Krankheit.“
„Es ist schon gespenstisch“, sinnierte Shahin. „Da haben sich die Menschen vor dreihundertfünfzig Jahren so viel Mühe gegeben, diesen todbringenden Dämon für alle Zeiten einzusperren – und nun ist er wieder da. Und wird vielleicht unzählige Menschen töten.“
„Sofern wir es nicht verhindern – ja“, versetzte Lindberg düster.