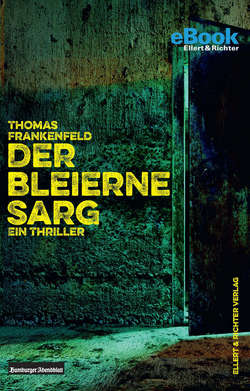Читать книгу Der bleierne Sarg - Thomas Frankenfeld - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеBrodersby
Diese verdammte Hitze. Der gleißende Glutball der Mittagssonne hing sengend über der steinigen Wüste, warf kurze Schatten hinter die ärmlichen Wellblechhütten mit ihren Viehgattern aus Dornengestrüpp und dörrte alles Leben aus. Die Zunge klebte ihm am Gaumen, zwischen seinen Zähnen knirschte der allgegenwärtige gelbe Staub. Er spürte – irgendetwas stimmte ganz und gar nicht. Er fühlte Panik in sich aufsteigen, warf sich nach vorn und wollte loslaufen. Er ahnte, dass es um Sekunden ging.
Aber er kam nur mühsam und schleppend voran, bewegte sich schwerfällig wie eine Fliege in zähem Sirup. Seine Füße schienen Tonnen zu wiegen.
Urplötzlich flammten riesige Augen direkt vor ihm auf. Sie brannten gnadenlos wie schwarze Sonnen in einem kleinen, konturenlosen Gesicht. Entsetzen ergriff ihn, er wollte schreien, doch es kam kein Ton aus seiner krächzend würgenden, ausgetrockneten Kehle. Dann ein blendend weißer Blitz. Ein Moment der Schwerelosigkeit. Und das Schreien begann.
Mit einem unartikulierten Laut fuhr Tristan Lindberg empor und zerrte hastig an der Bettdecke, die sich wie eine Würgeschlange um seine Beine gewunden hatte. Sein Herz raste, er keuchte und rang verzweifelt nach Luft. Er war schweißnass. Er setzte sich auf und zwang sich unter Aufbietung aller Willenskraft, ruhiger zu atmen, zählte beim Einatmen langsam bis sechs, hielt sechs Sekunden lang die Luft an und atmete sechs Sekunden lang wieder aus. Eine alte, bewährte Yoga-Technik. Mühsam widerstand er der in ihm aufwallenden Versuchung, einfach aufzuspringen und aus dem Haus zu rennen, immer weiter und weiter, bis ihn die Erschöpfung zu Boden werfen würde. Stattdessen streckte er einen Arm aus, eine Bewegung so langsam wie bei einem Faultier, und schaltete die Nachttischlampe ein. Lindberg rieb sich die Augen, sein Gesichtsfeld schien an den Rändern seltsam unscharf. Einatmen, Luft anhalten, Ausatmen …
Lindberg blickte zum Nachttisch. Darauf lag eine Packung Sertralin. Das Medikament wurde gegen schwere Depressionen und Angststörungen eingesetzt, hatte aber eine Reihe von Nebenwirkungen. Er streckte eine Hand danach aus. Dann ließ er den Arm wieder sinken. Nein, er musste es ohne Chemie schaffen.
Allmählich ebbte die Attacke ab. Lindberg erhob sich ächzend, ging in die Küche hinunter und leerte ein großes Glas Wasser in einem Zug. Und dann noch eins. Sein T-Shirt klebte an seinem schweißnassen Rücken. Er warf einen Blick zur grün blinkenden Anzeige der Herduhr hinüber und stöhnte. Fünf Uhr dreißig. Die Nacht war mal wieder gelaufen.
Lindberg stieg die Treppe wieder hinauf, ging ins Badezimmer hinüber und drehte die Dusche auf. Schlafen würde er jetzt ohnehin nicht mehr können. Er stöhnte wonnevoll, als das heiße Wasser seine Verspannungen in Schultern und Rücken lockerte. Doch am Ende drehte er das Wasser für ein paar Sekunden auf eiskalt – seine tägliche Übung zum Wachwerden.
Als sein Handy um halb acht klingelte, saß Lindberg im Auto auf dem Weg zum Herrenhaus Annettenhöh, der Hauptdienststelle seines Arbeitgebers, des Archäologischen Landesamtes in Schleswig. Das hellgelb gestrichene Gebäude, das ein Freiherr von Brockdorff im Jahr 1864 erbauen ließ, war seit 1985 im Besitz des Landes Schleswig-Holstein.
Lindberg griff zu seinem betagten Blackberry und blickte auf die Nummer.
„Nanu? Hanni? Was willst du denn schon so früh von mir?“, fragte er etwas zu schroff.
„Ich wünsche dir auch einen wunderschönen guten Morgen, Tristan“, sagte eine penetrant gut gelaunte Stimme. Sie schnurrte geradezu.
„Fein. Mein Morgen ist allerdings etwas beschädigt. Also, was gibt es nun?“, knurrte Lindberg.
„Du musst gleich mal nach Wedel runterfahren. Ausdrücklicher Wunsch vom Chef.“
Hannah Winkler war die berüchtigt effektive Vorzimmerdame von Dr. Rüdiger Stettner, dem Leiter des Archäologischen Landesamtes.
„Wedel?“, fragte Lindberg ungläubig. „Was soll ich da denn? Haben sie einen zweiten Roland gefunden?“
„Sehr lustig und nur knapp daneben. Roland stimmt nämlich schon mal“, lachte Hannah. „Unter der Kirche am Roland ist nämlich eine Gruft mit Särgen gefunden worden.“
„Na und? Darunter befinden sich doch überall uralte Grüfte“, brummte Lindberg. „Das wissen wir doch. Die haben seit über dreihundert Jahren da ihre Leute beerdigt, Pastoren vor allem. Ist doch nichts Besonderes. Da gehen wir doch gar nicht ran. Das weiß Stettner aber auch.“
„Kann schon sein, Tristan, aber guck es dir trotzdem mal an.“
„Okay. Weil du es bist“, brummte Lindberg. „Bin schon unterwegs.“
Wedel in Holstein
Gut neunzig Minuten später lenkte Lindberg seinen alten Saab auf den kleinen Parkplatz der Wedeler Kirche. Er stieg aus und ging den schmalen, von Büschen und Bäumen gesäumten Pfad zum Gotteshaus hinüber. Die mit rotweißem Trassierband abgesperrte Einbruchstelle an der Kirchenmauer war unübersehbar. Davor wartete eine schlanke Frau mit kurzem, grauen Haar. Lindberg vermutete, dass es sich um die Pfarrerin handelte, die er von unterwegs aus angerufen hatte. Statt Talar und Beffchen trug sie Jeans und eine Windjacke.
„Dr. Lindberg?“, fragte sie und musterte ihn einen Moment mit kühlen grauen Augen. Vor ihr stand ein jugendlich wirkender Enddreißiger mit breiten Schultern, müden braunen Augen und leicht zerzausten Haaren. Lindberg schüttelte ihre ausgestreckte Hand.
„Sabine Paulsen, angenehm“, sagte die Frau. „Ich bin die Pfarrerin der Kirche hier. Sie sind der Archäologe aus Schleswig?“
„Archäologe, ja. Und Anthropologe“, nickte Lindberg zerstreut.
Neugierig trat er näher an die Grube heran, die direkt an der Kirchenwand gähnte. Sie maß gut eineinhalb Meter im Durchmesser und war offensichtlich mehrere Meter tief.
„Ja, genau, darum geht es. Wir hatten einen Schaden am Dach, und die Dachdecker sind mit ihrem schweren Hubfahrzeug hier eingebrochen. Sieht aus wie eine Gruft da unten. Wenn Sie genau hinsehen, können Sie die Ecke eines Sarges erkennen“, sagte die Pfarrerin.
„Ja, ich kann es sehen“, bestätigte Lindberg. „Sie sind doch nicht etwa da runtergeklettert?“
Die Pfarrerin schüttelte lächelnd den Kopf. „In eine uralte Gruft? Allein? Ganz sicher nicht! Naja, obwohl – interessieren würde mich das schon; ist ja sozusagen meine Kirche hier. Aber ich wollte doch erstmal auf die Profis warten. Ach ja, einer der Dachdecker hat sich da unten schon mal umgesehen. Er wollte mal sehen, was für einen Schaden er mit seinem Fahrzeug angerichtet hat. Und er sagte, da unten stehe ein massiver Bleisarg. Er sei aber durch herabfallende Steine beschädigt worden. Oben an einer Ecke sei ein großes Loch. Außerdem sei jede Menge trübes Wasser rausgeflossen. Er hat sogar darin herumgetastet und sagte, da liege wohl tatsächlich noch eine Leiche drin.“
„Wie bitte? Der hat da reingefasst? Das darf doch wohl nicht wahr sein!“, entfuhr es Lindberg. Kein Archäologe schätzte es, wenn ein Laie vor den Experten an einem Fundort herumstöberte und ihn damit veränderte oder sogar so kontaminierte, dass sichere Analysen kaum mehr möglich waren. „Hat der Trottel vielleicht auch noch irgendetwas mitgenommen von da unten?“
Paulsen schüttelte den Kopf. „Nicht, dass ich wüsste, ich bin erst später hinzugekommen. Er sagte etwas sehr Merkwürdiges. Die Leiche da drin fühle sich ein bisschen glitschig an, aber vollkommen frisch – wie gestern gestorben. Er wirkte auch ziemlich mitgenommen. Damit hat er sicher nicht gerechnet.“
Lindberg schüttelte den Kopf. „In diesen Grüften da unten liegen nur uralte Leichen. Und nach dreihundertfünfzig Jahren sind die ganz bestimmt nicht mehr frisch. Aber vielleicht ist es ja eine Wachsleiche.“
Der Wissenschaftler bezog sich auf ein Phänomen, bei dem die Verwesung durch den Entzug von Sauerstoff abgebrochen wurde. Die Körperfette wurden dann zu einer wachsähnlichen Schutzschicht, den Adipociren, umgewandelt. Leichen konnten dann noch Jahrzehnte nach der Bestattung nahezu unversehrt wirken. Es waren meistens Wachsleichen, die hinter den Gruselgeschichten von Vampiren und Wiedergängern standen, die sich wankend aus den Gräbern erhoben.
Die Pastorin zeigte zur Ecke der Kirche. „Sie können sich ja mal selbst da unten umsehen. Eine Leiter liegt dahinten.“
Lindberg nickte, ging hinüber und holte sich die leichte Teleskopleiter aus Aluminium, die auseinandergeschoben etwa sechs Meter lang sein mochte.
„Wie schätzen Sie den Fund hier ein?“, wollte die Pfarrerin wissen.
Lindberg starrte hinab in die Schwärze und zuckte mit den Schultern. „Noch kann ich gar nichts sagen. Ich will Sie ja nicht enttäuschen, aber Sie wissen sicher auch, dass unter so alten Bauwerken häufig Grüfte aus verschiedenen Epochen liegen. Auch hier in Wedel, soweit ich weiß. Ist nichts Besonderes. In der Regel machen wir uns gar nicht die Mühe, die alle zu untersuchen. Es fehlt uns einfach das Geld dafür. Und das Personal sowieso.“
Er zog die Leiter auseinander und stellte sie in die Grube. Sie guckte nur noch einen guten Meter heraus.
„Aber Sie sagten, der Dachdecker hätte von einem Bleisarg gesprochen? Naja, das wäre auf jeden Fall schon mal interessant. Jedenfalls viel interessanter als einer aus halb verfaultem Holz. Bleisärge waren nämlich sehr teuer und sind als Funde entsprechend selten. Ich frage mich, für wen der angefertigt wurde.“
„Wer weiß“, sagte Paulsen nachdenklich und starrte in die Tiefe, „am Ende stehen wir vor dem Grab von Johann Rist. Das ist ja bisher nie gefunden worden.“
„Na, dann hätte sich meine Anreise aus Schleswig auf jeden Fall gelohnt“, lachte Lindberg, zog eine kleine Stirnlampe aus der Tasche und fing an, die Leiter hinunterzuklettern.
Das Grab von Johann Rist – das wäre in der Tat ein Fund! Rist war eine Legende in Nordwestdeutschland. Der studierte Geistliche war protestantischer Pfarrer der Wedeler Kirche von 1635 bis 1667 gewesen, hatte also die Spätphase des Dreißigjährigen Kriegs mit ihren Gräueln und Verheerungen am eigenen Leib erlebt und dabei mehrfach seine ganze Habe verloren. Rist hatte außer wortgewaltigen Predigten auch Gedichte, Lieder und politische Zeitzeugnisse geschrieben; als Universalgelehrter hatte er sich auch mit Mathematik, Botanik, Heilkunst und Musik befasst. Johann Rist galt heute als einer der wichtigsten geistlichen Vertreter des Frühbarocks und war damals für seine Verdienste sogar vom Kaiser zum Hofpfalzgrafen ernannt worden.
Lindberg schaltete die Stirnlampe ein, die er nun an einem elastischen Band um den Kopf trug, und stieg behutsam weiter hinab. Der grelle Halogenstrahl schnitt durch die Schwärze der Grube und huschte mit seinen Kopfbewegungen geisterhaft hin und her. Schließlich hatte der Archäologe den Boden aus grob gepflasterten Steinen erreicht und sah sich um. Die Gruft, in der er sich befand, hatte ein Ausmaß von rund drei mal vier Metern und war etwa zwei Meter hoch. Sie wies eine tonnenförmige Decke auf. Lindberg sah nun, dass die Decke und das darüberliegende Erdreich an einer Stelle durch Wasser unterspült worden waren. Er vermutete, dass ein von der Kirche führendes Regenrohr seit Langem gebrochen war.
Mitten in der Gruft stand ein massiver Sarg. Lindberg zog Gummihandschuhe aus der Tasche, streifte sie über und trat neugierig näher. Der Sarg war schlicht gearbeitet und schien in der Tat aus massivem Blei zu bestehen. Er klopfte dagegen. Die Dicke des Materials war ungewöhnlich, die meisten sogenannten Bleisärge wiesen nur eine dünne Hülle aus dem Metall auf. Der Archäologe beugte sich interessiert hinunter und strich mit den Fingern über das kühle Metall. Seltsam – der Deckel lag nicht einfach auf dem Sarg oder war mit ihm verschraubt, sondern sorgfältig mit einer dicken Naht auf den unteren Teil gelötet worden. Warum sollte sich jemand diese Mühe gemacht haben? Aus Angst vor einem Wiedergänger? Das war durchaus möglich – der Glaube an Tote, die sich aus dem Sarg erheben und die Lebenden heimsuchen konnten, war in früheren Zeiten stark gewesen.
Nachdenklich besah sich Lindberg den wuchtigen Kasten, der im Halogenlicht matt schimmerte. Er schätzte, dass diese Gruft aus dem 17. oder 18. Jahrhundert stammte. Wie die Pfarrerin gesagt hatte, wies der Sarg an einer Ecke eine Beschädigung auf. Ein großes Loch gähnte dort, und auf dem Boden lagen schwere Asphaltplacken, einige Stücke Blei, ein paar Erdklumpen sowie mehrere alte Pflastersteine. Lindberg rekonstruierte im Kopf: Das Wasser aus dem geborstenen Regenrohr hatte nach und nach den Untergrund unterspült, der schließlich nachgegeben hatte. Die schweren Pflastersteine waren auf die Ecke des Sarges gefallen und hatten das mürbe gewordene Blei zertrümmert. Lindberg schob sich dichter an das Loch heran, aus dem noch immer eine gelbliche Flüssigkeit tropfte, und wollte gerade hineinleuchten, als der Strahl der Lampe auf drei Symbole fiel, die, wie er rasch feststellte, offenbar auf alle Seiten des sonst ungeschmückten Sarges aufgebracht worden waren. Der Archäologe kniete sich vor den Sarg und sah genauer hin. Die in das Blei eingeschnittenen Zeichen waren bereits etwas verwittert und nicht mehr leicht erkennbar. Lindberg fuhr die Linien der Symbole mit dem Finger nach. Beim dritten Zeichen erstarrte er. Der Archäologe erhob sich hastig und wich unwillkürlich einen Schritt zurück. Zitternd verharrte das grelle Licht seiner Stirnlampe auf dem schwach erkennbaren Symbol. Es zeigte die spiegelverkehrte Zahl Vier. Ihm lief ein Schauer über den Rücken.