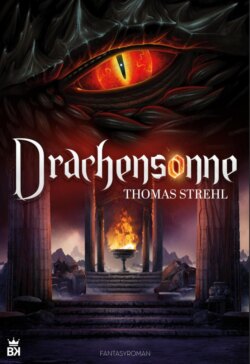Читать книгу Drachensonne - Thomas Strehl - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDie Helden kehrten zurück.
Nach dreihundert langen Tagen und Nächten sahen sie endlich ihre Heimat wieder.
Und man bereitete ihnen einen triumphalen Empfang.
Überall standen Menschen in ihrer besten Kleidung am Straßenrand und jubelten ihnen zu.
Frauen und Mädchen trugen Blumen im Haar und liefen winkend neben ihren Pferden her.
Jonaas, der in der Mitte ritt, sah nach links und lächelte seinen Freund Kalil an. Und auch Tyk, der ganz rechts ritt, sah hinüber.
Beide wussten, das Kalil in diesen Sekunden nur Augen für ein einziges Mädchen hatte, und Duniah, die ihren Freund bereits entdeckt hatte, lief ihnen entgegen.
»Kalil!«, rief sie aufgeregt, raffte ihr langes Kleid und beschleunigte ihre Schritte weiter. »Kalil.«
Die Augen des jungen Mannes funkelten, und er trieb den kleinen Schecken, auf dem er saß, an.
»Duniah.«
Tyk und Jonaas hatten Mühe, ihrem Freund zu folgen.
Und plötzlich mischte sich eine andere Stimme in den Jubel, lauter und deutlicher als alle anderen.
Eindringlicher, näher ...
»Jonaas!« Dann noch einmal: »Jonaas!«
Das Dorf und seine feiernden Bewohner verblassten mehr und mehr.
»Hallo!«
Ein leichter Schlag gegen seine Schulter weckte den Schlafenden ganz.
»Ich dachte schon, ich bekomme dich gar nicht mehr wach«, sagte eine brummende Stimme und rüttelte noch einmal an der Gestalt auf dem Bett.
Jonaas rieb sich die Augen und hatte große Mühe, das Chaos in seinem Kopf zu ordnen.
Das sonnendurchflutete Dorf, die jubelnde Menge waren nun ganz verschwunden und machten Platz für eine durch Kerzenschein spärlich erleuchtete Höhle.
Nur das Gesicht seines Freundes Kalil begleitete ihn in die Realität.
»Ich habe geträumt«, murmelte Jonaas. Ein Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus. »Von morgen.«
Kalil grinste. »Ich träume schon seit Wochen«, sagte er. »Ich bin so froh, wenn alles vorbei ist und der Berg uns wieder freigibt.«
Jonaas stupste seinen Freund an. »Duniah war auch da«, sagte er.
Kalil lächelte verschmitzt. »Natürlich wird sie da sein. Sie hat es versprochen.«
Sein Freund zuckte die Achseln. »Pah«, machte er. »Frauen versprechen viel. Was macht dich so sicher, das sie sich in den endlosen Tagen nicht jemand anderen gesucht hat?«
»Es gibt keinen Besseren als mich, und das weiß sie«, sagte Kalil und versuchte, ernst zu bleiben.
»Ich bin besser als du«, sagte Jonaas, um seinen Freund zu ärgern. »Schneller, geschickter, stärker ...«
»Mag sein«, gab ihm Kalil recht. »Aber du bist auch hässlicher.«
Es sollte ein Spaß sein, ein harmloses Wortgefecht, doch als Jonaas ernst wurde und zu Boden sah, wusste Kalil, dass er zu weit gegangen war.
Denn er hatte seinen Freund daran erinnert, dass er anders war als alle anderen Dorfbewohner.
Während alle Menschen in ihrer Heimat klein, dunkelhäutig und schwarzhaarig waren, war Jonaas hellhäutig, beinahe bleich, und sein Haar war so blond, dass man es fast als weiß bezeichnen konnte.
Seine Mutter kam aus dem Dorf, doch sein Vater war ein Reisender gewesen, aus dem Norden, wie man sagte. Bewohner hatten ihn krank und geschwächt im Wald gefunden, ins Dorf gebracht, und Jonaas‘ Mutter hatte ihn gesund gepflegt und sich in diesen Wochen in ihn verliebt.
Doch als er wieder gesund war, hatte er seine Reise fortgesetzt, und alles, was er im Dorf zurückließ, war Jonaas im Bauch seiner Mutter.
Ab diesem Zeitpunkt hatte sie einen schweren Stand im Dorf, und Jonaas wurde anfänglich gehänselt, bis nach und nach alle erkannten, was für ein liebenswertes Kind der Kleine war, und ganz langsam hatte sich die Sache normalisiert.
Mittlerweile war seine Mutter wieder eine geachtete Frau im Dorf, hoch geschätzt wegen ihrer Fähigkeiten als Heilerin. Und auch Jonaas hatte sich seinen Platz in der Gesellschaft erkämpft, und niemand achtete mehr auf den kleinen, großen Unterschied.
Und jetzt machte er mit Tyk und Kalil sogar die heilige Prüfung.
Kalil streckte Jonaas eine Hand hin, zog ihn aus dem Bett und beendete die Grübeleien seines Freundes.
»Tyk wartet auf Ablösung«, sagte er. »Deine Wache beginnt.« Er zwinkerte dem Blonden zu. »Deine letzte Wache.«
Jonaas nickte. »Jawohl«, murmelte er. »Bald ist es vollbracht.«
Er ging auf die einzigen Möbel der Höhle zu, die außer dem Bett dort standen, und nahm seine Kleidungsstücke an sich, die er über den grob gearbeiteten Stuhl geworfen hatte.
Auf dem Tisch, der daneben stand, wartete kühles Wasser in einem Tongefäß, und Jonaas nahm einen kräftigen Schluck.
Er wischte sich mit dem Unterarm den Mund ab, stellte das Gefäß zurück und zog sich sein Hemd über den Kopf.
»Willst du nicht schlafen gehen?«, fragte er Kalil. »Schließlich habe ich Wache und nicht du.«
Sein Freund schüttelte energisch den Kopf. »Tyk wird auch nicht schlafen gehen«, sagte er. »Die letzten Stunden werden wir zusammen verbringen.«
»Dann geh schon einmal vor«, sagte Jonaas. »Ich komme nach, sobald ich hier fertig bin.«
Kalil entfernte sich, und Jonaas stieg in seine Hose. Dann schlüpfte er in Stiefel aus Hirschfell und schnallte sich den Gürtel um die Taille. Schließlich steckte er das Jagdmesser ein und blies die Kerze aus.
Dunkelheit umfing ihn, und er blieb so lange stehen, bis sich seine Augen an die veränderten Lichtverhältnisse gewöhnt hatten.
Langsam drehte er sich noch einmal um und schaute sich den Platz an, an dem er die meiste Zeit der endlosen Tage verbracht hatte.
Von diesen Höhlen gab es einige, schließlich änderte sich die Zahl derer, welche die Prüfung ablegten, von Mal zu Mal.
Er lächelte.
Wenn er die Höhle morgen verließ, dann würde er ein Mann sein, ein Jäger, ein Krieger, ein vollwertiges Mitglied der Dorfgemeinschaft.
Kein Kind mehr, sondern jemand, dessen Stimme zählte, dessen Meinung gehört wurde.
Wieder grinste er.
Ein Jäger und Krieger, dachte er. So hatte es der Priester genannt, und doch wusste Jonaas, dass er Jäger und Familienvater sein würde (wenn ihn eine Frau trotz seines seltsamen Äußeren lieben konnte), aber niemals ein Krieger.
Die Zeiten der Kriege lagen Hunderte von Jahren zurück, und selbst die Ältesten kannten nur Legenden und Geschichten über diese wilde Zeit.
Und doch war eine dieser Geschichten lebendiger als alle anderen, war auf seltsame Art und Weise mit ihrem Dorf verknüpft, und Jonaas rief sich die Worte der Alten ins Gedächtnis, während er seine Schlafhöhle verließ und den Weg zur Halle des Lichts antrat.
Sein Volk nannte sich Sangapao, was soviel bedeutete wie »Bewahrer der Flamme«, und alle in ihrem Dorf waren sich über die Bedeutung der Worte im Klaren.
Die Legende, die selbst die Kleinsten mit der Muttermilch eingeflößt bekamen, erzählte vom letzten großen Krieg.
Es hieß, dass Paradur, der mächtigste und gefährlichste Magier des schwarzen Bundes, und seine grausamen Verbündeten die Welt beinahe unterjocht hatten.
Viele Städte, viele Völker waren bezwungen und unterworfen, und nur wenige Orte boten noch Widerstand.
Doch auch sie konnten dem eisigen Sturm, wie Paradurs Armee genannt wurde, nicht mehr lange standhalten, und der Kampf wäre aussichtslos gewesen, wenn nicht ein Wunder geschehen wäre.
Plötzlich erschien Galaan, der letzte der Waraan, eines geheimnisvollen Kriegerordens, und er brachte ein Geschöpf mit, wie man es in Karma´neah seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen hatte und nie wieder sehen würde.
Galaan nannte die riesige fliegende Echse einen Drachen, und niemand wusste damals, woher das mächtige Geschöpf kam.
Aber gelenkt und geritten vom mächtigen Krieger, rissen die Flammen des Drachen Schneisen in die Belagerungen der eisigen Horde, und den Völkern Karma´neahs brachten sie Hoffnung und neuen Mut.
Gemeinsam schaffte man es, das Heer des schwarzen Magiers zurückzudrängen, bis hinauf in die unwirtlichen Gegenden der Sturmfelsen.
Und dort, am Berge Maligan, kam es zur letzten, entscheidenden Schlacht.
Galaan und der Drache schafften es schließlich, Paradur in eine Höhle zu treiben, und das große Tier schmolz mit seinem Feuer den Fels und schloss den schwarzen Magier und mit ihm das Böse im Berg ein.
Die eisige Horde, nun führerlos und nicht mehr unterstützt von schwarzer Magie, flüchtete, und die, die nicht aufgerieben wurden, verschwanden im Höhlenlabyrinth der Sturmfelsen und wurden nie wieder gesehen.
Dann verschwand der Drache so schnell, wie er erschienen war, und zurück blieb einzig Galaan.
Doch er hielt ein Geschenk in seinen Händen, eine Fackel, entzündet vom Feuer des Drachen, und die Legende berichtet, dass, solange sich das Feuer in den Händen der Gerechten befindet, Karma´neah und seinen Völkern kein Leid mehr geschehen könne.
Denn die Wärme der Flammen wird von der eisigen Horde gefürchtet und hält sie für immer gebannt, und das Gefängnis Paradurs lässt sich nur mit diesem Drachenfeuer öffnen.
Galaan, wissend, wie großartig das Geschenk des Drachen war, suchte einen sicheren Ort für die Flammen und fand ihn im Talangebirge.
Und das tapfere Volk der Talan, die ihn freundlich aufnahmen, wurden zu Sangapao und schworen, die Flamme zu bewahren und damit den Frieden von ganz Karma´neah.
Galaan war nun schon seit Hunderten von Jahren verschwunden, doch die Legende des Drachenfeuers lebte fort, und das Bewahren der Flamme war bis heute ein fester Bestandteil im Leben des kleinen Bergvolkes.
Krieger, die anfangs die Flamme bewacht hatten, gab es nicht mehr, und nach und nach bekam das Bewachen der Flamme symbolischen Charakter.
Es wurde ein Ritual daraus, in dem die Jungen des Dorfes bewiesen, dass sie Verantwortung für die Gemeinschaft übernehmen konnten, und wenn sie die Prüfung der dreihundert Tage abgelegt hatten, wurden sie bei einem großen Fest in den Stand der Männer aufgenommen.
All dies schoss Jonaas durch den Kopf, als er den Weg durch das Höhlenlabyrinth in die Halle des Lichts antrat.
Nur selten erhellte eine Fackel seinen Weg, doch er hätte selbst in völliger Dunkelheit den Weg gefunden, denn schließlich hatte er dreihundert Tage Zeit gehabt, sich zu orientieren.
Der Weg führte ihn vorbei an anderen Schlafhöhlen, vorbei an Vorratskammern, die Dörrobst, Dörrfleisch und Dörr-was-weiß-ich enthielten, und Jonaas' Magen knurrte. Neben dem Himmelslicht vermisste der Junge am meisten seine Mutter und ihre gute Küche.
Er freute sich auf das morgige Fest, das man ihnen zu Ehren ausrichten würde, und auf die Berge frischen Essens, die man ihnen dann auftischte.
Jonaas beschleunigte seine Schritte, als der Weg durch die Felsen breiter wurde.
Fackeln gab es hier nicht mehr, und doch wurde der Weg immer heller, waren die Steine um Jonaas herum immer deutlicher zu sehen, eingetaucht in grünes Licht, das aus dem Berg selbst zu kommen schien.
Der Junge wusste, dass er nur noch eine Weggabelung vor sich hatte, einmal musste er sich noch nach links wenden, dann würden die Felsen den Blick auf die Halle des Lichts freigeben.
Jonaas hielt kurz an und atmete einmal tief durch.
Wie immer, wenn er die große Halle betrat, verharrte er einen Moment, um sich auf das vorzubereiten, was er gleich sah.
Und wie immer würde es ihm nicht gelingen.
Nichts konnte einen auf dieses Naturschauspiel vorbereiten, und niemand, der es nicht selbst gespürt hatte, konnte nachempfinden, was beim Anblick des Drachenfeuers in einem vorging.
Noch einmal ein tiefer Atemzug mit geschlossenen Augen.
Dann tat Jonaas ein paar Schritte vorwärts und betrat die heilige Halle.
Die Höhle war nicht natürlichen Ursprungs. Sie maß ungefähr zweihundert Pferdelängen im Durchmesser und war genau kreisrund. Die Wände, die so hoch empor ragten, dass sie sich in der Dunkelheit verloren, waren so glatt geschliffen wie Glas.
Sie reflektierten die Flamme, die genau im Zentrum des Raumes brannte, immer und immer wieder und sorgten so dafür, dass man das Gefühl hatte, mitten im Feuer zu stehen.
Jonaas blinzelte. Nach der Dunkelheit der anderen Höhlen war diese Lichtkaskade eine so große Reizüberflutung für seine Augen, dass er einige Minuten brauchte, um sich daran zu gewöhnen.
Schließlich gelang es ihm, die Reflexionen auszublenden und sich nur auf das eigentliche Drachenfeuer zu konzentrieren.
Der Ursprung des Lichtes war eine gut drei Pferdelängen hohe Flammensäule, die einige Ellen über dem Boden aus dem Nichts heraus entstand.
Sie brannte ruhig, flackerte nur unmerklich und erleuchtete die Höhle in allen Farben des Regenbogens.
Das Feuer hing einfach mitten im Raum, ohne Ursprung, ohne Versorgung.
Niemand musste Holz nachlegen, Reisig, Stroh oder etwas anderes, um die Flamme am Leben zu erhalten.
Es war, als hole sich das Feuer seine Energie aus der Luft, doch auch das war schwer vorstellbar, denn die Luft in der Höhle hatte sich nicht aufgeheizt, sondern war kühl und klar, als stünde man mitten in einem Wald.
Kein Rauch quälte die Augen, keine Hitze die Haut.
Manchmal glaubte Jonaas, das Feuer selbst wäre kalt, denn auch wenn man näher herantrat, spürte man keinen Temperaturunterschied.
Oft überlegte er, was wohl passieren würde, wenn die Flammen mit seinem Körper in Berührung kamen, doch der Kontakt zum Feuer war unter Strafe verboten.
Der Blonde wandte sich nach links und ging an der Wand entlang in den hinteren Teil der Höhle. Dort, auf einer kleinen Bodenerhöhung, hatten die Wächter der Flamme ihr Lager errichtet.
Einige Decken lagen dort, und es gab Gefäße, in denen sich Lebensmittel und Wasser befanden.
Kalil hatte sich einen der Krüge genommen, nahm einen Schluck und winkte seinen Freund zu sich.
»Wird Zeit, dass du kommst«, sagte er gut gelaunt. »Schließlich gebührt dir die Ehre der letzten Wache.«
Tyk, der etwas abseits saß, starrte aufs Feuer und nickte Jonaas nur kurz zu, doch als der Ankömmling es sich auf seiner Decke bequem gemacht hatte, drehte er sich um.
»Spürt ihr eigentlich die Kraft, die Macht, die von dem Feuer ausgeht?«, fragte er.
Kalil runzelte die Stirn. Tyk war der Ruhigste von ihnen, und meistens musste man ihm jedes Wort aus der Nase ziehen, wenn man sich mit ihm unterhalten wollte. Dass er von sich aus ein Gespräch suchte, war denkbar ungewohnt.
Der kräftige Junge mit den strubbligen schwarzen Haaren sah seine Mitwachen an. »Oder bilde ich mir alles nur ein, weil ich die Geschichten und Legenden kenne?«
Jonaas zuckte die Schultern. Eigentlich sprach Tyk nur das aus, was er selbst schon oft beim Anblick des Feuers gedacht hatte. Und auch von Kalil hatte er aus verschiedenen Andeutungen gehört, dass er sich über die Wahrheit der Geschichten nicht im Klaren war.
Sicher, die Flammen mitten in der Höhle waren ungewöhnlich und seltsam, aber hieß das automatisch, dass ihre Entstehungsgeschichte den Tatsachen entsprach?
Er hatte oft in den dreihundert Tagen darüber nachgedacht, doch jetzt, als Tyk es offen aussprach, erschrak er innerlich.
»Ich spüre etwas«, sagte Jonaas diplomatisch. »Immer wenn ich die Höhle betrete, geht etwas in mir vor, aber ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ob es eine Kraft ist, die von der Flamme ausgeht, oder ob es aus meinem Inneren kommt, als Reaktion auf die Geschichten und Legenden.«
Kalil lächelte breit. »Also ehrlich«, sagte er. »Man kann doch gar nicht anders, als vor Ehrfurcht zu erstarren, wenn man all dies sieht. Schließlich bewahrt das Drachenfeuer den Frieden Karma´neahs und seine Wärme auch unser aller Leben.«
Er wollte mit seiner lockeren Art die Bedenken der Freunde und seine eigene Unsicherheit zerstreuen, doch bei Tyk biss er auf Granit.
»Das ist es doch«, sagte der Junge. »Das Feuer bannt mit seiner Wärme die eisigen Truppen in den Sturmfelsen.« Er deutete aufs Feuer. »Welche Wärme?«, fragte er höhnisch.
Jonaas und Kalil blickten automatisch in die Flammen, und sie wussten, das Tyk recht hatte.
Das Feuer war nicht heiß, nicht einmal lauwarm, also wie konnte es ihrer ganzen Welt Wärme schenken, wenn es nicht einmal in der Lage war, diese Höhle zu beheizen?
»Vielleicht ist alles nur ein Symbol«, begann Kalil, doch Tyk fiel ihm ins Wort. »Oder vielleicht ist auch alles nur Quatsch, reine Zeitverschwendung, völliger Unsinn.« Er wurde immer lauter, und Jonaas blickte sich unbehaglich um. Irgendwie hatte er Angst, dass das Feuer ihnen Tyks Anfall übelnahm.
»Langsam, langsam, Tyk«, sagte Kalil. »Hier, trink erst mal ‘nen Schluck, und dann beruhige dich.«
Der Angesprochene zögerte kurz, dann nahm er den dargebotenen Krug und setzte ihn an die Lippen.
»Ich weiß gar nicht, warum du dich jetzt noch so aufregst. Schließlich kann uns ab morgen dieses Feuerchen gestohlen bleiben«, beschwichtigte Kalil. »Morgen ist all dies hier vorbei.«
Tyk setzte den Krug so hart ab, dass er in zwei Teile zersprang. Wasser lief über die Felsen und benässte die Decke, auf der er saß.
»Aber das ist es ja gerade«, sagte er frustriert. »Morgen kehren wir ins Dorf zurück und feiern ein riesiges Fest. Aber übermorgen muss jeder seinen Platz in der Gemeinschaft einnehmen.« Er sah Jonaas an. »Du wirst die Heilkünste deiner Mutter erlernen.« Dann blickte er zu Kalil. »Und du wirst mit deinem Vater eure Felder bestellen und deine Hütte mit Duniah teilen. Und ich...«
Er sprang auf und trat die Scherben des Kruges durch die Höhle. »Ich hab einfach keine Lust, den Rest meines Lebens an einem Schmiedefeuer zu verbringen.«
Kalil und Jonaas sahen sich an, dann stand der Blonde auf und legte Tyk die Hand auf die Schulter. Natürlich wussten sie, dass ihr Freund das Schmiedekunstwerk seines Vaters nicht mit Begeisterung betrachtete, doch dass der Stachel so tief saß, hatten sie nicht geahnt.
»Wenn dich das so belastet, dann sprich mit deinem Vater und erkläre ihm, dass du etwas anderes machen möchtest.«
»Pah.« Tyk schüttelte die Hand seines Freundes ab. »Als ob das so einfach wäre. Meinst du, ich hätte etwas Derartiges nicht schon versucht?«
»Und?«
»Völlig zwecklos.« Er nahm ein Stück Dörrobst aus einem der Behälter und kaute darauf herum. Sein Blick ging ins Leere. »Mein Vater beruft sich auf die Traditionen«, sagte er leise. »Und die stehen in unserem Dorf doch beinahe über allem. Der Sohn eines Bauern wird Bauer, der eines Jägers Jäger, und jemand, der aus einer Hirtenfamilie kommt, wird Hirte, also bleibt für mich nur ...« Er brach ab.
»Aber was ist so schlimm daran?« Kalil wickelte sich in eine Decke. »Die Traditionen sorgen für Ordnung im Dorf. Jede Familie übernimmt eine Aufgabe, füllt sie gut aus und sorgt damit für das Gemeinwohl.«
»Pah, Gemeinwohl«, brach es aus Tyk hervor. »Und wo bleibt der Einzelne? Was ist mit mir? Bin ich dazu verurteilt, ein unglückliches Leben zu leben, nur damit es anderen gut geht?«
Er blickte aufs Feuer, und seine Augen blinzelten herausfordernd.
»Manchmal glaube ich, der Goon hatte recht«, sagte er trotzig und ließ sich zu Boden sinken.
Kalil und Jonaas zogen hörbar die Luft ein.
Der Goon. Es war verboten, über ihn zu sprechen, verboten, auch nur an ihn zu denken, der Goon war aus ihrer aller Leben verschwunden.
Und doch dachte Jonaas gerade deswegen oft an ihn, und er wusste, dass es vielen anderen genauso erging.
Eigentlich hieß der Goon Mykiel und war ein Junge wie jeder andere. Und obwohl er drei Jahre älter als Jonaas und seine Freunde war, hatten sie als Kinder viel Zeit miteinander verbracht.
Dann, im jugendlichen Alter, hatte Mykiel angefangen, sich zu verändern. Erst wurde er ruhig und verschlossen, beinahe grüblerisch, dann brach es immer öfter aus ihm heraus.
Sein Kopf war voller Ideen und Visionen, und er mischte sich oft in die Gespräche der Männer ein und wollte Dinge grundlegend ändern.
Erst ignorierte man ihn, dann, als Mykiel immer aufdringlicher und ungeduldiger wurde, wurden die Männer böse, und manchmal hagelte es Schläge für das aufmüpfige Kind.
Doch Mykiel wurde nicht ruhiger. Zu viele Ideen durchflogen seinen Kopf, schossen hin und her wie Schwalben an einem Sommertag.
Seine Mutter und sein Vater versuchten, ihn zu bremsen, vertrösteten ihn auf den Tag, wenn er ein Mann wurde, um endlich gehört zu werden, doch Mykiel wollte keine weiteren dreihundert Tage warten. Stattdessen beschloss er, dass das Bewahren der Flamme reiner Unsinn war, erklärte sich selbst zum Mann und verkündete, nicht an der Prüfung teilzunehmen.
Doch damit brachte er die Ältesten des Dorfes gegen sich auf.
Für kleinere Vergehen untereinander gab es drei Richter, aber ein Nichtteilnehmen an der Prüfung, ein Verschmähen der heiligen Aufgabe, das war ein Verbrechen an der Gemeinschaft. Und dafür kannte das Dorf nur eine Strafe.
Mykiel wurde ein Goon. Er verlor seinen Namen, seine Rechte, seine Habe und seinen Platz im Dorf.
Jemand, der die Flamme nicht bewahren wollte, war kein Sangapao und hatte sein Leben verwirkt.
Nur mit einer Hose bekleidet, ohne Waffen und Nahrung, brachten ihn Reiter unter lautem Wehklagen seiner Familie aus dem Dorf und schleppten ihn an einen weit entfernten Platz.
Mit der Drohung, dass man ihn sofort töten würde, wenn er ins Dorf zurückkehrte.
Von nun an war er ein Ausgestoßener, ein Goon, ohne Stamm, Familie und Zuhause.
Jonaas dachte an den Tag zurück, als die Reiter den zappelnden fluchenden Burschen aus dem Dorf gebracht hatten.
Es schauderte ihn. Nie würde er diesen Moment vergessen, den Moment, der ihm klar gemacht hatte, dass die Gemeinschaft alles und man ohne ihren Schutz nackt und verloren war.
Es war das einzige Mal seit über hundert Jahren, dass die härteste aller Strafen verhängt wurde, und da auch die Jäger, welche die umliegenden Wälder durchstreiften, den Goon nie wiedersahen, war jedem klar, das Mykiel umgekommen war.
Und nun meinte Tyk, dieser Mykiel hätte richtig gehandelt?
»Das meinst du nicht ernst«, sagte Jonaas. »Du weißt so gut wie ich, dass der Goon ein kleines bisschen verrückt war.«
»Ach ja?« Tyk streckte herausfordernd den Kopf vor. »Ich fand nicht alles dumm, was er sagte.«
Kalil starrte auf seine Füße. Man merkte deutlich, dass ihm die Diskussion unangenehm war.
Von allen dreien war er derjenige, der am stärksten an den Traditionen der Sangapao festhielt.
»Vielleicht hatte er wirklich die eine oder andere gute Idee«, versuchte er trotzdem zu beschwichtigen. »Aber sein Verhalten war dumm. Niemand kann ohne die Gemeinschaft überleben, und diesen Schutz darf man nicht leichtfertig aufs Spiel setzten.« Er sah Tyk fest an. »Ganz egal, was man manchmal denkt oder fühlt.«
Die Freunde schwiegen. Tyk sammelte kleine Steine vom Boden auf und warf sie gegen die Wand. Das Klicken, das entstand, war lange Zeit das einzige Geräusch.
»Du hast es richtig gemacht, Tyk«, sagte Jonaas in die Stille. »Du hast als Jugendlicher nicht gegen deinen Vater aufbegehrt, sondern mit uns zusammen die Prüfung abgelegt. Wenn du die Höhle verlässt, bist du ein Mann, und dein Vater und die Ältesten müssen dir zuhören und deine Meinung akzeptieren.« Er versuchte ein aufmunterndes Lächeln. »Vielleicht schaffst du es ja doch noch, da raus zu kommen.«
Tyk hielt in der Bewegung inne. Er ließ die Steine aus seiner Hand auf den Boden rieseln und nickte Jonaas zu.
»Hoffen wir es«, brummte er.
Wieder entstand eine kurze Zeit der Stille, und obwohl Tyk diesmal keine Steinchen warf, drang ein Scharren und Klappern an ihre Ohren.
Nie zuvor in den dreihundert Tagen hatten sie solche Geräusche vernommen.
»Habt ihr das auch gehört?«, flüsterte Kalil und sprang auf.
Das Geräusch war für einige Sekunden verschwunden, und die Freunde lauschten angestrengt. Schon glaubten sie, ihre Sinne hätten ihnen einen Streich gespielt, als das Scharren erneut an ihre Ohren drang, diesmal lauter und näher.
»Die kommen uns schon heute holen«, sagte Kalil und fuhr sich durchs Haar. »Jungs, wir haben uns verzählt. Die Strichliste stimmt nicht, einer von uns hat Mist gebaut, und heute ist nicht Tag zweihundertneunundneunzig, sondern schon dreihundert.« Er warf sich die Decke von der Schulter und wollte dem Geräusch entgegen gehen, doch erstens konnte man nicht genau lokalisieren, woher das Scharren kam, und zweitens wurde er von Tyk aufgehalten.
»Warte«, flüsterte er. »Ich bin sicher, dass wir uns nicht vertan haben. Wir werden erst morgen geholt. Glaub mir.«
Doch Kalil ließ sich nicht beirren. »Und wer oder was soll dann hierher kommen?«, fragte er.
Seine Mitwachen antworteten nicht. Sie wussten genauso gut wie Kalil, dass ein Felsen vor den Höhleneingang gerollt wurde, sobald neue Wachen den Berg betreten hatten. Ein Felsen, der nur von zehn Mann bewegt werden konnte.
Und sonst gab es in diesem Höhlenlabyrinth nichts. Kein Tier trieb hier sein Unwesen. Kein Bär, kein Olano, nicht einmal eine Maus wohnte in der Nähe der Flamme. Es war nicht nur so, dass Jonaas und die anderen in den Tagen zuvor kein Lebewesen gesehen hatten, nein, sie wussten auch von den anderen Wachen aus den Jahren zuvor, dass die Hüter der Flamme ihren Dienst ganz allein versehen mussten. Hier unten gab es wirklich nichts. Die einzigen lebenden Organismen in dieser Höhle waren sie.
Das jedenfalls hatten sie bis vor einem Augenblick gedacht.
Und nun dies.
Unzweifelhaft ging oder schlurfte jemand über den Felsboden, und der Unbekannte machte sich nicht einmal die Mühe, besonders leise dabei zu sein.
Jonaas und Tyk hatten sich ebenfalls erhoben, und Rücken an Rücken warteten die Freunde ab.
Das Geräusch verstummte ab und zu für wenige Momente, so, als orientiere man sich, dann war es wieder für kurze Zeit zu hören, jedes Mal näher als zuvor.
Jonaas spitzte die Ohren, doch es war unmöglich, die Richtung zu bestimmen, aus der das Scharren kam.
Das Geräusch war nicht besonders laut, trotzdem hallte es von den Wänden wider.
»Was zum Henker ist das?«, sprach Kalil die Gedanken aller aus.
Jonaas antwortete nicht, und am unsicheren Blick Tyks konnte er erkennen, dass auch der schweigsame Junge keine Erklärung für das Scharren hatte.
»Vielleicht will uns jemand einen Streich spielen?«, flüsterte er. »Oder das gehört mit zur Prüfung, und man will uns testen, ob wir die Flamme im Ernstfall wirklich verteidigen.« Seine Stimme zitterte leicht, und Jonaas bemerkte verwirrt, dass Tyk sein Jagdmesser aus dem Gürtel zog.
»Hallo!« Kalils Stimme klang in der Stille ohrenbetäubend laut. Wie von selbst hatten sie sich in den Tagen der Höhle angewöhnt, leise zu sprechen. Da keine Nebengeräusche ihre Stimmen störten, hatte meist ein Flüstern gereicht.
Nun jedoch rief Kalil laut, und die Echos tobten durch den Raum. »Wenn das ein Scherz sein soll, dann könnt ihr jetzt damit aufhören. Wir haben genug gelacht.«
Jonaas verfluchte Kalil innerlich für seinen Ausbruch. Nicht, weil ihm die Echos in den Ohren weh taten, sondern weil es ihm dadurch unmöglich war, das Scharren zu orten.
Als Kalils zehnfach wiederholte Stimme endlich verstummte, standen sie reglos da und lauschten.
Sie legten den Kopf schief, verharrten angestrengt horchend, doch nichts geschah. Das Scharren war nicht mehr da.
»Es ist weg«, sagte Tyk und atmete auf. »Herzlichen Glückwunsch, du Held. Egal, was es war, du hast es in die Flucht gebrüllt.«
Er steckte sein Messer in den Gürtel zurück, ging einige Schritte von den anderen weg und bückte sich nach einem Krug.
Plötzlich flog ein Schatten heran und landete mit einem Satz hinter dem Jungen.
Jonaas und Kalil erstarrten. Ihre Augen sahen, doch ihr Verstand weigerte sich zu verstehen.
Ein riesiger schwarzer Panther, so groß wie ein Pferd, erschien aus dem Nichts und hob eine Pranke, bewehrt mit messerscharfen Krallen, zu Tyks Rücken.
Jonaas wollte schreien, Tyk warnen, ihm helfen, doch er war zur Bewegungslosigkeit verdammt und musste tatenlos mit ansehen, wie die Bestie ihr Maul öffnete und ein Brüllen ausstieß, das die Höhlenwände erzittern ließ.
Erst jetzt bemerkte Tyk die Gefahr, in der er sich befand, und wirbelte auf dem Absatz herum.
Seine Hand suchte sein Messer, doch es war bereits zu spät. Die Pranke des Tieres schoss auf ihn herab und riss ihm den Brustkorb auf.
Jonaas war immer noch vor Schreck gelähmt, und auch Kalil war unfähig, sich zu rühren.
Wie in Trance sahen sie, wie Tyk einen ungläubigen Blick auf das Loch in seinem Körper warf, um direkt danach den zweiten Hieb der Raubkatze zu empfangen.
Diesmal traf die Pranke seinen Kopf, und Tyks Körper wirbelte durch die Wucht des Schlages herum und wurde gegen die Höhlenwand geschleudert. Als er am kalten Felsen herunter rutschte und wie eine nutzlose Puppe auf dem Steinboden aufschlug, war bereits kein Leben mehr in ihm.
Muss er doch kein Schmied werden, huschte ein seltsamer, unpassender Gedanke durch Jonaas Kopf.
Kalils Schrei riss ihn zurück in die Wirklichkeit.
»Tyk. Verdammt, Tyk!«
Kalil hatte seine Schockstarre überwunden, und ungeachtet der Gefahr, die von der Bestie ausging, lief er auf den geschundenen leblosen Körper zu.
Er bückte sich und strich Tyk übers blutende Gesicht. Fassungslos betrachtete er seine Hand, getränkt mit dem Blut seines Freundes.
Dann stand er langsam auf und drehte sich zu Jonaas um. Trauer lag in seinem Blick, Unglaube, gepaart mit einer Wut, die sekündlich größer wurde.
»Er ist tot!«, schrie er. »Tot!«
Die Bestie, die bis jetzt einfach nur dagestanden hatte, wandte den Kopf, und ihre gelben Augen fixierten den Wütenden.
Doch statt sich in Kalils Richtung zu bewegen, war Jonaas ihr Auserwählter.
Langsam und unhörbar schlich sie auf den Jungen zu. Geifer tropfte von ihren Reißzähnen, und die Pranke, die Tyk getötet hatte, hinterließ blutige Spuren auf dem Fels.
Sie kann das Scharren nicht verursacht haben, dachte Jonaas, als er zurückwich. Dafür bewegt sie sich viel zu geräuschlos.
Was nichts anderes hieß, als dass diese Bestie nicht allein war.
Ein Gedanke, der Jonaas ganz und gar nicht gefiel.
Ein weiterer Schritt zurück, dann spürte der Junge den kalten Fels der Höhlenwand in seinem Rücken.
Kalter Schweiß lief ihm in Strömen herunter, und seine Hand zitterte, als er das Messer aus seinem Gürtel zog. Seltsam klein, beinahe winzig wirkte die Klinge gegen die Zähne des Monsters, und Jonaas bildete sich ein, dass die Katze lächelte, als er ihr das Messer entgegen streckte.
Hilflos sah der Junge zu, wie der Panther seinen muskulösen Körper anspannte und sich bereit machte für den todbringenden Akt.
Jonaas kniff die Augen zusammen, hob das Messer in Kopfhöhe, und so gut es seine zitternden Hände zuließen, zielte er auf die Brust des Ungetüms.
Er stützte seinen linken Fuß an der Höhlenwand ab, versuchte einen sicheren Stand zu bekommen. Dann wartete er auf den Aufprall der zentnerschweren Last.
Plötzlich sah er aus den Augenwinkeln Kalil heranfliegen. Er hatte ebenfalls einen Dolch in der Hand und sprang der Katze mit voller Wucht in die Seite.
Der Sprung des Tieres wurde abgelenkt, es verfehlte Jonaas um einige Zentimeter und prallte gegen die Steinwand.
Ein wütendes Brüllen ließ die Höhlenwände erzittern.
Jonaas überwand seinen Schrecken und seine Angst diesmal etwas schneller. Er schnellte herum, und ehe sich der Panther wieder auf die Beine erhoben hatte, war er heran und stieß dem Untier sein Messer bis ans Heft in die weiche Seite.
Jetzt erst bemerkte Jonaas verwirrt, dass eine dunkle, lederne Decke den Rücken des Tieres zierte und ein schwarzer Lederriemen um seinen Hals lag.
Doch er hatte keine Zeit, diese Dinge näher in Augenschein zu nehmen, denn das mächtige Tier sprang auf seine Pfoten und drehte sich dabei so schnell, dass Jonaas das Messer aus der Hand glitt.
Waffenlos stand er dem Panther gegenüber, so nah, dass er den Atem des Tieres auf seinem Gesicht spürte.
Das Monster kam noch einen Schritt näher, das Messer in seiner Seite schien es nicht im Geringsten zu behindern. Ein tiefes Knurren entsprang der Kehle der Raubkatze, und Zähne blitzten im Licht der Höhle. Jonaas ballte die Fäuste. Auch wenn er keine Chance hatte, er würde es dem Tier so schwer wie möglich machen.
»Jonaas!« Kalils Ruf ließ den Kopf der Bestie herum zucken.
Jonaas und das Tier sahen gerade noch, wie Kalil anlief, dann sprang der Junge ab und landete auf dem Rücken der Katze.
Er blutete stark aus einer Schulterwunde, die er sich beim Sturz zugezogen hatte, trotzdem warf er seinem Freund einen triumphierenden Blick zu, als er sich in Fell und Lederriemen des Raubtieres festkrallte.
Sofort bäumte sich der Panther auf, als er das Gewicht auf seinem Rücken spürte, doch Kalil war nicht so leicht abzuschütteln.
Er war der mit Abstand beste Reiter des Dorfes, und bockende Pferde hatten ihn noch nie schocken können. Und bockende Raubtiere schienen für ihn keinen Unterschied zu machen.
Einen kurzen Moment lang saß er die Bewegungen des Untieres aus, dann riss er wieder das Messer, das er beim Sprung zurück gesteckt hatte, aus dem Gürtel und begann auf das Tier unter ihm einzustechen.
Die Bewegungen des Panthers wurden hektischer, das Gebrüll war ohrenbetäubend. Er sprang auf und nieder, versuchte, seinen Reiter an der Höhlenwand abzuscheuern, doch Kalil saß wie angewachsen auf dem Rücken des Tieres und stieß bei jeder sich bietenden Gelegenheit erneut zu.
Schon blutete die Katze aus einem Dutzend Stiche, und ihre Bewegungen wurden langsamer.
Jonaas stieß sich von der Höhlenwand ab und sprintete auf Tyks Messer zu, das vor dem leblosen Freund auf dem Boden lag. Er klaubte die Waffe auf und wandte sich der tobenden Bestie zu.
Als der Panther nach einem weiten Satz beinahe vor Jonaas landete, nutzte der Junge seine Chance.
Die Katze konzentrierte sich nur auf ihren Reiter, auf die tödliche Gefahr in ihrem Rücken, und da sie den Kopf gedreht hatte, bemerkte sie den zweiten Angreifer erst, als es bereits zu spät war.
Jonaas sprang vor und stieß das Messer tief in die ungeschützte Brust des Raubtieres.
Ein tiefes Grollen erklang, der Kopf der Bestie ruckte herum, und die gelben Augen fixierten Jonaas. Dann machte das Untier einen unsicheren Schritt auf den Jungen zu, doch als Kalil erneut mit dem Messer zustach, knickte ein Vorderlauf der Katze ein, und die mächtige Gestalt begann zu taumeln.
Kalil stieß sich vom Rücken des Tieres ab, landete hart auf dem Boden und rollte sich instinktiv vom stürzenden Körper weg, um nicht unter der sterbenden Bestie begraben zu werden.
Noch ein Taumeln, dann brach die Katze zusammen und schlug schwer auf dem Felsboden auf.
Das Brüllen wurde zu einem leisen Brummen, einem Winseln, und verstummte dann ganz.
Ein letztes Schwanzzucken, dann erloschen die gelben Raubtieraugen für immer.
Sofort kehrte wieder Ruhe in der Höhle ein, nur unterbrochen vom schweren Atem der Kämpfer.
Doch die Stille war trügerisch, hatte ihren Frieden für immer verloren.
Kalil kam stöhnend auf die Beine und hielt sich die verwundete Schulter. Er hob sein Messer vom Boden auf, wischte das Blut an seiner Hose ab und steckte es zurück in den Gürtel. Langsam ging er zum Kadaver des Raubtieres und stieß ihn vorsichtig mit dem Fuß an.
Nichts rührte sich.
»Tot«, sagte er keuchend. »Wir haben es geschafft.«
Jonaas kniete vor Tyks Leiche. »Leider nicht alle«, sagte er, und Tränen traten in seine Augen. Vor Aufregung und vom durchdringenden Blutgeruch, der in der Luft hing, war ihm ganz schlecht.
Kalil kam einen Schritt näher, doch dann wandte er sich ab, so, als wolle er Tyks Leiche und den Tod seines Freundes nicht akzeptieren.
»Was war das?«, fragte er verzweifelt.
Er wartete auf eine Antwort seines Freundes, doch der nächste Satz kam aus einer ganz anderen Richtung.
»Das war mein Reittier«, sagte eine tiefe Stimme, und ein Mann trat aus dem Schatten des Höhleneinganges in das Regenbogenlicht der Flamme.
»Und es war nicht besonders nett von euch, dass ihr es umgebracht habt. Barangatos gibt es nicht mehr sehr viele.«
Er kam näher, nicht so geräuschlos wie die Katze, und seine schweren Stiefel hinterließen das scharrende Geräusch auf dem Boden, das die Jungen aufgeschreckt hatte.
»Zum Glück besitze ich noch eines«, sagte der Unbekannte, und Jonaas und Kalil bemerkten frustriert, dass ein weiterer Panther im Rücken des Mannes erschien.
»Wer seid Ihr?«, fragte Kalil. Seine Stimme klang gequält, und sein Gesichtsausdruck verriet, dass ihm die Wunde an seiner Schulter große Schmerzen bereitete.
Der Mann antwortete nicht direkt, sondern trat noch etwas näher an die Jungen heran und beäugte sie kritisch.
»Kinder«, murmelte er. »Ich habe es nicht glauben wollen, und doch stimmt es. Die Sangapao überlassen die Wache ein paar Kindern.«
Er sprach offenbar zu sich selbst, lächelte dabei beinahe verträumt, und Jonaas nutzte die Zeit, um seinen Widersacher näher unter die Lupe zu nehmen.
Der Mann war überdurchschnittlich groß und sehr hager. Er hatte lange schwarze Haare, die bis auf seinen Gürtel fielen, und braune, fast schwarze Haut. Das Gesicht war lang, das Kinn spitz, die Nase zu klein, die Augen waren schmal. Eine Narbe in Form eines W zierte seine rechte Wange.
Der Körper steckte in Leder, schwarze, schwere Reitstiefel, Hose und Hemd waren aus dem gleichen Material.
Ein langer schwerer Umhang reichte von den Schultern fast bis auf den Boden.
Der einzige Farbtupfer waren zwei dunkelgrüne Armbänder und ein grünes Stirnband, das ihm das Haar aus dem Gesicht hielt.
Doch das Seltsamste an der Gestalt waren zwei große spitze Ohren, die wie Fledermausflügel aus seinen Haaren herausragten.
Jonaas hatte noch nie etwas Ähnliches gesehen.
»Wer seid Ihr?« Es war wieder Kalil, der die Frage stellte.
Und wieder antwortete der Angesprochene nicht direkt. »Ihr könnt mich nicht kennen«, sagte der Eindringling geheimnisvoll. »Oder ihr müsstet weit über hundert Jahre alt sein.«
Er kam näher. Nun trennten ihn keine zwei Pferdelängen von den Jungen.
»Stehenbleiben«, sagte Kalil und zog das Messer aus seinem Gürtel.
Die hagere Gestalt grinste wölfisch. Weiße Zähne blitzten in seinem dunklen Gesicht. »Wen willst du damit erschrecken?«, fragte er höhnisch.
Kalil ließ sich nicht verängstigen. Er deutete mit einem Kopfnicken auf den toten Panther. »Es hat für ihn gereicht«, sagte er mutig. »Dann kann es auch Euch gefährlich werden.«
Der Unbekannte lächelte weiter. »Lass dich nicht von Äußerlichkeiten blenden«, sagte er. »Glaub mir, Junge, ich bin gefährlicher als die Katze.«
Er schlug mit einer Handbewegung den Umhang zur Seite und gab den Blick auf ein langes schmales Schwert und eine Peitsche frei, die in seinem Gürtel steckten.
Kalil sah nur eine Chance.
Er musste handeln. Jetzt! Bevor der Hagere seine Waffe ziehen konnte.
Mit dem Mut der Verzweiflung warf er sich nach vorn, wollte sich auf den Eindringling werfen, doch eine winzige Handbewegung des Schwarzgewandeten stoppte Kalils Bewegungen.
Er verharrte mitten im Lauf.
»Ich kann mich nicht mehr bewegen, Jonaas!«, rief er entsetzt. Die Selbstsicherheit, die er zur Schau getragen hatte, fiel augenblicklich von ihm ab.
Jonaas wollte seinem Freund zur Hilfe kommen, doch er stand zu weit weg, und der Hagere war schneller. Er riss sein Schwert aus der Scheide, steppte elegant nach vorn und stieß Kalil ohne mit der Wimper zu zucken die Waffe in die Brust.
Der Junge röchelte, hustete, weit aufgerissene Augen starrten den Angreifer fassungslos an.
Dann machte der Unbekannte wieder ein Handzeichen und gab Kalil frei.
Sofort sank der Junge auf die Knie.
»Aber ...«, keuchte er.“Ich ...« Ein dünnes Rinnsal Blut lief aus seinem Mund, das Kinn entlang und tropfte auf sein Hemd.
Dann kippte Kalil nach vorn und blieb regungslos liegen.
»Mörder!«, schrie Jonaas und wollte auf den Schwarzen los, doch der zweite Panther schob sich blitzschnell zwischen ihn und den Jungen. Er trug ebenfalls eine Satteldecke, und der Schwarzgewandete, der sich nicht um Jonaas kümmerte, entnahm einer Satteltasche einen schwarzen, armlangen Stab, der mit seltsamen grünen Symbolen verziert war.
»Wer seid Ihr?«, schrie Jonaas dem Mann entgegen. Tränen der Verzweiflung und Wut trübten seinen Blick.
Der Junge hatte längst erkannt, dass dieser Angriff auch für ihn kein gutes Ende nehmen würde, doch er wollte sein Leben so teuer wie möglich verkaufen.
Der Unbekannte, der sein Schwert wieder weggesteckt hatte, ging auf die Flammensäule zu.
»Man nennt mich Gradoon, den schwarzen Lord«, sagte er, ohne sich nach dem Jungen umzudrehen. »Schade, dass du dein Wissen mit niemandem mehr teilen kannst.«
Eine erneute Handbewegung von ihm war ein Befehl an die Katze. Jonaas, der den Schwarzen beobachtet hatte, hatte keine Chance.
Die Pranke traf ihn am Hinterkopf und schleuderte ihn hart gegen die Felswand. Blut lief an seinem Hals entlang und nässte sein Hemd.
Er drehte sich keuchend um, wollte sich aufrappeln, doch der Panther war sofort über ihm.
Wieder sausten messerscharfe Klauen auf seinen Brustkorb herab, und Jonaas schaffte es nur, sich ein wenig zur Seite zu drehen.
Die Pranke verfehlte die Brust und zerfetzte stattdessen seine Schulter. Blut spritzte auf und färbte Jonaas' Gesicht rot.
Schmerz tobte in seinem Körper, er konnte sich nicht mehr bewegen, und als die Raubkatze erneut in seinem Gesichtsfeld auftauchte, schloss er die Augen und wartete auf den tödlichen Biss.
Ich will noch nicht sterben, dachte Jonaas. Bitte, ich darf noch nicht sterben. Lass mich in Ruhe, bitte.
Ein Schnuppern, stinkender Raubtieratem auf seinem Gesicht, doch die Umklammerung der tödlichen Kiefer blieb aus.
Offenbar glaubte die Katze, dass sie ihren Dienst bereits verrichtet hatte, denn sie ließ von ihrem Opfer ab und trabte zurück zu ihrem Herrn.
Und auch der Unbekannte kümmerte sich nicht um den Schwerverletzten. Er hatte Wichtigeres zu tun.
Er hielt den schwarzen Stab in die Feuersäule, murmelte einige Laute und wartete ab.
Plötzlich zerriss eine gewaltige Explosion die Stille, die Höhle erbebte in ihren Grundfesten, Blitze und Lichtkaskaden zuckten über die Wände, und ein Wind erhob sich, mächtig wie ein Wirbelsturm.
Der Schwarze jedoch stand im Zentrum des Geschehens wie ein Fels, und keine der Gewalten konnte ihm etwas anhaben.
Den Arm erhoben stand er da, ewig wie die Zeit, und wartete ab, bis der Spuk ein Ende hatte.
Und endlich war es so weit. Der Wind verstummte so schnell, wie er gekommen war, die Lichtsäule fiel in sich zusammen, die Blitze hellten die Höhle ein letztes Mal auf.
Dann war es vorbei.
Dunkelheit breitete sich im Gewölbe aus. Eine Schwärze, wie es sie seit hundert Jahren und mehr nicht mehr gegeben hatte.
Das Drachenfeuer war verschwunden, übrig geblieben war nur eine kleine Flamme an der Spitze des schwarzen Stabes.
Der schwarze Lord stieß ein raues Lachen aus, dann sprang er auf den Rücken des Panthers, und die Raubkatze bäumte sich hoch auf.
»Paradur!«, schrie der Schwarze, und seine Stimme hallte hundertfach wider. »Paradur!«
Dann trieb er die Raubkatze an und sprengte aus der Höhle.
Als auch das letzte Licht des Drachen ging, fiel das Gewölbe in tiefe Dunkelheit.
Und Jonaas, der alles durch einen blutigen Schleier beobachtet hatte, versank in endloser Nacht.
So muss der Tod sein, dachte er. Eben noch, als die Katze über ihm stand, hatte er um sein Leben gebangt. Jetzt kümmerte ihn der Abschied nicht, schien der Tod eine Erlösung.
Kalil und Tyk waren tot, das Drachenfeuer verloren, sie hatten auf ganzer Linie versagt.
Was störte ihn noch der eigene Tod?
Jonaas schloss die Augen und wartete auf das endgültige Aus.