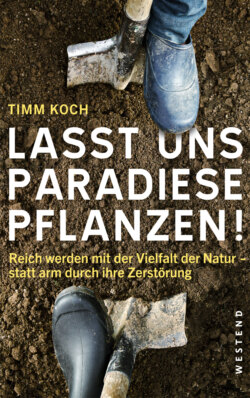Читать книгу Lasst uns Paradiese pflanzen! - Timm Koch - Страница 10
Faktencheck 2021
ОглавлениеDass mein somalischer Kumpel Yonis und ich in 17 Jahren tatsächlich ein platonisches Gespräch solchen Inhalts werden führen können, sei dahingestellt. Fakt jedenfalls ist, dass die Welt zu Beginn der zwanziger Jahre des neuen Jahrtausends inmitten von Weltuntergangsängsten steckt. Zur Corona-Epidemie und den Folgen der Erderwärmung gesellen sich Kriege, Flüchtlingsströme, Plastikverseuchung, Korallensterben, Waldbrände und eine noch nie dagewesene Konzentration von Reichtum auf die berüchtigten 0,1 Prozent der Erdbevölkerung. Die größte Katastrophe jedoch ist die rasant fortschreitende Vernichtung der Artenvielfalt und der Kollaps unserer Ökosysteme.
Während im dritten Jahr der Dürre im heimischen Siebengebirge der Harvester die abgestorbenen Fichtenmonokulturen zu riesigen, geradezu obszönen Haufen aufpoltert und im Zuge dessen unermüdlich immense Flächen ratzekahl abrasiert hat, wird von vielen die Wirkung von Corona auf die Welt wie eine Katharsis wahrgenommen, eine innere Reinigung durch Schmerz. Beim Weltwirtschaftsforum 2020 wird dafür die Bezeichnung »Great Reset« ins Spiel gebracht. Gleichzeitig klagen von der Trockenheit betroffene Bauern über gigantische Ernteausfälle, die sie anschließend vom Steuerzahler kompensiert bekommen. Einige warten schon mit der Idee auf, ihre gigantischen Getreidefelder mit Grundwasser am Leben zu halten. Die industrialisierte Land- und Forstwirtschaft in ihrer heutigen Form gilt weltweit als die größte Gefahr für die Vielfalt unserer terrestrischen Tier- und Pflanzenwelt. Natürlich bleiben auch die aquatischen Lebensräume nicht unberührt. Vor allem Süßwassersysteme sind von Überdüngung, Pestizideintrag und Plastikverseuchung betroffen. Von der PVC-Folie auf dem Spargelbeet über Folientunnel, die allerorts die guten alten Gewächshäuser aus Glas ersetzen, bis hin zur Gemüseverpackung produziert vor allem die Landwirtschaft jede Menge Plastik. Schätzungen gehen von 6,5 Millionen Tonnen jährlich aus, die weltweit durch die Landwirtschaft in unsere Umwelt gelangen. Land- und Forstwirte sind letztlich verantwortlich für einen schleichenden Ökozid, der sich vor unser aller Augen abspielt. In ihrer Täterrolle fühlen sie sich dennoch alles andere als wohl. Sie werfen den »Städtern« (oftmals durchaus zu Recht) vor, keine Ahnung zu haben von der Landwirtschaft, und so walzen sie regelmäßig in ihren Agrarpanzern zu Demonstrationen, auf denen gegen (!) Insekten- und Artenschutz agitiert wird. Diese Menschen in ihren kolossalen Maschinen – deren meterhohe Reifen auf dem Acker übrigens zu Verdichtungen im Boden führen, die das Leben unter der Erde empfindlich stören – haben Angst um ihre wirtschaftliche Existenz. Viele von ihnen entstammen Familien, die seit vielen Generationen Bauern sind. Sie sehen sich als letzte Bastion in einem immerwährenden Kampf gegen Banken, Molkereien, gierige Zwischenhändler und gnadenlose Discounter, und nun werden ausgerechnet sie, die Ernährer, von der Öffentlichkeit zu Parias erklärt. Neben ökologischen und sozialen Problemen hat die Landwirtschaft mit massiven wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Immer mehr geben auf. Das Sterben der Höfe findet ungebrochen seine Fortsetzung – sehr zur Freude der Agrarkonzerne, die damit ihre Marktmacht immer weiter ausbauen. Im Übrigen landen auch sie regelmäßig in der Insolvenz, nur um dann von noch Größeren geschluckt zu werden. Wer diesen Wahnsinn verstehen will, für den lohnt sich ein Blick auf die heutigen ökonomischen Aspekte hinter den Geschehnissen auf Forst, Acker und in den Mastbetrieben und deren Geschichte.
Ein Bauernhof ist traditionell sehr divers aufgestellt gewesen. Die Bauern zogen verschiedenes Gemüse an, kultivierten Blumen, Getreide und unterschiedlichste Arten von Obst, und hielten zusätzlich eine bunte Vielfalt an Vieh. Schweine, Rinder und Hühner teilten sich eine Welt mit Pferden, Eseln, Tauben, Gänsen, Honigbienen und Stallhasen. Außerdem mussten die Bauern und Bäuerinnen geschickte Händler sein, um ihre Waren auf dem Markt gewinnbringend zu veräußern. Obendrein existierte eine ganze Reihe handwerklicher Fähigkeiten, die eng an die Landwirtschaft angegliedert waren, wie etwa das Spinnen von Garn, die Korbflechterei, oder die Nahrungsmittelveredelung. Man wusste, wie geschlachtet wird, wie man mit Pökelsalz und Rauch die Hinterläufe eines Schweins in leckeren Schinken verwandelt, wie man aus Milch Käse gewinnt und wie man aus Stachelbeeren Marmelade macht. All dies gab den Höfen Nahrung und Einkommen und damit Resilienz gegen fast alle Unbilden der Zeitenläufe.
Mit der in den 1960er-Jahren einsetzenden sogenannten grünen Revolution wurde aus dem Bauernhof ein landwirtschaftlicher Betrieb und damit ein Fall für die Lehre der Betriebswirtschaft.
Die Rolle der Diversifikation in der Betriebswirtschaftslehre sieht folgendermaßen aus: Es gibt eine vertikale und eine horizontale Variante. Bei der horizontalen erweitert etwa ein Kaffeeröster, der vorher nur eine Sorte Bohnenkaffee im Angebot hatte, seine Produktpalette um Espresso, Crema, Mokka etcetera. Bei der vertikalen Variante hingegen verkauft derselbe Kaffeeröster auch noch Schlafanzüge, Dosenöffner und Damenslips. Übertragen auf die Landwirtschaft hieße das, dass ein Bauer, der ursprünglich nur Kühe gehalten hat, seine Produktpalette horizontal um anderes Vieh erweitern kann und auch noch Schafe, Ziegen und Schweine hält, oder sich vertikal diversifiziert und daneben Kartoffeln, Äpfel und Kohlgemüse in sein Verkaufssortiment aufnimmt. In der Betriebswirtschaftslehre wird im Spannungsfeld zwischen Spezialisierung und Arbeitsvereinigung bei Unternehmensgründungen erst einmal zur Fokussierung geraten, während gewachsene Unternehmen durchaus zur Diversifizierung ermuntert werden. In der Agrarökonomie hat man es also genau verkehrt herum gemacht. Hier wurde gewachsenen Betriebsstrukturen eine Spezialisierung geradezu aufgezwungen. Im Extremfall produziert der ehemalige, biodivers aufgestellte Bauernhof mithin nur noch Hühnerküken, von denen die weiblichen Tiere nach dem Schlüpfen an einen anderen Spezialisten geliefert werden, der sich dann um die Eierproduktion kümmert, während man die männlichen Küken kurzerhand in den Schredder wirft.
Ich selbst stamme nicht von einem Bauernhof, hatte aber das Glück, in einem Haus mit großem Garten aufwachsen zu dürfen. Selbstversorgung mit Obst und Gemüse war bei uns etwas völlig Selbstverständliches. Meine Großeltern gaben ihr gärtnerisches Wissen, mitsamt dem Enthusiasmus, den es braucht, dieses Wissen anzuwenden, weiter an meine Eltern, diese wiederum an meine Brüder und mich, und wir versuchen, es an unsere Kinder weiterzugeben. Zu unserem Garten gehörten und gehören auch Hühner. Heute kümmert sich fast ausschließlich meine Mutter um diese interessanten und nützlichen Vögel. In meiner Kindheit hingegen gehörte es zu den morgendlichen Pflichten meiner Brüder und mir, mit einer kleinen Schaufel das Kackbrett sauberzukratzen, eventuell vorhandene Eier einzusammeln, die Hühner zu füttern und ihnen Wasser zu geben. Abends mussten wir die Klappe zumachen. Wenn wir es vergaßen, und Meister Reineke kam zufällig des Weges, war es aus mit den Hühnern und unter großem Wehgeschrei musste eine neue Herde beschafft werden. Unsere Legehennen durften schon immer Würmer und Insekten picken, durften sich mausern, Glucken werden und ihre Küken großziehen. Sie haben jede Menge Auslauf, reiche Deckung aus Bäumen und Sträuchern, immer mindestens einen Hahn bei sich und dürfen schließlich – solange sie nicht Opfer von Habicht, Marder oder Fuchs werden – im hohen Alter von sieben, acht oder auch neun Jahren tot von der Stange fallen.
Mit wesens- und artgerechter Hühnerhaltung kennen wir uns also aus. Sie ist schön und macht Spaß. Die Tiere scheinen mir sehr intelligent zu sein. Sie haben ganz unterschiedliche Charaktere, ein ausgeprägtes soziales Gefüge und wachsen einem schnell ans Herz. Die meisten Hennen sind aufopferungsvolle Mütter, andere geben sich mit dem Nachwuchs weniger Mühe. Während junge Hähne zum Rabaukentum neigen, sind alte Hähne oft gesetzte Herren, die sich mit voller Hingabe ihrer Hühnerschar widmen. Sie sind es, die stets ein Auge gen Himmel gerichtet haben, um rechtzeitig vor der Habichtattacke warnen zu können, damit die Hennen mit ihren Küken in Ruhe der Nahrungssuche nachgehen können. Im Winter legen die Hühner wenig Eier, im Sommer legen sie viele. Die jugendlichen Rabauken werden meist im Alter von fünf oder sechs Monaten geschlachtet. Sie schmecken, genau wie die Eier der Hennen, um Meilen besser als ihre bemitleidenswerten Artgenossen aus der konventionellen Mast.
Diese folgt der Logik von Spezialisierung und Arbeitsteilung: Ein Betrieb produziert Zuchthennen, ein anderer brütet die Küken aus, ein dritter hat sich auf Masthähnchen spezialisiert, ein vierter auf die Eierproduktion und ein fünfter betreibt eine Biogasanlage, in der die abgewirtschafteten Legehennen nach circa eineinhalb Jahren zu elektrischem Strom »veredelt« werden. Sie dürfen nicht in die Mauser, weil sie in dieser Zeit weniger Eier legen und ihr Leben sich dann nicht mehr rechnet.
Als Gäste aus Mexiko bei uns zu Besuch waren, feierten wir unser Wiedersehen mit einem Topf Mole. Das Wort Mole hat seinen Ursprung in der Aztekensprache Nahuatl, genau wie im Deutschen die Worte Tomate und Schokolade. Das Gericht ist eine Art Sauce, die in den verschiedenen Regionen Mexikos sehr unterschiedlich ausfallen kann. Gemeinsam haben sie die große Vielzahl verschiedener Zutaten, je nach Rezept sind es für die Mole zwischen 35 und 75. Diese Vielfalt ist nicht überraschend, denn Mexiko liegt in Mesoamerika, einem Hotspot der Biodiversität, in dem mehr als 17 000 Pflanzenarten vorkommen. Mole wird hier als eine Art Paste auf den Märkten verkauft. Für das fertige Gericht braucht es dann noch eine kräftige Hühnerbrühe, mit der diese Paste angerührt wird. Das Suppenhuhn landet am Ende fachgerecht zerlegt als Fleischbeilage mit auf dem Teller. Dazu gibt es Reis und natürlich Tortillas. Am leckersten schmeckt die Mole, wenn man sie in einem irdenen Topf serviert. Wie es der Zufall wollte, hatte ich noch eines unserer Hähnchen in der Tiefkühltruhe. Leider wären wir von einem Hähnchen aber nicht satt geworden. Im Supermarkt gab es keine Bio-Hähnchen. Deshalb kauften wir eins aus konventioneller Mast. Es kostete nur wenige Euro. Als das Hähnchen, das ich selbst geschlachtet hatte, aufgetaut war, roch es frisch und sauber nach Huhn. Als wir dagegen das Masthähnchen aus seiner Plastikverpackung holten, roch es unangenehm. Obwohl es bestimmt ganz frisch war, haftete ihm ein schwer zu beschreibender, unangenehmer Geruch an. Als ich es gegenüber meiner Frau bemerke, sagt sie: »Das arme Ding hatte ein Scheißleben und musste sterben, damit wir satt werden können. Jetzt rede nicht auch noch schlecht von ihm.«
Damit hat sie natürlich einerseits recht, was den Respekt vor der Kreatur angeht. Andererseits finde ich, dass man über diese Dinge nicht schweigen darf. Als sie, nach allen Regeln mexikanischer Kochkunst letztendlich auf unseren Tellern lagen, hätte der Unterschied zwischen den beiden Tieren nicht größer sein können. Das Hähnchen meiner Mutter wartete mit dunklem, festen Muskelfleisch auf. Es war zart, hatte aber dennoch einen gewissen Biss und viel Geschmack – fast schon wie Wild. Das andere war weich und labberig, ohne wirkliche Textur und schmeckte immer noch ein wenig so, wie es von Anfang an gerochen hatte.
Viel tiefer will ich in diese Materie nicht eintauchen. Die perversen Auswüchse der modernen Massentierhaltung sind bekannt. Sie geschehen weder zum Vorteil der Menschen, die von schlechter Nahrung genauso krank werden können wie das arme Huhn aus dem Großstall krank wäre, würde man es nicht mit Antibiotika vollpumpen. Nur so kann es die wenige Tage Leben, die der Mensch ihm gönnt, ohne ernsthafte Infektionen überstehen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass kommende Generationen wegen unseres Umgangs mit unseren Nutztieren mit derselben Abscheu und demselben Unverständnis auf uns blicken werden, mit der wir heute jene Vorfahren betrachten, die das grausame Geschäft der Sklaverei betrieben haben. Der Wille dazu, all dies zu ändern, ist in großen Teilen unserer Gesellschaft Konsens. Allein, es fehlen die Konzepte. Selbst in Betrieben, die nach Demeter-Maßstäben arbeiten, kommen die Küken aus dem Brutschrank und müssen ohne Mutter aufwachsen. Auch in Biobetrieben sind Hühner eine gesichtslose Masse, ohne wirklichen Anspruch auf ein lebenswertes Leben und nur dazu da, dem Menschen Nahrung zu sein und Profit zu erbringen.
Schuld an den Auswüchsen und Grausamkeiten der industrialisierten Landwirtschaft sind in erster Linie weder die Bauern noch die gierigen Banker im Hintergrund noch die Maschinenbauer, die die Traktoren liefern, und auch nicht die chemische Industrie, die das Gift und den Kunstdünger beisteuert. In Wahrheit sind die Schuldigen jene Betriebswissenschaftler, welche die Grundgedanken »Spezialisierung und Arbeitsteilung« – die bei technischen Abläufen mit unbelebter Materie ja funktionieren mögen – auf Ökosysteme anzuwenden suchten. So schuf man Eintönigkeit, wo vorher Vielfalt herrschte. Bewährte bäuerliche Betriebsweisen, die stets Ertrag abgeworfen hatten, wurden an den künstlichen Tropf staatlicher Förderung gehängt und unrentabel gemacht.
Millionenfach in Brutkästen gezüchtete Hybridhühner gibt es erst seit den 1960er-Jahren. Vorher lebte die bunte Vielfalt der Hühner dieser Welt mehr oder weniger so wie die Hühner meiner Mutter. Viele Betriebswirtschaftler werden bei dieser Vorstellung reflexartig rufen: »So etwas kann heutzutage kein Mensch mehr gewinnbringend betreiben!« Dem will ich Folgendes entgegnen: Auch vor 1960 konnten Hühner profitabel gehalten werden, schließlich waren auch damals schon Profis am Werk. Allerdings wurde im Gegensatz zu heute die Hühnerhaltung, inklusive Hühnermast und Hühnerzucht, ganzheitlich gedacht. Man vermehrte Hühner, indem man Hennen, sobald sie in Brutlaune kamen (der Fachmann nennt es »Glucken«), ihre Eier ausbrüten und dann ihre Küken großziehen ließ. So wie es ihrer Natur entsprach. Niemand wäre auf die Idee gekommen, eine gute Legehenne nur deshalb zu schlachten, weil sie in die Mauser kam. Mit frischem Federkleid ging das Eierlegen ja munter weiter. Dieses Wirtschaften funktionierte gut, weil man eben nicht spezialisiert war. Die Hühnerhaltung war nur ein Standbein von vielen, die das komplexe Ökosystem Bauernhof mit all seiner Artenvielfalt und Biodiversität am Laufen hielten. Diese Systeme waren äußerst stabil und funktionierten durchgehend seit dem Neolithikum, also der Entstehung von Hirten- und Bauernkulturen vor mehr als 10 000 Jahren. Sie werden von vielen als einer der wichtigsten Faktoren für menschlichen Fortschritt und Entwicklung gesehen.
Blickt man hingegen heute, also Anfang der 2020er-Jahre auf den Zustand unserer landwirtschaftlichen Betriebe, so kann man sagen, dass sie äußerst instabile Systeme geworden sind. Der BÖLW (Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft e. V.) hat errechnet, dass seit 2005 in Deutschland im Schnitt jede Stunde ein Hof stirbt. Richtig los ging das große Sterben bei uns Anfang der 1970er-Jahre, also rund zehn Jahre, nachdem das erste Hybridhuhn aus seinem Ei schlüpfte. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) wurde im März 1957 – also etwa drei Jahre vor diesem Ereignis – unter anderem mit dem Ziel gegründet, die Industrialisierung der Landwirtschaft in den Mitgliedsstaaten voranzutreiben.
Die entscheidende Waffe zur Zerschlagung der bis dahin so stabilen bäuerlichen Strukturen war die Marktmanipulation mithilfe von Agrarsubventionen. Wirtschaftlichkeit stand bei der Produktion von nun an nicht mehr im Vordergrund, Hauptsache, der Umsatz konnte gesteigert werden. Letzteres hat leider so gut funktioniert, dass die Menschheit heute ein massives Problem mit der Überproduktion von Lebensmitteln hat und unvorstellbar gigantische Mengen tagtäglich auf dem Müll landen. Der schmerzliche Witz dabei ist, dass die meisten Bauernhöfe dennoch aus wirtschaftlichen Gründen kaputtgehen. Oft finden sich auch einfach keine Nachkommen für die Übernahme der Betriebe in Familienhand. Der Hof wird dann vom Nachbarn oder einem Heuschreckeninvestor geschluckt. So führt das Dogma von Arbeitsteilung und Spezialisierung letztlich zu immer riesigeren Höfen, welche durch die flächenbezogenen Agrarsubventionen auch noch strukturelle Vorteile gegenüber den kleineren Betrieben genießen. Dennoch geraten auch die Großen oft in eine wirtschaftliche Schieflage, weil sie gezwungen sind, ständig neue Investitionen für weiteres Wachstum zu tätigen – gleichzeitig sind die Erzeugerpreise so niedrig, dass auch die Produktion gigantischer Mengen die Gestehungskosten nicht auffangen kann.
Obwohl laut Weltagrarbericht noch immer ein Drittel der Menschheit in der Landwirtschaft arbeitet und dieses Drittel zum überwiegenden Teil aus Kleinbauern besteht, geht der Trend eindeutig in Richtung »Wachse oder weiche!«. Nach wie vor führt der Homo industrialis geradezu einen Krieg gegen seine Bauern und Hirten. Besonders krass fand dieser Krieg seinen Ausdruck während der sogenannten Entkulakisierung unter Josef Stalin, die ungefähr im Jahr 1928 losging. In dieser, von vielen heute als Völkermord betrachteten Menschheitstragödie, entledigte man sich der kleinbäuerlichen Strukturen durch Massenerschießungen, Deportationen und Unterbringung in Straflagern, den sogenannten Gulags. Allein in der dadurch ausgelösten Hungersnot kamen mehr als fünf Millionen Menschen um. Mit Kolchosen und Sowchosen entstanden landwirtschaftliche Großbetriebe, die nach dem Ende der Kommandowirtschaft Anfang der 1990er-Jahre ebenfalls wegen Unwirtschaftlichkeit zusammenbrachen.
Der Megatrend in Richtung immer größerer Gebiete, die industriell bewirtschaftet werden, ist seit etwa 1870, dem Beginn der industriellen Revolution, ungebrochen. Bemerkenswert ist, dass die amerikanischen Megafarmen, die neokolonialistischen Landgrabber in Afrika und die Regenwaldvernichter in Brasilien von heute sich aus ökologischer und ökonomischer Sicht mit »Wachse oder weiche!« dieselbe Zielsetzung gesetzt haben wie einst die Bolschewiken. Am Beispiel der 2016 pleitegegangenen KTG Agrar, Deutschlands bis dato größtem landwirtschaftlichen Konzern, sieht man jedoch, dass die Strategie des Immer-größer-Werdens von dem, was einst das komplexe Ökosystem Bauernhof darstellte, nach wie vor nicht aufgeht. Solange auf Spezialisierung und Arbeitsteilung zwischen den Betrieben gesetzt wird, wird sich daran auch nichts ändern. Spezialisierung bedeutet im Pflanzenbau zum Beispiel, dass ein Bauer nur noch Getreide und Mais anbaut, um nur noch eine Tierart, sagen wir Schweineferkel aufzuziehen. Die werden von einem Zuchtbetrieb geliefert, der die Muttertiere in stählernen Kastenständen hält. Ein weiterer, ebenfalls hochspezialisierter Zulieferer bringt Soja von den abgeholzten Regenwaldflächen Südamerikas. Als Totschlagargument für diese Verarmung einer einstmals bunten Produktpalette der Bauernhöfe wird unausweichlich die Wirtschaftlichkeit angeführt. Ganz gleich, ob der betroffene Bauer, der Politiker oder der Agrarökonom spricht: Stets heißt es, landwirtschaftliche Betriebe stünden unter internationalem Konkurrenzdruck und müssten wirtschaftlich arbeiten. Dabei ist aber genau diese Wirtschaftlichkeit selten gegeben. Agrarökonomen sprechen hier von einem Phänomen, das sich »Landwirtschaftliche Tretmühle« nennt. Professor Harald von Witzke von der Humboldt-Universität zu Berlin, definiert sie so:
»Die Weltlandwirtschaft hat … immer mehr Nahrungsgüter für immer mehr Menschen zu immer geringeren Preisen und in immer besserer Qualität bereitgestellt. Und daher kommt der Ausdruck Landwirtschaftliche Tretmühle. Die Landwirte sind weltweit immer produktiver geworden. Bildlich gesprochen sind sie immer schneller gelaufen, aber ökonomisch sind sie dann doch nicht vom Fleck gekommen, denn der Einkommenseffekt der Produktivitätssteigerung wurde immer wieder erodiert durch sinkende Preise.«1
Ob die Qualität der Nahrungsgüter unter den regelmäßigen Pestizidduschen, denen sie in unserer landwirtschaftlichen Realität ausgesetzt sind, wirklich besser geworden ist, wage ich zu bezweifeln. Entscheidend ist aber etwas anderes: Unser gemeinsamer Schatz, die wunderbare Vielfalt an Tieren und Pflanzen, ist in den Sog dieser »Landwirtschaftlichen Tretmühle« geraten und droht in ihm für immer verlorenzugehen. Die Produktionssteigerung hat auch unter Stalin geklappt. Wirtschaftlich ist die industrialisierte Landwirtschaft trotzdem nie geworden. Daran haben weder die Subventionen der Europäischen Union noch Kommandowirtschaft der Bolschewiken etwas geändert.
In der Landwirtschaft geht der Trend Richtung großer Konzerne, die immer größere Flächen als Monokulturen bewirtschaften, immer größere Ställe für ihre Hybridsauen und Turbokühe bauen und so weiter. Wir werden die Biodiversität unseres Planeten nur dann erhalten können, wenn wir die Großen mit ins Boot holen. Was wäre also, wenn die sich diversifizieren? Wenn einer der großen Höfe also gleichzeitig Hühner, Schweine, Kühe, Schafe, Ziegen, Obst, Gemüse und Getreide produziert? Wir müssen Wege finden, sie dazu zu bewegen, sich die Biodiversität zunutze zu machen, statt sie mit Gift und Pflug und schwerem Gerät zu bekämpfen. Es gibt agrarische Systeme wie die Feld-Wald-Wirtschaft, oder Waldgärten und die Idee der Permakultur, die seit alters her erprobt und enorm ertragreich sein können. Sie sind unsere einzige Chance, wenn wir die Artenvielfalt retten und wiederherstellen wollen.
Anfang der 1960er-Jahre rief der amerikanische Agrarökonom Norman Borlaug (1914–2009) die »Grüne Revolution« aus. Unterstützt durch die Rockefeller-Stiftung war es ihm gelungen, einen Weizen zu züchten, der durch seinen kurzen Halm in der Lage ist, eine unnatürlich schwere Ähre zu tragen. Dadurch konnte einerseits die Erntemenge enorm gesteigert werden, und Borlaug ließ sich feiern als den Mann, der Millionen vor dem Hungertod bewahrte. Andererseits waren die neuen Hochleistungszüchtungen auf intensive Düngung angewiesen und waren anfällig für Krankheiten. Mit der »Grünen Revolution« begann die Herrschaft von Kunstdünger und Pestiziden auf unseren Äckern. Heute, sechzig Jahre später, verbreitet sich unter dem Namen Zöliakie eine Weizenunverträglichkeit unter den Menschen, die epidemische Ausmaße angenommen hat. Das Getreide, das die Menschheit in ihrer Entwicklung derart gefördert hat, ist für viele giftig geworden. Nachdem anfangs pauschal das im Getreide vorkommende Gluten hierfür verantwortlich gemacht wurde, ist die Wissenschaft mittlerweile einen Schritt weiter. Das Gluten der neuen Weizenzüchtungen ist anders zusammengesetzt als jenes der althergebrachten Sorten. Zudem spielt die hohe Belastung mit Glyphosat, ohne welches der Turboweizen schlecht zurechtkommt, bei den Vergiftungserscheinungen eine entscheidende Rolle. Wir brauchen eine radikale Abkehr von der »Grünen Revolution« und eine Hinwendung zu altbewährten Konzepten. Dieses Rütteln an den Dogmen des Norman Borlaug wird sich für die Mehrheit der traditionell geschulten Agrarökonomen »spooky« anhören. Dennoch führt kein Weg an einer deutlichen Kursänderung vorbei.
Damit dies gelingen kann, brauchen die Agrarökonomen dieser Welt sehr, sehr dringend Nachhilfe in Sachen Ökologie. Sie sind nicht die einzigen. Die Agrarwende, die wir eher gestern als heute bräuchten, um das Artensterben zu beenden, unsere Böden zu retten und unsere Ernährung dauerhaft zu sichern, muss zuallererst in unseren Köpfen stattfinden. Um zu zeigen, wie schwierig das ist, und wie es dennoch gelingen könnte, möchte ich den Leser auf ein Gedankenexperiment einladen, das ein kleines, aber hochinteressantes Insekt aus der Familie der Schmetterlinge zum Kern hat: den Apfelwickler. Ihm möchte ich das folgende Kapitel widmen.