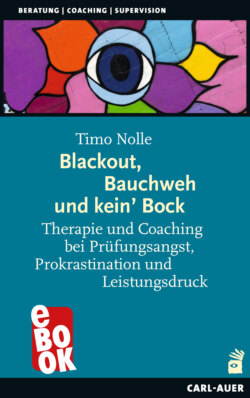Читать книгу Blackout, Bauchweh und kein' Bock - Timo Nolle - Страница 17
1.4Viele Ansätze, eine Haltung
ОглавлениеDie thematische und methodische Vielfalt im Prüfungscoaching birgt die Gefahr eines inkonsistenten und eklektizistischen Arbeitens, woraus für die Klienten hinderliche Widersprüche entstehen können. Daher ist es wichtig, sich bei aller mentaler Flexibilität an bestimmten Grundhaltungen zu orientieren, die in der Beratung als innerer Kompass dienen.
Selbstbestimmung: Die Förderung der Selbstbestimmung und insbesondere der psychologischen Grundbedürfnisse Autonomie-Erleben, Kompetenz-Erleben und Erleben von sozialer Eingebundenheit ist ein elementarer Bestandteil des Prüfungscoachings (s. S. 31). Auch wenn einige Techniken, wie z. B. das Entwickeln und Nachsprechen von Affirmationen, auf den ersten Blick direktiv und wenig selbstbestimmt anmuten, so ist gerade hierbei die Ausrichtung der Berater auf die Selbstbestimmung der Klienten enorm wichtig. Ob eine Affirmation passt, wird ausschließlich durch die Klienten bestimmt. Somit kann auch eine grammatikalisch falsche und für den Berater inhaltlich nicht nachvollziehbare Affirmation für den Klienten überaus wirksam sein.
Respekt vor dem subjektiven Erleben: Menschen konstruieren ihr Erleben durch die Fokussierung ihrer Aufmerksamkeit. Dieses Erleben ist ihre Realität, in der sie selbst vorkommen und in der sie selbst real sind. Ein Anzweifeln dieser subjektiven Realität würde auch die Person selbst infrage stellen (s. S. 37). Berater können daher höchstens Angebote machen, die eigene Aufmerksamkeit zu explorieren und umzulenken, den inneren Scheinwerfer größer oder kleiner einzustellen und Dinge in ein anderes Licht zu setzen.
Body first: Die psychologische und psychotherapeutische Forschung, wie sie überwiegend an Universitäten gelehrt wird, hat bis vor einigen Jahren den Eindruck vermittelt, der Mensch hätte nur ein kognitiv rational denkendes Gehirn, die Beteiligung des Körpers an emotionalen, motivationalen und kognitiven Prozessen wurde hingegen übersehen. Ebenso wurden Zusammenhänge zwischen psychischen Schwierigkeiten und körperlichen Prozessen wenig berücksichtigt. Lange Zeit waren chemische Prozesse im Gehirn die einzigen körperlichen Vorgänge, die bei psychotherapeutischen Behandlungen berücksichtigt wurden. Dies hängt auch mit der Trennung der Wissenschaftsdisziplinen Physiologie und Psychologie zusammen. Die Erkenntnisse der Polyvagal-Theorie von Stephen Porges (s. S. 85) bieten für zentrale psychologische Phänomene und insbesondere für Ängste und passives, depressives Verhalten physiologische Erklärungs- und Handlungsansätze. Die zentrale Aussage der Polyvagal-Theorie lautet, dass der Zustand des Organismus die Fähigkeiten zum Aufbau von Beziehungen, zum Lernen, zur Kommunikation und zur Nutzung des kognitiven, emotionalen und kreativen Potenzials limitiert. Solange die körperlichen Voraussetzungen nicht passen, kann weder gelernt, noch beraten, gecoacht oder therapiert werden. Emotionale Veränderung ist daher vor allem eine körperliche Veränderung.
Lernen und Entwicklung sind artgerecht: Lernen und Entwicklung sind die natürlichen Richtungen des Lebens. Motivation zum Lernen oder zur persönlichen Entwicklung ist daher nichts, wofür man Energie aufbringen und sich zusammenreißen muss. Motiviert zu sein und sich zu entwickeln ist der Normalzustand. Wenn eine Entwicklung stagniert, jemand also unmotiviert ist, dann liegen psycho-logisch gute Gründe dafür vor, die innerhalb des Systems schlüssig sind.
Potenzialentfaltung: Schule wird von vielen Schülern als ungeheure Last und Qual erlebt. Die als Leistungsdruck erlebten Anforderungen versetzen oft ganze Familien in Aufregung. Eine Klassenarbeit kann Endzeitstimmung am Frühstückstisch erzeugen. Oft leiden die Eltern ähnlich wie die Kinder. Olaf-Axel Burow, der Begründer der Positiven Pädagogik und Autor des Geleitworts zu diesem Buch, weist daraufhin, dass das Glück aus der Pädagogik und Schule unserer heutigen Gesellschaft förmlich verdrängt wurde (Burow 2011). Während Glückseligkeit in früheren pädagogischen Schriften noch als explizites Erziehungsziel auftaucht, sehen wir in heutigen Schulen, in erziehungswissenschaftlichen Veröffentlichungen und auch in der Lehrerbildung andere Schwerpunktsetzungen. Würde es in Schulen, Hochschulen etc. in erster Linie um die Entfaltung des individuellen Potenzials der Menschen gehen, gäbe es andere Schulen mit anderem Unterricht und dieses Buch wäre nicht nötig.
Klienten haben daher oft die Erwartung an Coaching, Beratung und Therapie, die Last erträglicher zu machen, die Schulzeit und die Prüfungen zu überleben. Das Ziel von PAC ist aber mehr als Überleben: PAC ist ausgerichtet auf Freude, Genuss und Leichtigkeit in Lern- und Leistungssituationen. Ich vertrete ein positives Bild von Leistung, bei dem es nicht um die perfekte Umsetzung äußerer Leistungsvorgaben geht, sondern um die individuelle Weiterentwicklung. Und auch dies stimmt nur, wenn Weiterentwicklung zugleich als Selbstverwirklichung verstanden wird und die Entwicklungsrichtung von innen kommt.
Prüfungscoaching sollte auf keinen Fall ein »push it to the limit« sein. Es geht nicht darum, sich selbst bzw. die Klienten an äußere Leistungserwartungen anzupassen, um diesen noch mehr zu entsprechen, oder darum, die eigenen Schwächen und Unfertigkeiten um jeden Preis zu verstecken oder sogar auszumerzen. Leistungssituationen sind immer nur ein Teil in einem Entwicklungskontext, niemals die Hauptsache, und sollten daher auch immer als ein solcher Baustein gesehen und relativiert werden.