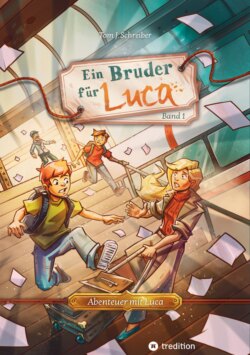Читать книгу Ein Bruder für Luca - Tom J Schreiber - Страница 10
Оглавление5
Als ich wach wurde, war es dunkel. Ich war eingeschlafen und schoss nach oben. Sofort hellwach sah ich auf den Radiowecker. Drei Uhr achtzehn. Immer noch genügend Zeit, um zu türmen! Wollte ich überhaupt? Der Schlaf hatte die Erlebnisse vom Vortag entkräftet, stattdessen brachte die Nacht Zweifel. Ich erinnerte mich, dass Marcel nicht mehr mit von der Partie war. Mit offenen Augen sank ich ins Kissen und starrte in die Luft. War, was ich vorhatte, wirklich richtig? War es überhaupt möglich? Im selben Moment fiel ein Lichtkegel an die Decke. Abwesend beobachtete ich ihn, wie er umhertanzte. Es dauerte eine Zeit, bis mich ein Geistesblitz durchfuhr - Marcel! Ich sprang vom Bett und lief ans Fenster. Tatsächlich! Unten vorm Haus stand er mit einer Taschenlampe. Wild gestikulierend winkte er mich zu sich. Ich legte meinen Zeigefinger auf die Lippen, um ihm zu bedeuten, dass ich verstanden hatte. Mein Herz machte einen gewaltigen Luftsprung. Mein bester Freund hatte mich nicht im Stich gelassen. Natürlich hatte er das nicht. Wie hatte ich das überhaupt denken können? Jetzt wo er da war, wunderte ich mich über mich selbst. Die Zweifel, die ich eben noch gehabt hatte, waren wie weggeblasen. Wir würden zusammen türmen, und zwar genau jetzt. Ich öffnete das Fenster. Die frische Luft war herrlich. Ich zog den Rucksack unterm Bett hervor, wo ich ihn gedankenlos hingekickt hatte. Mit einem Handgriff drehte ich ihn um und entleerte die Schulsachen auf den Fußboden. Ich verstaute ein paar Dinge, für unterwegs. Auf Zahnbürste und Seife verzichtete ich, um nicht noch ins Badezimmer schleichen zu müssen. Wenn mein Vater aufwachte, war alles gelaufen. Es hatte nur wenige Minuten gedauert, bis ich startklar war. Ich ging ans Fenster und zeigte Marcel den Rucksack. Er hob grinsend den Daumen. Mein Blick fiel auf das Haus gegenüber. Wieso waren die Fensterläden nicht geschlossen? Seltsam dachte ich, hatte aber keine Zeit darüber nachzudenken. Gerade rechtzeitig fiel mir mein Kaugummivorrat im Kleiderschrank ein. Schnell stopfte ich ihn noch zu den anderen Sachen und behutsam öffnete ich die Tür. In der Wohnung war es stockdunkel. Ich blickte zurück. Still verabschiedete ich mich von meinem Zimmer, ohne zu wissen, ob ich es je wiedersehen würde. Dieser Abschied war schmerzhafter, als meinen Vater zu verlassen. Ich hatte dreizehn Jahre darin verbracht und verband damit mein ganzes Leben. Es half nichts. Ich riss mich aus den Gedanken und schloss die Tür. Vielleicht würde Vater, nach unserem Streit, erst mal nicht nach mir sehen. Mit etwas Glück würden wir einen guten Vorsprung bekommen. Langsam und lautlos schlich ich über den Flur. Mein Herz schlug so sehr, dass ich befürchtete mein Vater könne allein davon aufwachen. Bei jedem Schritt, den ich vor den anderen setzte, rechnete ich mit einer Falle, die er aufgestellt hatte, um das zu verhindern, was ich tat. Sachte schlich ich vorwärts, um auf Hindernisse gefasst zu sein. Ein Knarzen. Mir wurde heiß. Ich lauschte. Erleichtert tappte ich weiter. Hoffentlich hatte er nicht den Ehrgeiz wach zu bleiben, um mir vor der Wohnungstür aufzulauern. Ohne das geringste Geräusch zu verursachen, drückte ich die Klinke. Es war abgeschlossen. Wortlos fluchend, suchte ich in der Hosentasche den Schlüssel. Hätte ich ihn bloß, in meinem Zimmer, vom Bund herunter genommen. Ich hatte an alles gedacht, nur nicht an das Offensichtlichste. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich ihn vorsichtig vom Ring lösen konnte. Dabei keine Geräusche zu verursachen, war so gut wie unmöglich. Ich hielt den Atem an, während ich, unter leisem Klicken, das Schloss öffnete. Ich lauschte zurück in die Wohnung. Nach wie vor war alles ruhig. Vielleicht war es nicht schlecht gewesen, dass ich eingeschlafen war. So hatte mein Vater keinen Verdacht geschöpft. Vielleicht traute er es mir auch einfach nicht zu. Egal, dachte ich. Zufrieden öffnete ich die Tür.
Ich musste meine Aufregung zügeln, um im Treppenhaus keinen Lärm zu verursachen. Eine kleine Ewigkeit später, hatte ich das Erdgeschoss erreicht, öffnete lautlos die Haustür und entdeckte Marcel, der davor auf der Treppe saß.
»Na endlich, Bro. Musstest du dich erst noch schminken oder was?«, begrüßte er mich ungeduldig.
»Leise Mann, lass uns erst mal abhauen.« Beunruhigt blickte ich zu unserer Wohnung hinauf. Alles war dunkel. Ich sah zum geöffneten Fenster der alten Dame gegenüber. Hatte sich dort oben etwas bewegt? War sie ebenfalls wach und beobachtete, wie ich von zu Hause ausriss? Reflexartig legte ich meinen Zeigefinger auf die Lippen und schaute noch mal hinauf, ohne zu wissen, ob sie wirklich da war. Wieder kam es mir vor, als würde sich etwas bewegen. Wahrscheinlich wehten nur die Vorhänge im Wind. Noch ein kurzer Blick zu meinem Fenster.
»Verdammt«, fluchte ich leise.
»Was ist?«, flüsterte Marcel erschrocken.
»Mein Fenster ist offen.«
»Ist doch egal. Komm jetzt endlich«, schien er langsam genervt. Ich nickte und gemeinsam eilten wir die Straße entlang.
»Mann, ich dachte, du würdest den Schwanz einziehen, als du vorher gegangen bist«, sagte ich zu Marcel.
»Das liegt daran, weil du manchmal echt gar nichts checkst. Wenn ich nicht dazwischen gegangen wär, hätte dich dein Vater noch im Keller eingesperrt, so wie ihr euch angestachelt habt!«
»Er ist nur vielleicht mein Vater, aber mit dem Rest hast du recht«, grinste ich.
»Abgesehen davon wars ’ne coole Vorstellung«, zwinkerte er mir zu.
»Danke«, lachte ich.
»Aber jetzt erzähl, was hast du für Briefe gefunden?«
»Na ja, also der eine war eher nicht so interessant. War von Dad an seine Frau, einen Monat, bevor ich zur Welt kam. Er hatte nur geschrieben, dass er sich auf mich freut, oder auf sein Kind eben. Nichts, was zu verwenden wäre. Der andere war ein Hauptgewinn. Von meinem vielleicht Dad an seine Schwester, sprich meine Mom oder vielleicht Mom. Auf jeden Fall komplett mit Adresse.«
»Wow«, sagte Marcel. »Das ist wirklich ein Volltreffer. Da müssen wir mit dem Typ ja nur noch Kontakt aufnehmen und du holst alles nach, was du in dreizehn Jahren versäumt hast!«
»Das machen wir«, sagte ich zurückhaltend.
Marcel sah mich skeptisch an. »Du hast dir die Adresse nicht eingeprägt«, konnte er es kaum glauben.
»Nur den Nachnamen, und dass er in München wohnt«, sagte ich kleinlaut. »Ich dachte ja, ich kann die Briefe mitnehmen. Wenn ich nur nicht so unvorsichtig gewesen wäre.« Marcel schüttelte fassungslos den Kopf, ließ sich aber nicht entmutigen.
»O Mann«, schlug er sich gegen die Stirn. »Aber jetzt hör auf, schon wieder schwarz zu sehen. Wir finden ihn … ganz sicher.« Ich antwortete nicht, sondern nickte nur und versuchte ein, so zuversichtliches Gesicht, wie möglich aufzusetzen.
»Hat dein Dad noch großen Ärger gemacht?«, fragte er mich. Weniger aus Interesse, als um das Thema zu wechseln.
Ich zuckte mit den Schultern. »Hat eigentlich nur noch mein Handy mitgenommen und gesagt, dass ich morgen nicht raus darf.«
»Was hat er?« Marcel schien entsetzt.
»Mein Handy mitgenommen und gesa…«
»Ich hab dir ein paar Nachrichten aufs Handy geschickt. Dachte du schläfst, als du nicht geantwortet hast«, unterbrach er mich. Ich sah ihn eindringlich an.
»Was denn für Nachrichten?«
»Ziemlich blöde Nachrichten, falls dein Dad die liest. Dass ich dich nicht im Stich lasse und dich später abhole, um zu türmen, und so.«
»Ach du meine Güte. Dann müssen wir sehen, dass wir Land gewinnen.«
»Warte mal«, hellte sich Marcels Miene auf. Er nahm sein Handy und tippte darauf herum. Am Ende zeigte er mir das Display.
[Mein Dad hat mich erwischt. Wir können nicht weg. War vielleicht ohnehin keine gute Idee. Gehen wir morgen früh zum Strand?]
Ich grinste und nickte. Marcel drückte auf senden.
»Na dann, auf nach München«, rannte er ausgelassen los. Ich bewegte mich nicht von der Stelle. »Was ist? Komm schon!«, Marcel hatte gemerkt, dass ich nicht folgte. Langsam kam er zurück.
»Ich denke nicht, dass das Ganze bis zu deinem Ferienlager, in drei Wochen, abgeschlossen ist.«
»Jetzt mach mal halblang, Bro. Du glaubst nicht ernsthaft, dass ich in ein lahmes Zeltlager gehe, wenn ich das hier erleben kann. Außerdem, will ich auf jeden Fall dabei sein, wenn du deinen Vater kennenlernst.«
»Herausfinde, ob es mein Vater ist«, warf ich mahnend ein.
»Wie du willst. Jedenfalls packst du das doch gar nicht ohne mich«, fügte er scherzend hinzu. Ich überlegte, ob ich versuchen sollte, ihm auszureden, mir zu helfen. Es war nicht fair, ihm seine ganzen Ferien kaputt zu machen. Wie ich ihn kannte, machte es ihm womöglich wirklich Spaß. Ohne ihn würde ich bei den ersten Schwierigkeiten sowieso scheitern. Wenn ich das durchziehen wollte, nur mit Marcel. Also sparte ich mir weiteren Widerspruch. Wie zur Bestätigung fing er an zu grinsen.
»Wir werden das beste Ferienlager unseres Lebens haben!«, sagte er. »Kommst du?«
»Auf jeden Fall!«, freute ich mich und rannte los. Entlang der bekannten Hofeinfahrten und Gehwege, entfernten wir uns von meinem Zuhause. Ich lief immer schneller, sodass Marcel es schwer hatte, mir zu folgen. Erst, als ich mich nicht mehr gut auskannte, wurde ich langsamer. Marcel kam näher und überholte. Er lief weiter, hinunter in Richtung Hafen. Es ging bergab und das Laufen fiel leicht.
Die Bordsteine verschwimmen vor meinem Auge. Der Rhythmus ist gefunden. Gleichmäßig spüre ich abwechselnd meine Füße, wie sie auf den Asphalt aufsetzen, um sich direkt wieder abzustoßen. Es stimuliert, darauf zu achten. Eine Art Trance überkommt mich. Dennoch werde ich nicht langsamer - im Gegenteil. Das Laufen fällt mir so leicht, dass ich keine Anstrengung spüre. Lässig springe ich den Bordstein hinunter, gleich darauf wieder hinauf. Eine Querstraße - noch eine. Ich folge dem Gehweg, bis es nicht mehr weitergeht. Ich will weiterlaufen. Rechts diesmal, etwas den Berg hinauf. Ich möchte meine Muskulatur spüren. Ich brauche Anstrengung. Jetzt merke ich, dass sich mein Oberschenkel anspannt. Ein Raum. Endlich fühle ich mich wieder besser. Trotzdem weine ich. Wie lange bin ich schon hier? Ich warte, dass mich meine Mutter in den Arm nimmt. Sie kommt nicht. Ich darf nicht weggehen von hier. Ich muss auf meine Mutter warten. Sie kommt gleich. Wenn ich weg bin, wird sie mich nicht finden. Er trägt mich weg. Weg von meiner Mutter. Wohin? Ich weine. Er soll mich hier lassen.
Ich laufe auf einen Platz zu. In der Mitte ein großer Obelisk. Marcel blieb stehen, die Hände in die Hüften gestemmt, schwer atmend. Er grinste mich mit rotem Kopf an, während wir uns gegenseitig auf der Schulter abstützten.
»O Mann, keine Kondition mehr«, schüttelte Marcel den Kopf, als er wieder zu Atem gekommen war.
»Sag mal und deine Eltern haben einfach zugestimmt, dass wir allein auf Tour gehen?«, fragte ich, während wir uns auf eine Mauer setzten. Er sah mich verdutzt an.
»Spinnst du? Mein Dad mag ja cool sein, aber du glaubst nicht im Ernst, dass er so was erlauben würde. Sicher hält er es für eine absolut hirnrissige Idee. Ich hab mich, wie du, davon geschlichen. Für morgen früh, hab ich ’nen Zettel hingelegt, dass wir schon am Strand sind. Weiß nicht, ob sie es mir abnehmen, aber ich denke mal. Wenn sie den Zettel nicht zu früh entdecken, wird es klappen, dass sie sich bis zum Abend keine Sorgen machen.«
»Und wenn nicht? Die werden doch sicher versuchen dich auf dem Handy zu erreichen!«
»Ich werd halt nicht rangehen. Wäre ja nicht das erste Mal. Sie denken dann ich bin im Wasser, oder was weiß ich«, winkte Marcel ab. »Mein Dad wird nicht gleich zur Polizei rennen. Wir können uns von unterwegs bei ihm melden. Viel wichtiger ist Kohle. Wie viel hast du mitgenommen?«
Natürlich hatte ich vergessen, Geld mitzunehmen. Das war wieder typisch. Hauptsache, der Kaugummi war mir wichtiger gewesen, als Kohle. Ich schüttelte den Kopf.
»Sorry. Hast du was?«
»Dreihundert Euro. Das muss eben für das Nötigste reichen.«
»Die kriegst du zurück … versprochen!«, versicherte ich. Schon wieder hatte ich einen Grund, mich zu ärgern. Eine Zeit lang, saßen wir schweigend nebeneinander.
»Was, wenn wir ihn in München nicht finden?«, sagte ich. »München ist doch mindestens so groß wie Marseille.«
Marcel musterte mich. »Bro, willst du dir jetzt die ganze Fahrt überlegen, was alles schief gehen könnte? Das wird anstrengend, sag ich dir, weil es tausend Sachen sein werden. Keine Ahnung. Wenn er noch in München wohnt, finden wir ihn und wenn nicht, sieht es düster aus? Lass uns keine Gedanken darüber machen. Wir sehen, wie es kommt.«
»Hast recht«, nahm ich mir vor seinen Rat zu beherzigen.
»Na also. Wenn du dich mehr auf den Plan konzentrierst, als auf deine Bedenken, würde ich das echt begrüßen.« Er zwinkerte mir zu.
»Habs verstanden«, grinste ich.
»Die viel dringendere Frage ist, wie wir nach München kommen.«
Ich überlegte. »Autostop wäre günstig, aber scheidet aus, finde ich. Dauert ewig für so ’ne Strecke und ist auch gefährlich, oder?«
»Sehe ich auch so«, nickte Marcel. »Ich hab mal gehört, es fahren so Reisebusse«, überlegte er.
»Oh ’ne«, sagte ich spontan. »Hab echt kein Bock, ewig lang, mit ’nem Haufen fremder Menschen durch die Gegend zu eiern. Die fragen uns nur Löcher in den Bauch. Ich finde, wir sollten Zug fahren. Da kann man sich ab und zu umsetzen und reist nicht die ganze Zeit mit den gleichen Leuten. Außerdem kann man auch mal ’rumlaufen.«
»Wird wahrscheinlich das Beste sein. Fliegen scheidet eh aus. Viel zu viele Sicherheitsschleusen. Zug fahren ist wohl am unauffälligsten.«
»Na, dann los. Ich will endlich weg hier«, sprang ich von der Mauer.
Nach einer knappen Stunde Fußweg, standen wir vor der imposanten Treppe, die zur Bahnhofshalle hinaufführte. Von Weitem hatte ich das Gebäude immer als sehr majestätisch empfunden. Jetzt wo ich direkt davor stand, war es einfach überwältigend. Wir stiegen nach oben. Hoch aufragende Eingangstore führten durch die noch höhere Fassade, direkt ins Innere. Außer dem alten Gemäuer bot sich vieles moderner, als es das Gebäude vermuten ließ. Fasziniert bestaunte ich, dass es sogar Bäume gab, die aus dem Boden zu wachsen schienen. Ich erinnerte mich vage, dass ich vor Jahren schon einmal hier gewesen war. Auf den Bahnsteigen herrschte gähnende Leere. Hier und da zog jemand einen Koffer hinter sich her oder saß auf einer Bank, um zu warten. Ich atmete den typischen Bahnhofsgeruch ein. Eine Mischung aus erhitztem Stahl, Schmieröl und Urin. Marcel deutete hinauf zu einer großen Anzeigetafel. Der nächste Zug ging in einer Stunde. Der erste des heutigen Tages. Ich verzog das Gesicht.
»Ich muss jetzt aber nicht noch ewig ’rumsitzen und warten?«, stöhnte ich frustriert.
»Na, die Züge fahren halt nicht nur wegen dir, Herr Bellier«, antwortete Marcel nüchtern. »Lass uns mal auf den Fahrplan schauen.« Es waren Ferien. Unter die üblichen Reisenden, Pendler und Geschäftsleute, hatten sich Familien und Jugendliche gemischt, bepackt mit Koffern oder Rucksäcken. Ihre Gesichtszüge spiegelten Reisestress wider, aber auch die Vorfreude auf den geplanten Urlaub. Marcel steuerte einen Schalter der Bahngesellschaft an, um die Verbindung nach München zu erfahren. Ich hielt ihn am Arm fest.
»Du willst nicht ernsthaft nachfragen. Der Typ kann sich doch an uns erinnern!«
Marcel sah mich verwundert an. »Quatsch, der sieht so viele Leute am Tag! Der prägt sich doch nicht ausgerechnet unsere zwei Gesichter ein.« Er war wieder viel lockerer als ich, was mich nicht sonderlich beruhigte.
»Zwei, alleinreisende Jungs, ohne Tickets, ohne Eltern?«, gab ich zu bedenken. »Der wundert sich auf jeden Fall über uns.«
»Ach was«, winkte Marcel ab und ging weiter.
»Ehrlich, lass uns das Risiko nicht eingehen«, ich hielt ihn am Arm zurück. »Zwei Kinder, die allein nach einer Zugverbindung nach Deutschland fragen, hat auch der nicht alle Tage. Lass uns die Züge selbst herausfinden.« Marcel gab nach. Wir entdeckten ein Computerterminal, mit dessen Hilfe Fahrtrouten zusammengestellt werden konnten. Nach einer Viertelstunde war die Reiseroute gefunden. Sie zwang uns zu mehrmaligem umsteigen. Ich fand das gut. So war es unauffälliger, weil wir nicht ständig mit denselben Leuten zusammen waren. Wahrscheinlich machte ich mir unnötige Sorgen. Sicher würde niemand Verdacht schöpfen. Schließlich war uns nicht auf die Nasenspitze geschrieben, dass wir ohne die Erlaubnis unserer Eltern unterwegs waren. Zusätzlich war Urlaubszeit. Zwischen den vielen Kindern und Jugendlichen würden wir gar nicht auffallen. Trotzdem hatte ich ein ungutes Gefühl. Wenn alles klappen würde, wären wir um halb sechs Uhr, am selben Abend, in München. Es lagen rund zwölf Stunden Reisestrecke vor uns. Deutschland war für mich ein unbekanntes Land, weit weg von zu Hause. Ein Gefühl, zwischen Furcht und Spannung kam in mir auf. Ernst sah ich Marcel an.
»Wenn du nicht mit willst, bin ich dir nicht böse.«
Er verdrehte die Augen. »Noch ein Wort und ich polier dir die Fresse! Was wir hier machen ist das Geilste, was ich mit meinen dreizehn Jahren je erlebt habe«, lachte er. »Außerdem sind das genau die Geschichten, die man später mal seinen Enkelkindern erzählt. Wenn ich jetzt hierbleibe, werde ich nie ein toller Opa«, grinste er mich an. »Was soll ich erzählen? Ich wäre fast mal mit meinem besten Freund nach Deutschland abgehauen, aber am Bahnhof haben wir kalte Füße bekommen?« Ich boxte ihm gegen die Schulter.
»Dann sollten wir uns überlegen, wie wir das mit den Fahrkarten machen.«
»Wie meinst du das denn jetzt?«, fragte mich Marcel verdutzt.
»Na, glaubst du im ernst, dass wir einfach im Zug unsere Fahrkarten vorzeigen und der Schaffner zwei kleine Jungs, ohne Eltern, Ausweis oder sonstige Papiere reisen lässt?«, gab ich zu bedenken.
»Hm, da ist vielleicht sogar was dran«, überlegte Marcel. »Lass uns erst mal was essen«, sagte er und zeigte mit dem Kopf auf einen Kiosk, der gerade öffnete. Wir kauften Croissants und Kakao. Ich folgte ihm zu einem Treppenabsatz, auf den wir uns hockten. Ich weiß nicht, über was Marcel nachdachte. Meine Gedanken kreisten darum, wie wir mit den Zugbegleitern umgehen konnten. Die Bahnhofsuhr zeigte nach fünf. In einer halben Stunde fuhr unsere Bahn. Marcel bemerkte meinen Blick zur Uhr und sah besorgt aus.
»Pass auf, wir haben keine Idee, wie wir die Zugbegleiter überzeugen, oder?«
»Richtig.« Gespannt wartete ich, was kommen würde.
»Das bedeutet, wir müssen denen erst mal aus dem Weg gehen.«
Ich blickte ihn skeptisch an. »Wir haben zwölf Stunden Zugfahrt vor uns und müssen drei Mal umsteigen. Da willst du es schaffen, den Kontrolleuren aus dem Weg zu gehen? Vergiss es. Selbst wenn es ein paar Mal gut geht, irgendwann werden sie uns erwischen.«
»Ist ja nur bis uns was einfällt. Außerdem hat auch keiner behauptet, dass es einfach werden würde. Als schönen Nebeneffekt, sparen wir uns das Geld für die Fahrkarten. Die brauchen wir nämlich nicht, wenn wir uns vorm Schaffner verstecken.« Wie immer hatte Marcel recht. Ich nickte.
»Also gut, wie sieht die Taktik aus?«
»Weiß nicht. Ich würde sagen, abwarten und spontan improvisieren.«
»Du schaffst mich«, stöhnte ich. Ohne zu antworten, stand er auf. Ich folgte ihm, mit einem flauen Gefühl im Magen, in Richtung der Gleise.
Viertel vor sechs, fuhr der Zug ein. Zusammen mit Dutzenden Reisenden kletterten wir die Stufen empor in den Waggon. Ich drängte mich dicht an Marcel. Von hinten drückte eine dicke Frau ins Abteil. Ich war froh, dass ich meinen Rucksack auf dem Rücken hatte, so konnte ich Körperkontakt zu ihr vermeiden. Ich stolperte über einen der vielen Koffer, die bereits in den Gängen standen, und konnte mich gerade noch an Marcel abfangen. Wir landeten fast auf einem Typen mit Anzug, der bereits einen Sitzplatz ergattert hatte und oberwichtig auf seinem Laptop herum tippte. Weiter bahnten wir uns den Weg in den nächsten Waggon. Marcel entdeckte zwei freie Sitze. Unter dem kritischen Blick eines älteren Mannes, aus der daneben liegenden Reihe, warf er von Weitem seinen Rucksack darauf. Fast alle Plätze waren reserviert und freie Sessel deshalb rar. Er wollte nicht riskieren, dass sie uns vor der Nase weggeschnappt wurden. Schließlich verstauten wir unsere Taschen in der Gepäckablage. Erschöpft fielen wir auf die Sitze. Noch würde es einige Minuten dauern, bis der Zug abfuhr, und so hatten wir eine Galgenfrist, bis zur ersten Fahrkartenkontrolle. In Gedanken blickte ich aus dem Fenster. Die Hektik auf dem Bahnsteig hatte nicht abgenommen. Noch immer stiegen Reisende in den Zug. Ab und zu kamen auch Menschen aus ihm heraus, die vermutlich Angehörige hinein begleitet hatten. Noch hatten wir die Chance auszusteigen und wieder nach Hause zu gehen. Vielleicht konnte ich mich in die Wohnung zurückschleichen, ohne dass mein Vater etwas bemerkte. Dann stellte ich mir vor, dass der Fremde mein Vater war. Ich musste die Wahrheit herausfinden. Ich drehte mich zu Marcel.
»Ganz schön verrückt was wir hier treiben, was?«
»Ach i wo, jetzt mach dir nicht so viele Gedanken. Genieß lieber die Reise«, beruhigte er mich.
»Ich bin froh, dass du bei mir bist.« Nach einer kurzen Pause fügte ich hinzu, »Danke, Mann.«
»Bro, jetzt hör auf damit. Du würdest das Gleiche für mich tun!«, sagte er peinlich berührt. Ich nickte lächelnd, war mir aber nicht sicher, ob ich das Gleiche für ihn getan hätte. Für die Zukunft wusste ich es zweifellos.
Es gab einen Ruck und der Zug setzte sich in Bewegung. Jetzt gab kein Zurück mehr. Ich war erleichtert, dass es losging. Die Entscheidung war getroffen und nicht mehr rückgängig zu machen. Alles würde seinen Lauf nehmen. Das Schicksal würde entscheiden welchen.
Marcel packte sein Handy aus und setzte sich die Kopfhörer auf. Er deutete den Gang entlang.
»Kann ich besser drüber nachdenken, wie wir an dem vorbei kommen.« Einige Sitzreihen entfernt, stand ein Zugbegleiter, der momentan noch damit beschäftigt war, einigen Reisenden bei der Platzsuche behilflich zu sein. Ihn galt es also zu überlisten.