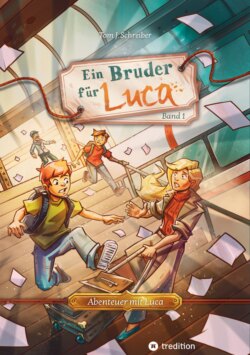Читать книгу Ein Bruder für Luca - Tom J Schreiber - Страница 12
Оглавление7
»Wie meinen Sie das, Ihr Sohn ist auch nicht zu Hause?« Armand Bellier war außer sich. Tatsächlich war er heute Morgen in mein Zimmer gegangen, um mich noch einmal zur Rede zu stellen, und hatte mein Bett leer vorgefunden. Er holte mein Handy. Es war ausgegangen. Der Akku war leer. Als er es an den Strom angeschlossen hatte, verlangte es eine PIN. Er griff zum Telefonhörer, um bei Marcels Eltern anzurufen. Ein für alle Mal musste geklärt werden, dass sie sich nicht ständig einmischen sollten. Er war sicher, dass sie wussten, wo ich steckte. Mit dieser Antwort hatte er nicht gerechnet. Seine Gefühle schwankten zwischen haltlosem Ärger, Misstrauen, vielleicht sogar ein bisschen Sorge. Er wusste nicht, was er tun oder sagen sollte. Eine Situation, die er hasste.
»Nun, ich meine es wie ich es sage, Herr Bellier. Marcel ist nicht zu Hause. Wir wussten allerdings nicht, dass Jean bei ihm ist.«
»Natürlich ist er bei ihm. Die beiden stecken doch andauernd zusammen und hecken etwas aus«, war Herr Bellier verärgert.
»Das liegt sicher nahe, so gut wie sie befreundet sind«, bestätigte Frau Lavenant höflich. »Marcel hat einen Zettel hingelegt, dass er am Strand ist. Wenn Jean bei ihm ist, müssen Sie sich sicher nicht sorgen.«
»Es geht weniger darum, dass ich mich sorge, als dass mein Sohn Hausarrest hat und wieder einmal von Ihrem Sohn verführt wurde, die Regeln zu brechen«, raunzte er schlecht gelaunt ins Telefon.
»Das tut mir leid«, sagte Frau Lavenant noch immer freundlich. »Aber Sie wissen ja, wie Jungs in diesem Alter sind.« Im Hörer klickte es. Herr Bellier hatte aufgelegt. »Ein unangenehmer Kerl«, sagte sie zu ihrem Mann. »Meinst du wirklich, sie sind am Strand? Ich mache mir doch irgendwie Sorgen.«
»Ach was, die beiden haben Ferien. Sicher haben sie sich irgendetwas ausgedacht. Ich könnte wetten, dass es mit dem Hausarrest von Jean zu tun hat.«
»Du hast die Ruhe weg«, sagte Frau Lavenant. »Sorgst du dich nie um Marcel?«
»Ich sorge mich dauernd um ihn«, gab er milde lächelnd zurück. »Aber ich glaube, wir würden ihm keinen Gefallen tun, wenn wir ihn vor lauter Sorge erdrücken würden. Marcel ist vernünftig, sie machen schon keinen Blödsinn.«
»Hoffentlich hast du Recht«, gab sie seufzend zurück.
Bei diesen Worten klingelte das Telefon. Sofort nahm Marcels Mutter den Hörer ab. Undeutlich erkannte sie die Stimme ihres Sohnes, die unter lautem Stimmengewirr kaum zu verstehen war.
»Mom, bist du das?«
»Ja … Marcel? Wo bist du?«
»Bitte bleib jetzt ganz ruhig. Mir geht es gut, aber ich werde heute nicht mehr nach Hause kommen können. Ich habe euch das mit Jean´s Vater doch erzählt, er hatte meine Hilfe benötigt und ist hier bei mir. Seid bitte nicht sauer, ich werde den Rest in ein paar Tagen erklären, sobald ich wieder zu Hause bin. Vertraut mir, okay?«
Marcel hatte überlegt, was er sagen wollte und einfach keine Pause gemacht, um nicht unterbrochen zu werden. Er lauschte gespannt nach der Antwort. Schlagartig zuckte er zusammen und hielt das Telefon vom Ohr weg.
»Sag mal, spinnt ihr?«, rief Marcels Mutter so laut, dass sogar ich es noch hören konnte. Nach einer kurzen Pause kam sein Vater an den Apparat. Marcel wurde unruhig. Sein Dad war ein schwieriger Gegner. Er hatte meist Argumente, gegen die Marcel nicht ankam. Seine Mutter war aufbrausend, hatte dann aber Verständnis. Sie fing auch selten an etwas auszudiskutieren.
»Marcel, hier ist dein Vater. Ihr braucht nicht weiterzusprechen. Es ist absoluter Quatsch, was ihr da tut. Wir können das genauso gut anders lösen. Kommt sofort nach Hause!« Marcel hielt mit der flachen Hand das Mikrofon zu.
»Es ist das Beste ihm recht zu geben«, flüsterte er grinsend und sprach weiter. »Das weiß ich, dass das Quatsch ist, aber hör zu Dad, Jean hatte meine Hilfe gebraucht und ich lasse meinen besten Freund nicht im Stich. Ihr hättet gegen den Willen seines Vaters doch auch nicht mit uns wegfahren können, so sahen wir keine andere Chance. Wir ziehen das durch.« Marcel sah mich an. Einige Sekunden war es ruhig am anderen Ende, aber auch sein Vater kannte seinen Sohn.
»Gut, ich bin einverstanden.« Marcel gab mir verblüfft ein Zeichen, dass er es geschluckt hatte. »Ihr werdet euch regelmäßig, morgens und abends, melden. Wenn ich nichts höre, verständige ich sofort die Polizei und lasse nach euch suchen«, gab er Anweisung. Etwas milder fügte er hinzu, »ob ihr nun mit oder ohne meine Erlaubnis unterwegs seid, das Risiko ist schließlich das Gleiche. Habt ihr genügend Geld dabei?«
»Ja Dad, ich hab mein Sparschwein geplündert. Ich muss Schluss machen.« Er wollte gerade auflegen, als sein Vater noch etwas sagte:
»Marcel?«
»Bin noch da.«
»Passt auf euch auf! Deine Mutter ist wahnsinnig vor Sorge. Wir lieben dich sehr. Grüße Jean von uns, wir wünschen ihm viel Glück.«
»Danke Dad, ich werde es Jean ausrichten. Ich liebe euch auch. Bis bald.« Herr Lavenant ließ den Hörer sinken. Marcel hatte aufgelegt. Still sah er seine Frau an.
»Er tut, was ich auch getan hätte.« Er nahm seine Frau in den Arm und drückte sie zärtlich an sich.
»Ich habe Angst, Marc.«
»Mach dir keine Sorgen, sie passen schon auf sich auf.« In Wirklichkeit war er es, der sich sorgte. Er vertraute seinem Sohn. Sicher würde er sich zurechtfinden, dennoch konnte immer etwas passieren. »Weißt du, ein kleines bisschen beneide ich die beiden sogar um das Abenteuer. Als Erwachsener ist so was ja gar nicht mehr möglich«, sagte Marcels Vater gedankenverloren zu seiner Frau.
»Zumindest müssen wir uns nicht fragen, von wem er diesen Blödsinn wohl hat«, schüttelte sie den Kopf.
Die Uhr über dem Hauptportal zeigte Viertel vor zwölf. Wir waren beruhigt, nachdem nun wenigstens Marcels Eltern informiert waren. Wir kauften an einem Kiosk eine Kleinigkeit zu essen und setzten uns auf eine Bank gegenüber der Bahnsteige. Marcel tippte auf seinem Telefon herum, um Musik zu suchen, und gab mir einen Teil seines Ohrhörers. So saßen wir eine Weile da, hörten Musik und aßen unseren Snack, während jeder für sich seinen Gedanken nachhing. Es nervte mich die Zeit zu vergeuden und freute mich umso mehr auf die Weiterfahrt, als sich vier Jugendliche vor uns aufbauten. Sie waren etwa sechzehn Jahre alt, vielleicht auch jünger. Sie machten den Eindruck, als hätten alle im gleichen Klamottenladen eingekauft und irgendwie die Größen verwechselt. Von Marseille kannte ich einen solchen Style nicht. Wie auch immer, spürte ich sofort, dass sie auf Ärger aus waren. Marcel sah mich an. Er sagte nichts, seiner Mimik war aber zu entnehmen, dass ihm die Situation genauso wenig geheuer war wie mir.
»Das Teil da, gehört uns!«, deutete der Größte der Gruppe auf Marcels Smartphone. Seine Stimme klang mindestens so herablassend wie bedrohlich. Er hatte die Arme verschränkt, was seine kräftigen Bizepse zur Geltung brachte. Die anderen lachten hämisch. Sie stießen sich gegenseitig, belustigt an die Brust. Wieder tauschte Marcel Blicke mit mir. Er hatte Angst, genau wie ich. In seinen Augen konnte ich aber sehen, dass er nicht vor hatte, sich das gefallen zu lassen. Die Situation war brenzlig. Wenn sich Marcel weigerte, hatten wir gleich ein Problem.
»Gib’s lieber her«, flüsterte ich ihm zu. Aber es war nicht Marcels Art, sich etwas wegnehmen zu lassen. Er schüttelte den Kopf.
»Du musst dich da täuschen«, sagte er auf Französisch zu dem Jungen. »Das ist meins und bleibt auch meins.« Der Große trat einen Schritt auf Marcel zu, der zurückwich, seinem Blick aber standhielt. Aufgeregt schaute ich mich in der Halle um. Keiner im Bahnhof schien Notiz zu nehmen. Sofort rückten die anderen näher, um uns den Fluchtweg zu versperren.
»Du bist ein kleiner Dieb«, zischte der Große bedrohlich. »Gib mir mein Telefon zurück, bevor ich damit einen Krankenwagen für dich rufen muss«, wurde er deutlich, während er weiter auf Marcel zuging. Im gleichen Moment zogen auch die anderen Jungs den Kreis enger. Ich hatte keine Chance Marcel beizustehen, und ich hatte Angst.
»Weißt du«, sagte Marcel, »ich hab leider keinen Schiss vor dir.« Ich durchschaute, dass das nicht stimmte, sah im gleichen Moment, wie er mit Schwung sein Knie in den Unterleib seines Widersachers rammte. Dieser knickte zusammen. Marcel nutzte die Überraschung der anderen, einem Weiteren von ihnen, seinen Ellenbogen in den Rücken zu dreschen. Auch der krümmte sich vor Schmerz. Die Gruppe war auseinandergebrochen. Zu unserem Elend ließen sich die beiden anderen nicht davon beeindrucken. Einer versetzte Marcel einen harten Schlag in die Magengegend. Zornig ballte ich meine Hand zur Faust, spürte aber im gleichen Moment zwei Hände an meinen Schultern und kurz darauf einen Schmerz in der Leistengegend. Hilfesuchend blickte ich nach Marcel, der gekrümmt auf dem Bahnhofsboden lag. Wild um mich schlagend, versuchte ich die Umklammerung zu lösen.
»Das ist für deinen Freund«, brüllte der Große, der sich schneller erholt hatte als gedacht. Sein Knie traf mich, gefolgt von einem reißenden Schmerz in der Leiste, ein zweites Mal in meinen Kronjuwelen. Ich wollte laut nach Hilfe rufen, brachte aber nur ein lautloses Glucksen hervor und sackte auf die Knie. Das Nächste, was ich spürte, war ein Tritt in die Seite. Kraftlos brach ich zusammen. Alle Konzentration darauf verwendend, meinen Stolz zu behalten und nicht zu weinen, wartete ich auf weitere Schläge. Völlig unfähig mich zu bewegen, spürte ich jeden einzelnen Knochen. Mein Unterleib schmerzte. In der Hüfte spürte ich ein Stechen, wie von tausend Stecknadeln. Ich wollte dagegen ankämpfen. Durch die beiden Treffer gehorchte mir mein Körper aber nicht mehr. Der Schmerz übernahm die Kontrolle. Fast erlösend, erreichte mich der dritte Schlag in den Bauch. Mir wurde schwarz vor Augen. Aus der Ferne hörte ich die Angreifer und meinte auch zu hören, wie Marcel meinen Namen schrie. Ich rief zurück, merkte jedoch, dass mir kein Laut entkam. Ich musste ihm zur Hilfe kommen. Die Stimmen waren jetzt weit weg. Hatten sie sich entfernt oder war ich fortgetragen worden? Ich fühlte keinen Boden mehr unter mir. Nie zuvor hatte ich einen solchen Zustand der Machtlosigkeit erlebt. Ich spürte Schmerz am ganzen Körper und hatte Mühe, Luft zu holen. Es ging nicht. Ich konnte nichts für Marcel tun. Schließlich hörte ich die Stimmen nicht mehr, es war still geworden.
Nach einer Weile Dunkelheit, ich wusste nicht, wie lange ich so gelegen hatte, bemerkte ich, dass mein Körper bewegt wurde. Vor meinen Augen lichtete sich der Schleier. Es dauerte ein paar Sekunden, bis Marcels Gesicht scharf wurde.
»Jean, alles klar? Sag doch was«, flehte er mich an. Er kniete neben mir und hatte meinen Kopf auf seinem Schoß liegen. Ein Rinnsal Blut lief aus seinem Mundwinkel, über seine Wangen dicke Tränen. Beides tropfte auf sein T-Shirt.
»Du blutest ja!«, war das Einzige, was ich hervorbrachte.
»Zum Glück, Mann! Bin ich froh … also, dass du wieder bei dir bist.« Auf sein blutverschmiertes T-Shirt blickend, fügte er hinzu, »das ist nicht so schlimm, ich hab mir nur auf die Zunge gebissen. Dafür hat der andere einen Zahn geopfert.«
Er grinste und versuchte, mir auf die Beine zu helfen. Meinen Körper durchfuhr ein einziger Schmerz.
»Sollen wir lieber einen Arzt holen?«, fragte Marcel besorgt.
»Auf keinen Fall«, sagte ich verbissen und versuchte, mir die Schmerzen nicht weiter anmerken zu lassen, obwohl ich fürchtete, etwas gebrochen zu haben. Ein Arzt war keine Option. Ich nahm die Blicke einiger Umstehender wahr, die uns zwar anstarrten, aber nicht halfen.
»Junge hat der Arsch mich malträtiert«, stöhnte ich.
»Bro, dafür hab ich dem Großen eine mitgegeben, bevor er seinen feigen Kumpels nachgerannt ist«, antwortete Marcel vorsichtig. Er wusste nicht genau, ob mich das wirklich tröstete.
»Danke! Bist ein echter Freund«, brachte ich unter Schmerzen hervor. Wir setzten uns auf eine Bank. Ich sah sein Handy zertrümmert am Boden liegen.
»Schweine«, sagte ich zu Marcel. Er nickte.
»Das kannst du laut sagen. Die Ärsche haben unsere Rucksäcke und unser ganzes Geld mitgehen lassen. Ich bin froh, dass wir schon was gegessen haben.« Wir mussten lachen. Sofort spürte ich einen stechenden Schmerz in der Seite.
»O Mann, ich hoffe mal, ich hab mir nichts gebrochen.« Marcel sah mich besorgt an.
»Bist du sicher, dass wir nicht in ein Krankenhaus sollen? Vielleicht hast du innere Blutungen oder so.«
»Mach mal halblang«, sagte ich schnell und bestimmt. »Das wird schon wieder. Wir suchen jetzt unseren Zug. Ich will endlich zu meinem Vater.«
»Wenn du meinst.«
»Ja, das mein ich«, sagte ich. Langsam und wortlos trotteten wir nebeneinander her.
»Was bist du eigentlich für ein Tier?«, sagte ich. »Die waren zu viert und doch bestimmt alle älter als wir.«
»Ach was«, antwortete er. »Lieber ab und zu mal ein bisschen Schmerz aushalten und Mann bleiben, als sich immer alles gefallen zu lassen.«
»Du bist irre«, lachte ich, legte meinen Arm um ihn, was sofort mit einem stechenden Schmerz in meiner Schulter quittiert wurde. Es war nicht die einzige Bewegung, die mir weh tat. Immer wieder zuckte ich zusammen, biss aber auf die Zähne, um Marcel nicht zu beunruhigen. Ihn schien es gar nicht zu bekümmern, dass wir nichts mehr besaßen, außer unserer Kleidung am Körper. Sein T-Shirt war voller Blut, meines am Kragen aufgerissen, und die Jeans schwarz vor Schmutz. Ich tastete mit der Zunge nach meinen Zähnen, die noch alle vorhanden waren. Marcel grinste mir zu.
»Keine Angst, du hattest nur Nasenbluten. Sieht aber echt verwegen aus.«
»Sag mal, wie hast du es eigentlich geschafft, die loszuwerden?«, fragte ich. Abermals fing Marcel an zu grinsen. Er plusterte sich auf und meinte ganz lässig:
»Solche vernasche ich doch zum Frühstück. Einmal mit dem Finger geschnippt und der Fall ist erledigt.«
Ich lachte. »Ne, ernsthaft!«
»Na ja Bro, mir blieb ganz schön die Luft weg, als mir der eine in den Magen geschlagen hatte. Aber als ich gesehen habe, wie die beiden auf dich eingedroschen haben, obwohl du wehrlos auf dem Boden gelegen hast, bin ich ausgerastet. Ich hab nur um mich geschlagen und rumgeschrien. Wahrscheinlich ist es denen zu mulmig geworden. Aber bevor sie abgehauen sind, hab ich an dem Großen noch Rache für dich genommen.« Lachend zog er einen Schneidezahn aus der Tasche.
»Du bist ekelhaft«, verzog ich das Gesicht. »Willst du den ernsthaft behalten?«
»Klar, als Trophäe vom besiegten Feind.«
»Du hast ’nen Schatten. Hoffentlich hatte der wenigstens die Zähne geputzt«, schüttelte ich den Kopf und Marcel packte seinen Zahn, stolz wieder in die Tasche.
Als wir am Gleis eintrafen, stellten wir wenig erstaunt fest, dass wir den Anschlusszug verpasst hatten. In fünfzehn Minuten fuhr ein Zug nach Zürich. Damit gelangten wir über Innsbruck, nach München. Der Theorie nach zumindest. Inzwischen sahen wir nicht mehr aus, wie gewöhnliche Reisende, sondern eher, wie jugendliche Schläger oder obdachlose Bettelkinder.
»Meinst du, wir können die Tour wie bisher durchziehen, so wie wir aussehen?« Ich sah Marcel skeptisch an. Er zuckte mit den Schultern.
»Eher nicht. Wir brauchen ’ne neue Taktik. Unauffällig geht wohl nicht mehr«, grinste er. Mir war schleierhaft, woher Marcel diesen Optimismus nahm. Wir suchten uns ein freies Abteil. Der Zug war ziemlich leer. Die ganze Zeit war ich über möglichst viel Gedränge froh gewesen. Jetzt war ich froh, nicht weiter angestarrt zu werden. Wir ließen uns gegenüber in die Sitze fallen. Marcel sah wirklich schlimm aus. Um seine Mundwinkel hatten sich, überall wo das Blut herausgetropft war, Krusten gebildet. Seine Hände und seine Fingernägel, waren schwarz.
»Du brauchst mich gar nicht so ansehen«, lachte er. »Du siehst nicht besser aus.« Er wurde nachdenklich. »Wenn ich mir das recht überlege, hätte das übel ausgehen können. Ich glaube, wir hatten richtig Glück.«
Ich nickte. »Hoffentlich haben wir das auch weiterhin. Wenn der Schaffner uns sieht, schmeißt er uns hochkant aus dem Zug oder übergibt uns der Bahnpolizei.« Marcel blickte stumm und nachdenklich vor sich hin. Nach einer kurzen Weile hellte sich seine Miene auf.
»Wir werden ihm einfach die Wahrheit sagen. Dass wir überfallen wurden, man unser ganzes Geld und die Fahrscheine gestohlen hat, wir aber dringend weiter müssen, weil uns unsere Eltern in München schon am Bahnsteig erwarten.«
»Das funktioniert nie. Er wird auf jeden Fall die Polizei informieren. Er hat doch so was wie eine Fürsorgepflicht«, gab ich zu bedenken.
»Was anderes fällt mir auch nicht ein. Du kommst doch smart rüber. Bettel einfach ganz süß. Erklär ihm, dass wir unsere Eltern nicht mehr erreichen können und alles nur noch schlimmer wird, wenn er uns festhält.« Skeptisch sah ich Marcel an.
»Keine Chance, aber probieren wir es halt. Hilft ja nichts«, sagte ich, weil mir auch nichts Besseres einfiel.
Im selben Moment, als ich das sagte, wurde mit einem Ruck die Abteiltür aufgerissen.